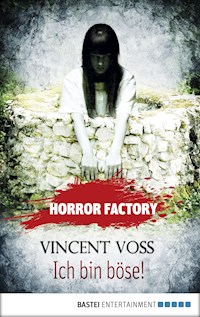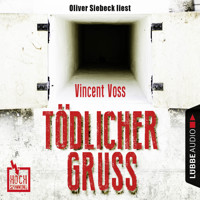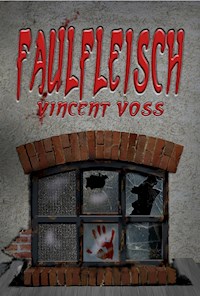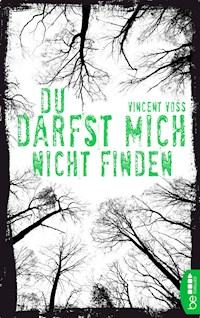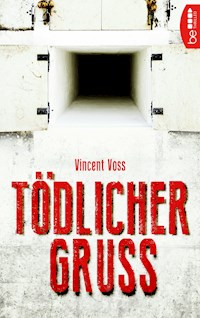Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Amrun Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Mängelexemplare
- Sprache: Deutsch
Horror trifft Dystopie! Die legendäre und mehrfach prämierte Anthologiereihe Mängelexemplare meldet sich mit einer neuen Ausgabe zurück. Kein neuer Anfang. Am Ende der Zeit erwartet uns kein neuer Anfang. Die Menschheit rast mit Vollgas ins Verderben. Augen zu und durch – bis wir in einer Welt erwachen, die nicht mehr so ist, wie wir sie kannten. Der Kampf ums Überleben beginnt … Mängelexemplare: Am Ende der Zeit Das sind zwölf dystopische Kurzgeschichten und ein verzweifelter Wissenschaftler, bei dem die Uhren anders ticken. Die offizielle Fortsetzung der erfolgreichen Anthologie Dystopia, die 2014 als beste Kurzgeschichtensammlung des Jahres ausgezeichnet wurde. Mit Carolin Gmyrek, Vincent Voss, Tobias Bachmann, Lilly Rautenberger, Andreas Zwengel, Arthur Gordon Wolf, Xander Morus, Lisanne Surborg, Sonja Rüther, Jana Oltersdorff, Thomas Backus sowie Stefan Cernohuby und Constantin Dupien ---- Mängelexemplare V ist eine Anthologie-Dilogie. Der Schwesternband Hinter den Fenstern ist ebenfalls im Amrûn Verlag erschienen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mängelexemplare:
Am Ende der Zeit
Anthologie
Herausgegeben von Constantin Dupien
und Stefan Cernohuby
© 2023 Amrûn Verlag Jürgen Eglseer, Traunstein
© der Kurzgeschichten bei den jeweiligen Autoren
ISBN TB – 978-3-95869-535-1
Lektorat: Lilly Rautenberger & Carolin Gmyrek / Lektorat WechselseitigHerausgeberConstantin Dupien und Stefan Cernohuby
Alle Rechte vorbehalten
Besuchen Sie unsere Webseite:
http://amrun-verlag.de
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar
v1/23
Biografien
https://amrun-verlag.de/me-zeit-bios/
Vorwort
Literatur und Handarbeitsprojekte haben zuweilen mehr gemeinsam, als man glauben mag.
Es gibt oft einen roten Faden, den man manchmal zu verlieren droht. Es gibt Verknüpfungen, Verstrickungen und ab und an verheddert man sich in seinem Werkstück. Vor allem weiß man nie, wann man einem offenen Faden begegnet, den man aufgreifen kann.
Im Fall der vorliegenden Mängelexemplare-Dilogie, bei der ich Mitherausgeber bin, hat sich meine Beteiligung sukzessive entwickelt. In einem Gespräch mit Constantin Dupien, in dem er mir seine Vision für die fünfte Ausgabe der Anthologie-Reihe skizziert und um meine Beteiligung gebeten hatte, wollte ich aus Zeitgründen zuerst ablehnen. Ich empfahl ihm stattdessen eine befreundete Autorin, der ich zutraute, das gewünschte Szenario zu entwickeln, das sowohl die Geschichten dieses Buches Am Ende der Zeit miteinander verknüpfen als auch eine Verbindung zum Schwesternband Hinter den Fenstern herstellen würde.
Zwei Bände, die für sich allein stehen könnten, aber Überraschungen für all jene bereithalten, die beide Werke lesen.
Constantin hatte bereits sehr konkrete Vorstellungen: Er wollte ein zentrales, alles verbindendes Element, das in verschiedene Dimensionen wirkt, und einen im Verborgenen tüftelnder Professor …
Ich verstand. Er spielte damit auf Professor Maximilian Groll an. Einen Charakter, den ich für den Metaplot der 2017 ebenfalls im Amrûn Verlag erschienenen Anthologie Das Dimensionstor erschaffen habe. Über die nächsten Wochen tauschten wir uns mehrfach aus und als die Gespräche mit meiner befreundeten Autorin im Sande verliefen, sagte ich schließlich doch zu.
Gemeinsam erschufen wir eine Rahmenhandlung, die die beiden unterschiedlichen Konzepte der Werke miteinander verband.
Ich fabulierte von Öffnungen zwischen Dimensionen, einem geheimen Labor, unglaublichen Experimenten und von Zeitschleifen. Von einer Erzählung, die unmittelbar dort, wo sie aufhörte, wieder von Neuem begann. Zu meiner nicht geringen Verblüffung war Constantin begeistert.
Wir sponnen die Fäden weiter und webten die Geschichten der Autorinnen und Autoren in die Rahmenhandlung ein. Ich erweckte die Figur Professor Groll zu neuem Leben.
Damit wir bei all der Komplexität nicht die Übersicht verlieren würden, brachte ich meine Erfahrung in der Organisation von Literaturprojekten – insbesondere mit mehreren Personen und Verknüpfungen zwischen Geschichten – ein. Wir setzten ein Board auf, in dem wir das gesamte Projekt für uns und das Lektorat organisierten. Damit konnten wir den Fokus wieder auf die Umsetzung der Anthologie legen.
Schlussendlich herausgekommen ist eine – in dieser Form wohl einzigartige – Anthologie-Dilogie mit einer Rahmenhandlung in mehreren Episoden und ganz unterschiedlichen Perspektiven, die um ein zentrales Element kreisen. Dieses ganz besondere Haus, das mal zentral, mal weiter entfernt von der Handlung steht und mehr Türen beherbergt, als auf den ersten Blick ersichtlich ist.
Ich freue mich, dass ich Elemente zu einem großen Ganzen beisteuern dufte, die hoffentlich dazu beitragen, dass viele Lesende neue Türen zu Geschichten öffnen, um herauszufinden, was es mit dem geheimnisvollen Haus auf sich hat.
Willkommen zurück in der Welt von Constantin Dupiens Mängelexemplaren, die ich nun selbst zu einem Teil mitgestalten durfte.
Stefan Cernohuby im September 2023
Die Dunkelunken
Lilly Rautenberger
Ebenholzschwarze Haut schimmert im Mondlicht, bewegungslos.
Die feuchten Augen starr auf dich gerichtet – dir direkt ins Herz.
Sie unken von der Finsternis.
In kaltem, klammem Bann starrst du zurück.
Das Pochen im Ohr der Takt, in dem sich ein Auge nach dem anderen schließt und endlich wieder öffnet.
Dann starrt es wieder still und blickt und unkt dir klamme, kalte Furcht ins Herz. Das ist die Nacht der Dunkelunken.
36 Stunden …
Stefan Cernohuby
Der Professor
36 Stunden.
36 Stunden, in denen ich essen, schlafen und forschen kann. Wenn diese Zeitspanne abgelaufen ist, muss ich mich darauf einstellen, dass Hausbewohner wie eine wütende Elefantenherde durch mein Labor toben, bevor alles wieder von vorne beginnt.
Woran ich forsche, ist die Feinjustierung der Parameter für meine Geräte. Eines der Probleme ist, dass ich jedes Mal wieder bei Null beginnen muss und nur auf mein Gedächtnis vertrauen kann. Physisch wird die Schleife komplett zurückgesetzt. Es wäre eigentlich logisch, dass auch meine Erinnerungen verschwinden, aber aus irgendeinem Grund bleiben sie. Selbst wenn ich in der vorangegangenen Schleife gestorben bin … und das ist nicht nur einmal passiert. Aber ich merke gerade, ich schweife ab.
Vermutlich werden meine Erinnerungen nicht zurückgesetzt, weil ich mich hier im Auge des Sturms befinde.
Im Grunde bin ich selbst schuld. Ich bin nicht von hier und als ich ankam, wusste ich sofort, ich bin nicht länger in Kansas.
Für alle, die jetzt die Stirn runzeln. Nein, ich bin nicht aus den USA. Das war nur eine literarische Referenz. Tatsächlich stamme ich aus Deutschland, habe studiert und später sogar an einer großen Universität unterrichtet.
Mein Hauptprojekt war eines, für das ich eine Menge Fördergelder erhalten habe. Ich hatte ein wissenschaftliches Konzept für Dimensionstore entwickelt. Ohne Sie langweilen zu wollen und einfach zusammengefasst: Ich hatte vor, durch Öffnung der höheren Quantendimensionen mittels Nutzung der Van-Der-Waals-Kräfte für Energie- und Impulsaustausch ein Portal zwischen den Dimensionen zu erschaffen. Es hat zuerst nicht funktioniert, weil ich verschiedene Konstanten und natürliche Gegebenheiten in meiner Formel nicht berücksichtigt habe. Erst als ich das Experiment, für das ich mir etliche Geräte meines Ex-Arbeitgebers geborgt hatte, in meiner Garage wiederholte, gelang es.
Aus verschiedenen Gründen, die ich nicht näher ausführen will, landete ich schließlich hier.
Hier, in dieser Welt des Mangels, die immer hart am Abgrund zu balancieren scheint. Doch eine Welt, die in ihrer Grundsubstanz etwas instabil oder zumindest unscharf an den Rändern ist, hat einen Vorteil: Die Wände ihrer Realität sind weniger stark. Dinge von außen dringen ein und umgekehrt.
Es hat mich ein wenig Recherche gekostet, bis ich auf dieses Haus gestoßen bin.
Dieses verdammte Haus und diesen verdammten Keller!
Als ich die Häufung der unerklärlichen, unverständlichen und unlogischen Ereignisse ermittelt hatte, die sich auf und rund um dieses Grundstück abgespielt haben, war mir klar: Hier ist der logische Ansatzpunkt. Der Punkt, um mein physikalisches Hintergrundwissen und meine ausgewiesene praktische Expertise in dieser Thematik mit einem neuen Szenario zu konfrontieren.
Irgendwie war ich ja auch erfolgreich. Ich habe die gesamte zweite Kellerebene gekauft und für die anderen Bewohner des Hauses nicht nur abgeriegelt, sondern auch den Zugang ins Verborgene gerückt. Bis zum heutigen Tag hat das gut funktioniert. Nur, dass Heute jetzt schon 2.842 Mal stattgefunden hat.
Mit der Zeit hat sich eine gewisse Routine eingestellt und ich probiere verschiedene Dinge aus, die unterschiedlich lange dauern. So kommt es gelegentlich auch zu Leerzeiten. Diese nutze ich dann für die unterschiedlichsten Beschäftigungen, so wie diese komplett unnützen Notizen. Notizen, welche die nächste Schleife ohnehin nicht überstehen werden. Aber sie helfen mir, die Zeit zu überbrücken. Ich habe den Ablauf des Tages schon so gut im Gefühl, dass ich diese Niederschrift genau bis zu dem Punkt führen kann, an dem ich die unvermeidlichen Schritte auf der Treppe höre.
Unsichere Schritte, getrieben von den Ereignissen, die hinter den Fenstern der Wohnungen in diesem Haus passierten. Sie bringen mir das entscheidende Element für meine Experimente. Für meinen Versuch, aus dieser Schleife auszubrechen. Ich benötige diese Schritte, dieses Subjekt, zu dem sie gehören. Denn erst diese Einmischung führt dazu, dass sich etwas verändert.
Vielleicht habe ich es diesmal richtiggemacht. Vielleicht sind meine winzigen Anpassungen an den Koppelkondensatoren jene Veränderung, die ich brauche, um nicht wieder von vorne beginnen zu müssen. Vielleicht lande ich diesmal wieder in meiner eigenen Welt. Oder in einer anderen und nicht wieder am Anfang der Schleife.
Ich habe festgestellt, dass andere Individuen, welche die Portale durchschreiten, keine bewussten Erinnerungen haben. Aber die Ereignisse im Haus laufen nicht immer exakt gleich ab. Als ich mein Labor hier aufgebaut habe, habe ich auch dafür gesorgt, über alles, was im Haus passiert, im Bilde zu sein. Und sie können mir glauben …
Nein, Sie würden mir nicht glauben, was hier alles passiert ist, außer sie hätten das selbst gesehen. Ich habe alles Mögliche versucht, andere Welten bereist, nur um wieder an den Beginn zurückzukehren. Nun bin und bleibe ich hier, im Auge des Sturms. An dem Ort, an dem ich am meisten bewirken, die Ereignisse steuern kann. Und es gibt Variationen. Kleine Veränderungen, die mich hoffen lassen.
Und jetzt ist es soweit.
Ich höre die Schritte.
Ich beende meine Notizen.
Ich mache mich bereit.
Minzkonzentrat
Carolin Gmyrek
Sie leckte sich über die Lippen. Mit den Fingern fuhr sie durch ihr schwarzes Haar und zog es zu einem Zopf zusammen. Sie blickte in den Spiegel. Eine Frau blickte zurück. Sie ließ die Haare wieder auf ihre Schultern fallen, beobachte die schweren Strähnen. Ihre Augen richteten sich nach vorn, schauten in ihre eigenen Pupillen. Sie sah müde aus. Tiefe, dunkle Ringe lagen unter ihren Augenlidern.
Sie suchte nach einem Lappen. Fahrig rutschen ihre Hände über den Waschbeckenrand. Das Porzellan war kühl und seifig.
Sie strich mit dem dicken Stoff über ihre Wangen, drückte gegen ihr Fleisch und spürt ihre Zähne die Innenhaut kratzen, spürte die Reibung und den leichten Schmerz. Tränen rannen ihren Hals hinab. Sie schmeckte Salz. Es brannte.
Irgendwann senkte sie den Lappen. Das Gesicht ihr gegenüber war verschwommen und bleich. Nur auf der Wange war ein deutlicher roter Fleck zu sehen. Sie begann zu würgen, dann schrie sie.
Schallwellen trafen sie, bis sie zu Boden gerissen wurde. Sie schlang ihre Arme um ihren Kopf, weinte und hoffte auf jedes Gramm Luft, dass sie zwischen dem Beben der Welt erhaschen konnte.
Wummernd hallten ihre Schreie von den Wänden, dem Waschbecken, dem Spiegel und von der Toilettenschüssel. Es klirrte, knackte, ein Riss brach sich die Fliesen entlang und brandete auf sie zu. Das Bad pulsierte. Es zog sich wie ein Brustkorb zusammen und weitete sich wieder aus. Ihr Herz schlug, dann stand es still und schmolz.
Ihre Haare waren ihr ins Gesicht gefallen. Sie schwitzte. Diese Bilder pulsierten in ihrem Schädel nach und machten ihr Kopfschmerzen. Es wurde schlimmer und öfter. Bald würden die Angst und die Dunkelheit sie vollkommen verschlingen.
»Nicht mit mir!«, flüsterte sie ihrem Spiegelbild entgegen. Sie sah noch immer müde aus. Der rote Fleck an ihrer Wange war nur ein schmaler Schatten. Ihre Finger wanderten zu ihrer Schläfe und fuhren über die runde Druckstelle. Sie glühte rot. War das eine Überlastung? Sie strich darüber, spürte den leichten Druck der kleinen Platine. Sie begann zu blinken.
»Na also, du Scheißding!«
Die Platine erlosch, dann leuchtete sie in einem hellem gelb-grün und war kaum noch zu sehen. Ein Lächeln huschte über das Gesicht der Spiegelfrau. Der Traum war verkauft. Eine gute Anzahl an Credits.
Zufrieden griff sie nach dem Shirt, das auf der Waschmaschine lag und streifte es über. Ihre Haare schlang sie mit einem Gummi zu einem Dutt hoch, dann verließ sie das Bad und wenige Minuten später die kleine Dachgeschosswohnung.
»Du siehst müde aus!«, sagte Monika, während sie mit einem Glasstäbchen in ihrer Tasse herumrührte. Kaffee, Milch und die drei Krümel Zucker hatten längst eine Einheit gebildet, die in einem kleinen Strudel herumwirbelte. Das Geräusch, wenn Glas auf Keramik stieß, hypnotisierte Kore. Es fiel ihr immer schwerer, dem Gespräch mit ihrer Freundin zu folgen. Das Klirren beanspruchte ihre ganze Aufmerksamkeit. Lächelnd beugte sie sich vor und legte eine Hand auf Monikas. Das Geräusch verstummte, die Stimmen des Alltags wurden lauter.
»War eine lange Nacht«, erklärte Kore.
»Wann warst du das letzte Mal unter Leuten?«, fragte Monika. Kore lächelte. »Ich mag diese Art der Kommunikation nicht, das weißt du. Und die Menschen mögen keine Träumer.«
Weiße Wolken zogen über den blauen Himmel. Vermutlich eine Illusion, wer wusste das schon. Ihr schien es, als wäre alles nur noch eine Abstraktion, eine billige Kopie der realen Welt. War das schon immer so gewesen? Selbst, wenn sie darüber nachdachte, war sie sich nicht sicher. Der Himmel wirkte farblos, der Wind war kühl, aber geruchlos, die Stimmen der Tausend waren wie aus Boxen eingespielt und die Minzblätter schmeckten nach dem immergleichen Sirupgemisch mit falschen Aromen und Zuckerzusatz.
»Wusstest du, dass meine Oma einen Kräutergarten hatte?«, fragte Kore. Sie schaute Monika in die türkisfarbenen Augen. Selbst ihre Freundin war nicht echt. Witzig. Sie nickte, dennoch erzählte Kore weiter.
»Sie hatte am äußeren Kuppelrand ein kleines Häuschen. Ihre Aufgaben waren die Pflege des Waldes und das Beobachten des künstlichen Biotops. Eigentlich durfte sie daran nichts ändern, dennoch hatte sie sich hinter ihrer Hütte einen kleinen Garten angelegt ...«
»Mit Rosmarin, Zitronenmelisse und Minze. Ja, Kore. Ich weiß das alles.« Monika lachte und rührte ein weiteres Mal in ihrem mittlerweile kalten Kaffee herum. Dann hob sie die Tasse an ihren Mund und trank, während sie den Rührstab umständlich an ihre Wange presste. Unwillkürlich musste Kore an ihrer kratzen. Sie spürte das Brennen und den dünnen Schorf auf ihrer Haut. Ob sie blutete?
Als die Tasse wieder abgestellt wurde, war diese leer.
»Bekommst du eigentlich besseren Kaffee?«, fragte Monika, indem sie zu dem Glas mit Pfefferminztee schielte. »Oder ... Tee ...?«
»Weiß nicht«
»Na ... es ist kein Sirup. Da sind tatsächlich Blätter drin.«
Kore blickte ebenfalls zu ihrem Glas. Ein Päckchen Zucker und Honig lagen daneben, so wie es wohl früher Brauch gewesen war. Aber Kore nutze sie nie. Sie ließ die Minze genau sieben Minuten ziehen, bevor sie den ersten Schluck des heißen aromatisierten Wassers zu sich nahm. Und ab und an, da schmeckte es dann wie bei ihrer Oma. Unbewusst berührte sie ihre Schläfe mit der leicht durchschimmernden Platine, dann strich sie wieder über ihre Wange. Feuchtigkeit. Blutete sie oder weinte sie?
Monika legte den Kopf schief. »Ich kann mir vorstellen, dass sie dir nur das Beste geben. Natürlich. Nicht die Chemie, wie dem Rest.«
Sie schnippte gegen ihre Tasse und blickte angeekelt auf die letzten Tropfen brauner Flüssigkeit.
»Ich habe gelesen, dass sie den Träumern ursprüngliche Erfahrungen verschaffen, damit sie intensivere Erinnerungen haben.« Sie nahm ihr Smartpad heraus und scrollte darauf herum. Ihr Augen waren leer, ihr Interesse versiegt.
Kore schwieg. Letzte Tropfen Tee lagen auf ihrer Lippe. Sie leckte sie herunter und erinnerte sich an die kleine, runzlige Frau mit dem schwarzen Haaren in ihrem Wäldchen.
Ihre Oma hatte natürlich immer die Minzpastillen oder Sirupkapseln im Haus, die sie ihren Gästen hinstellte, ebenso wie eine kleine Schale an frischen Blättern verschiedenster Kräuter. Als Kore noch ein junges Mädchen gewesen war, hatte ihre Oma zu ihr gesagt, dass sie entschied, ob sie Menschen mochte, indem sie diese beim Teetrinken genau beobachtete. Es war entscheidend, ob sie die Teeblätter mit der Zange nahmen und wie lange sie diese ziehen ließen. Zucker? Milch? Eine höfliche Nachfrage konnte jegliche Türen der kulinarischen Teegenüsse öffnen, doch wenn die Behörde von ihrem selbstgeernteten Honig erfahren hätte, wären sie und ihre gesamte Familie in die schwarze Zone verbannt worden. Dort, wo es weder Geschmack noch Geruch gab und die Sensoren nicht zuließen, dass man vergaß, was man einmal hatte.
Kore wollte ihre Oma nie enttäuschen. Sie studierte ihre Gesichtszüge, wenn Gäste nach dem Sirup griffen. Sie lauschte auf jede Veränderung ihrer Stimme, sobald ein Freund die Blätter im heißen Wasser vergaß oder die Nase rümpfte, weil die Natürlichkeit zu scharf für ihn war. Sie ahmte jede ihrer Handgriffe genausten nach und genoss jeden Schluck des selbstgefertigten Getränks. Ohne Zucker, ohne Honig, ohne Milch. Nur heißes Wasser und Blätter, ab und zu vielleicht getrocknete Früchte dazu. Nicht mehr, nicht weniger.
»Also ... in dem Moment, wo du den Laden betrittst und du gescannt wirst, erhält der Bot die Information, dass du eine Träumerin bist. Jedenfalls steht das so in diesem Artikel.« Monika starrte weiterhin auf ihr Smartpad und beobachte die tausend Zeichen. »Je nach Kategorie bekommt der Träumer dann eine entsprechende Mahlzeit. Dabei ist die Nachfrage entscheidend. Wenn die Obrigkeit eher Lust auf romantische Träume hat, bekommen eben jene Träumer besseres Essen. Die Massenträumer dagegen erhalten nur die B-Ware.« Monika senkte ihr Pad und schaute Kore direkt in die Augen. Auf ihrer sonst glatten Stirn bildeten sich Falten. Kurz schielte sie zu dem Glas mit Tee, dann wieder zu Kore. Ein Kopfschütteln folgte.
»Sind Alpträume so beliebt?«, fragte sie. Sie schien an ihren eigenen Worten zu zweifeln, während sie sie aussprach. Kore zuckte mit den Schultern. Sie hatte auf den ganzen Scheiß nie wirklich geachtet. Es hatte sie nie interessiert. Ihre Produktionen gingen schnell weg, füllten ihr Konto und die Erwartungen der Behörden. Es gab keine Beschwerden, keine Unstimmigkeiten. Sie funktionierte und das zählte.
»Irgendwie absurd!«, meinte Monika, schüttelte erneut den Kopf und packte ihr Pad wieder in die Jackentasche. Sie drückte auf ihre Platine, ihr Blick wurde klar.
»Also ... ich kann mir eh nur einen Traum alle drei Monate leisten und meistens sind das ...« Sie errötete kurz, dann winkte sie ab. »Nicht so wichtig. Geht ja auch nicht um den Mainstream, sondern um diese reichen Schnösel, die ihre Gehirnaktivitäten nicht in der Nacht verkaufen müssen. Die haben Geld für alles, weißt du, und in ihren Träumen wollen sie Dinge erleben und deine Kunden wollen ...« In ihren Augen glühte Sensationslust und Neugierde. Sie leckte sich über die Lippen, dann kratzte sie sich am Kopf. Kore schwieg. Sie redete nicht über ihre Produktionen und schon gar nicht darüber, dass diese mittlerweile so präsent waren, dass sie ihren Verstand auch am Tage einholten. Es fiel ihr immer schwerer, wieder aufzuwachen. Aber das waren normale Begleiterscheinungen. Irgendwann würde ihr Hirn einfach aufgeben und weder die Medikamente noch die Drogen würden es verhindern können. Hat irgendwas mit den Neuronen zu tun, dass das Gehirn bald nicht mehr Traum und Wirklichkeit unterscheiden kann.
Monikas Platine begann zu pulsieren, leuchtete rot, dann grün und sie erhob sich.
»Egal«, sagte sie, während sie ihre Tasche über die Schulter hängte. »Am Ende gewinnt die Nachfrage. Wäre es nicht toll, wenn alle Menschen träumen könnten, unabhängig von ihren Credits? Wirklich jeder könnte die Minze deiner Oma schmecken.« Sie drehte sich um und ging. Kore blieb sitzen und starrte ihren Tee an. Es roch nach Wald, Moos und wilden Kräutern.
Sobald man zwanzig Jahre alt ist, werden die Gehirnkapazitäten in verschiedensten Situationen gemessen, die Platine angepasst und neurale Veränderungen vorgenommen. Welche das waren, wusste Kore nicht. Sie glaubte auch nicht, dass der allgemeinen Gesellschaft, dem Mainstream verraten wurde, was da eigentlich mit einem passierte. Anhand der Tests wurde dann entschieden, welche Aufgabe dem Gehirn zugeordnet oder ob man in die schwarze Zone abgeschoben wurde. Die meisten Menschen bekamen nicht mit, wie ihre Gehirnleistungen während ihrer Schlafphasen angezapft und die Maschinen dadurch gesteuert oder einzelne Programme geschrieben wurden. Alles funktionierte vollautomatisch. Die Rechenkraft jeder Kuppel war abhängig von ihren Bewohnern. Jedoch forderte diese Prozedur ihren Tribut. Sie raubte den Menschen ihre Träume. Und damit die Emotion, die Fantasie, die nächtliche Unterhaltung.
Kore war eine Träumerin. Ihre Erinnerungen und Gedanken in den Schlafphasen waren so intensiv, dass eine Aufzeichnung und Weiterleitung zu anderen, schlafenden Gehirnen möglich war. So konnten die Käufer diese Bilder bewusst miterleben. Das war durchaus ein Segen und ein Fluch zugleich.
»Ein Träumer wird nur selten älter als fünfunddreißig Jahre!«, sagte Oma, während sie den pfeifenden Messingkessel vom Herd nahm. Sie goss das dampfende Wasser in zwei Tonkrüge und schob einen davon Kore entgegen. Diese schloss die Hände um das Gefäß, zog es näher an sich heran und starte hinein.
»Hab ich eine Wahl?«, fragte sie. Sie roch Minze.
»Nein. Das hat man nie.«
Oma stellte den Kessel zurück auf den Herd und setzte sich Kore gegenüber. Ihre Gesichtszüge waren jünger, als in ihrer Erinnerung, ihre Augen weich. Dennoch schmerzten ihre Worte wie ein heißes Messer im Herzen, dass sich tiefer und tiefer bohrte.
Die kleine Hütte war mit Kräutern und Gewürzen behangen. Irgendwas trocknete immer irgendwo. Sie war aus dunklem Holz gebaut, altmodisch ohne technischen Schnickschnack.
Oma war eine Bewahrerin – so nannte sie sich. Sie hatte die ganze Technik satt und bot der Behörde an, dass sie sich um die künstliche Natur innerhalb der Kuppeln kümmern würde. Es gab Auflagen, aber sie waren froh, wenn sich jemand zu dieser einsamen und schweren Arbeit bereit erklärte. Zwei Fliegen mit einer Klappe: Sie wurden eine Unruhestifterin los und die wuchernden Wälder blieben nicht unbeaufsichtigt. Oma war jedoch die Einzige, die darauf bestand, in eben einen solchen Wald eine Hütte zu bauen.
Kore griff zu der kleinen, metallenen Zange und anschließend zu der Schale mit Pfefferminz.
»Man gießt die Blätter auf, nicht wahr?«, fragte Oma. Kore zögerte. Sie spürte ihr Herz bis zum Hals schlagen. Wasser auf Blätter, Blätter auf Wasser. Wie war es richtig? Sie ... sie wusste es nicht. Ihre Hand verharrte in der Bewegung, in der sie das Blatt mit der kleinen Zange in das heiße Wasser drückte. Irgendwie war das falsch, dachte sie. Aber es fühlte sich richtig an. Ihr Körper zitterte.
Wie konnte es sein, dass sie das vergessen hatte.
»Sei mir nicht böse, Oma!«, flüsterte sie. Kore konnte sich nicht bewegen, geschweige in die strengen Augen der alten, kleinen Frau schauen. Ihr Herz schlug schnell, die Welt begann sich zu drehen.
Oma lachte. Kore blickte auf, die Frau blickte zurück.
»Was hab’ ich falsch gemacht?«, fragte sie.
»Noch nichts!«, antwortete Oma, dann winkte sie ab. Ihre knochige Hand legte sich auf Kores linke. Sie atmete aus.
»Kennst du die Geschichte der verlorenen Uhr?«, fragte Oma. Sie nahm ihrer Enkelin die metallene Zange aus der Hand und legte sie beiseite.
»Man sagt, dass sie Seelen einfängt und diese den Augenblick ihres Todes immer wieder erleben lässt.«
»Eine Geistergeschichte.«
»So ähnlich«, sagte sie. »Nur wahrer. Nicht nur bloße Worte eines düsteren Autors auf Opium. Es ist eine Geschichte, die bereits erzählt wurde. Unvergleichlich mit der unseren.«
»Warum erzählst du mir das dann?«, fragte Kore. Alles roch nach Minze, der ganze Raum dehnte sich unter der Last des Tees. Sie hob den Krug an ihre Lippen, doch das darin enthaltene Wasser war längst kalt und schmeckte nicht.
»Dieses Ding, liebe Kore, ist eine verlorene Uhr!« Oma tippte sich an die Schläfe. Die Platine leuchtete rot auf, Kore runzelte die Stirn, während sie einen weiteren Schluck vom Nicht-Pfefferminztee nahm. Sie stellte den Krug zurück auf den Tisch und hielt die Hände darum geschlossen, als könnte sie sich an dem erkalteten Wasser wärmen.
»Weißt du, wie sie dir deine Träume stehlen?« Oma blickte ihr direkt in die Augen und wartete auf eine Antwort, doch Kore zuckte nur mit den Schultern. »Sie stehlen sie mir nicht, Oma. Ich bekomme dafür Geld!«
»Hattest du eine Wahl?«
Kore klimperte mit ihren Fingernägeln gegen den kleinen Krug in ihren Händen. Niemand konnte selbst entscheiden, was aus seinem Gehirn wurde. Man hoffte nur darauf, dass es für Credits und Privilegien ausreichte.
Oma ging zurück an den Herd und füllte die Messingkanne mit frischem Wasser und setzte ihn auf. »Hattest du eine Wahl?«, fragte sie ein weiteres Mal und nahm Kore den Krug aus den Händen, um den Inhalt mitsamt Minzblatt in einen Lavendeltopf zu kippen. Sie drehte sich zum Küchentisch, griff beiläufig nach der Zange und zupfte neue Pfefferminze und Zitronenmelisse aus der Schüssel. Sie schob ein paar davon in den Krug und stellte diesen vor Kore. Diese schüttelte den Kopf.
Der Kessel pfiff. Oma nahm ihn vom Herd und goss Wasser auf die frischen Blätter. Dann reichte sie Kore einen kleinen Rührstab.
»Du träumst die Träume von anderen, Kore. Abartige, böse Träume. Sie infizieren deinen Verstand und kriechen in dein Bewusstsein. Sie verschieben deine Wahrnehmung.«
Die Hütte schien klein und bedrückend; ihre Oma dagegen groß und gewaltig. Ihre Haut strahlte jung, ihre Augen blickten bedauernd.
»Dein Weg endet, meine Liebe. Probiere den Tee!«
»Aber ... er hat noch nicht lang genug ...«
»Probiere den Tee!« Oma schlug mit der Hand auf den Tisch und das gesamte Haus wackelte. Kore zuckte zusammen, dann nahm sie einen Schluck und schmeckte nichts. Sie leckte sich über die Lippen und schmeckte nichts. Ihre Finger kribbelten. Sie ließ den Krug fallen, doch er kam nie auf dem Boden an.
»Deine Erinnerungen verblassen!«
»Wer bist du?«, fragte Kore die Frau, die vor ihr stand und sie anblickte. Sie hatte schwarze, lange Haare, die zu einem Dutt zusammengebunden waren, eingefallene Augen und trug ein weißes Top.
Die Frau, die nicht ihre Oma war und auch nicht Monika oder irgendwer, den sie kannte, begann zu lachen. Sie trug eine Platine. Ihre Oma hatte sich dieser verweigert. Es konnte nicht Oma sein. Sie atmete schwer, laut. Ein Ticken begleitete sie. Kore schrie, bevor sie aufsprang. Auch der umstürzende Stuhl erreichte nie den Boden.
Der Raum begann zu flackern und Kore verstand.
»Verfluchte Scheiße!«
»Du hast es nicht gewusst!«, sagte die Frau. Ihre Stimme verzerrte sich zu einem mechanischen Ton.
Kore fuhr herum und wollte zur Tür flüchten, doch sie fand keine.
»Du verstehst es nicht!«
Sie schlug mit den Fäusten gegen das alte Holz. Splitter gruben sich in ihre Haut, doch ihre Schläge machten keine Geräusche. Sie drehte sich um, suchte nach einer anderen Fluchtmöglichkeit und rannte zu einem Fenster, dessen dreckiges Glas keinerlei Blick nach draußen ermöglichte. War sie wirklich im Wald? Nein ... war sie nicht. Konnte sie nicht. Sie war in einem Traum gefangen, irgendwo in den Tiefen der Platine. Wer war diese Frau?
Panisch griff sie nach der Messingkanne und schlug damit gegen das Fenster. Nichts. Nur ein kleiner Riss, nur ein dünner Faden, der sich durch die Scheibe zog. Es knackte. Endlich ein Geräusch. Der Riss wurde größer, zog sich über das Fenster hinauf bis zum Rahmen, brach sich hinaus in die Welt und explodierte in einem Meer aus Scherben. Kore zog die Arme nach oben und versuchte, ihr Gesicht zu schützen. Glas bohrte sich in ihre Wange und hinterließ den brennen Schmerz, den sie eigentlich vergessen glaubte.
Es war ihr egal. Sie konnte von diesem Ort fliehen. Sie ignorierte das Blut, das ihr den Hals hinab lief und das Lachen dieser merkwürdigen Frau, deren Glieder immer länger wurden und nach ihr griffen. Raus! Einfach weg!
Sie kroch über die Anrichte, zog sich zum Rahmen. Spitzes Glas schnitt in ihre Hände und in ihre Beine, doch die frische Luft, die aus dem kaputten Fenster wehte, motivierte sie.
»Du verstehst es nicht!«, rief ihr die Frau hinterher. Kore kletterte hinaus, ließ sich auf den Waldboden fallen und blieb wie angewurzelt stehen. Kein Wind, kein Waldgeruch, keine raschelnden Blätter. Nichts. Vor ihr war eine große Schwärze.
»Hast du eine Wahl? Du verstehst es nicht!«
Die verzerrte Frauenstimme war in ihrem Kopf. Nicht neben ihr, nicht hinter ihr. Als würde sie über Kopfhörer mit ihr reden, als wären es ihre Gedanken. Sie drückte die Hände an ihre Ohren und schrie, aber sie erinnere sich nicht mehr an den Ton ihrer eigenen Schreie.
Dann rannte sie los. Einfach weg. Das Pochen in ihrer Wange wurde schmerzhafter, doch sie musste es ignorieren. Sie musste aufwachen. Das war ein Traum. Aber das konnte nicht sein. Sie hatte ihre Träume unter Kontrolle! Sie war noch nicht so weit, den Verstand zu verlieren.
Es knackte mechanisch, das Ticken einer Uhr schlich sich in ihr Gehirn, als wäre es schon immer da gewesen.
Dann blieb sie stehen. Im Nichts. In der Leere. Die Platine an ihrer Schläfe strahlte ein grünes Licht aus. Es piepste, es tickte, es brannte. Verkauft ... Ihre letzte Erinnerung.
Dann wachte sie auf.
Sie blickte an die weiße Decke ihrer Wohnung. Die Platine pochte. Sie blinkte Gelb. Kore blinzelte, als sie das Licht berührte. Dann strich sie sich über ihre Wange. Nichts. Kein Schmerz, keine Wunde.
Langsam richtete sie sich auf. Die Welt begann sich zu drehen. Fahrig öffnete sie die Schublade eines kleinen Nachttischschränkchens, das neben ihrem Bett stand. Eine Tube lag darin. Fast leer.
Kore leckte sich über die Lippen.
»Guten Morgen, Monika«, sagte sie in den kleinen Raum hinein.
»Guten Morgen, Kore. Wie kann ich dir helfen?«
Die Stimme der KI fühlte sich gut an, vertraut. Kore lächelte. »Order zweiundvierzig und spiele Szenario 3-4-1 ab.«
Der Raum um sie herum verschwamm. Die Platine begann zu blinken und leuchtete grün. Bevor sich Kore zurücklehnte, drückte sie ein wenig Paste aus der Tube und rieb diese auf die Innenseite ihrer Wange. Es schmeckte nach Pfefferminz. Morgen würde eine neue Tube vor ihrer Haustür liegen.
Dann schloss sie wieder die Augen und träumte.
»Du siehst müde aus!«, sagte Monika, während sie mit einem Glasstäbchen in ihrer Tasse herumrührte. Kaffee, Milch und die drei Krümel Zucker hatten längst eine Einheit gebildet, die in einem kleinen Strudel herumwirbelte.
Till und Aria
Vincent Voss
»Verdammt, Till!« Sie stößt ihn von sich und versucht zu retten, was zu retten ist, nachdem er sich in ihr ergossen hat.
»Ich …, scheiße …, ich …«, stammelt er.
»Du wolltest aufpassen, du Idiot!«
–
»So eine Scheiße!«, flucht sie, aus dem Anbau der Garage, die sie als Unterschlupf für die letzten paar Tage auf ihrem Weg nach Norden an die Küste genutzt haben. »Und wir haben kein Wasser dafür! Du verdammter Idiot«, hört er sie und sieht sich um, ob er irgendwie helfen kann. Kann er nicht. Sie haben kein Wasser, weil es kein Wasser gibt. Ein Tuch vielleicht, aber er hört bereits, wie Aria Stoff zerreißt. Er steht auf, sieht ihr zu, wie sie versucht, sich im flackernden Kerzenlicht den Intimbereich zu säubern.
»Geh und sieh woanders hin!«, verscheucht sie ihn und saugt so viel Sperma wie möglich mit dem Lappen auf. Abgewandt verweilt er im Eingang, der nur durch einen Plastikvorhang beide Räume trennt.
»Es tut mir leid. Wirklich!« Sie hebt den Blick, er sieht immer noch weg. Aria schüttelt den Kopf. Letztlich muss sie ihm verzeihen, eine andere Option gibt es nicht, wenn sie überleben wollen.
Am nächsten Tag ziehen sie weiter. Aria wird von einer inneren Unruhe gepackt. Eigentlich hatten sie noch ein paar Tage in der Nähe von Handorf südlich der Elbe bleiben wollen, um dann die Elbe über die 404 zu überqueren. Hamburg planten sie im Osten zu umgehen, große Städte sind gefährlich. Alphas, Betas und Plünderer stritten sich um Wasser und Nahrung. Aber in der Nähe von und in Hamburg hatte sich damals 23/24 der Widerstand aufgebaut, und sie und Till haben gehört, dass es in Dänemark noch eine sichere Enklave für Menschen geben soll. Arias zweite Flucht. 2015 war sie mit ihrer Mutter aus Afghanistan nach Deutschland gekommen. Ihr Vater und einer ihrer Drillingsbrüder waren im Mittelmeer ertrunken. Nach knapp einem Jahr Aufenthalt in der Landesunterkunft Rendsburg sind sie dann endlich nach Henstedt-Ulzburg umverteilt worden. Dorthin wollen sie jetzt erst einmal, weil sie sich da auskennt und Ideen hat, wo es noch Nahrung und Wasser geben könnte. Und Ruhe, denn die haben sie bitter nötig.
In der Dämmerung erreichen sie die Elbbrücke Geesthacht. Sie hatten lange gestritten, wo und wie sie die Elbe überqueren wollen, und sich schließlich für die Brücke entschieden. Erst einmal wollen sie die Lage auskundschaften. Es ist Mitte Juni, also bleibt es lange hell. Ob das ein Vor- oder Nachteil ist, wissen sie nicht. Für die Alphas vielleicht ein Vorteil, weil sie wie Menschen sehen. Die Betas nehmen anders wahr, da sind sich Till und Aria sicher. Eher über den Geruch. Sie scheinen Menschen besonders gut riechen zu können, allerdings stinken sie selbst bestialisch nach Pilzen und moderndem Fisch und kündigen sich damit schon lange vor ihrem Erscheinen an. Neben der Brücke in Marschacht finden sie einen ehemaligen Hof. Hinter einem Lkw spannen sie eine Plane auf, tarnen sie mit Ästen und Zweigen, verstecken sich und spähen auf die Brücke. Sie wollen sehen, ob sie von Gangs bewacht würde oder ob die Infiltrierten sie nutzen.
Es fängt an zu nieseln, sie ziehen sich ihre Regenjacken an, aber es bleibt ruhig, bis es dunkel wird. Sie warten den Guss ab. Mit dem Regen war damals die Veränderung gekommen. Phase I der weltweiten Infiltration, die Menschen in Alphas verwandelt hatte. Was auch immer der Regen mit sich trägt, sie müssen sich davor schützen. Nach Mitternacht hört es auf, die Wolken verziehen sich am Himmel.
»Wollen wir?«, fragt sie ihn leise. »Oder wir warten bis morgen?« Sie lauscht in sich hinein.
»Nein, ich will weiter.«
»Dann gehen wir.«
Er späht ein weites Mal mit dem Fernglas nach Gefahren, dann stehen sie auf. Alles wirkt friedlich. Sie gehen die Böschung hinauf und dann das kurze Stück Straße bis zum Beginn der Brücke. Der Mond scheint zu dreiviertel und schärft die Konturen der verwaisten Fahrzeuge. Nur das Rauschen der Elbe ist zu hören und ihre leisen Schritte auf dem Asphalt. Bei einiges Autos stehen die Türen offen. Sie sehen kurz nach Wasser oder Essbaren, aber sie finden nichts. Bei einem Taxi steckt der Schlüssel. Sie könnten einsteigen und losfahren, aber das Geräusch eines Autos würde kilometerweit zu hören sein und sie anlocken. Alle anlocken. Wer überleben will, geht zu Fuß. Nachdem sie die Hälfte der Brücke, knapp 100 Meter, überquert haben, verharrt Aria. Sie hört etwas. Hinter ihnen. Sie finden Deckung hinter einem Wagen und spähen nach dem Geräusch. Sie können es nicht einordnen, bis Till etwas erkennet.
»Rehe!« Sie jagen im Sprint auf die Brücke, ihre Hufe schlagen auf den Asphalt und hallen nach. Vier, fünf Tiere, ein Kitz ist dabei. Die Tiere halten auf sie zu, und ohne viel über sie zu wissen, erkennen Till und Aria, dass die Rehe in panischer Angst fliehen. Ein kurzer Blick zwischen beiden reicht. Sie laufen los, die Rehe hinter ihnen her und dahinter … Gefahr! Sie hören hinter sich die Tiere schnaufen und ihre Hufe immer lauter auf den Brückenboden schlagen. Sie überholen Aria und Till, Aria glaubt kurz, ihre Wärme spüren zu können. Sie dreht sich um, kann sie sehen und nun auch riechen. Betas! Sie rennen auf die Brücke. Und jetzt schreien sie. Jagdschreie. Wer einmal vor Betas fliehen musste, erschauert. Wer hört, wie sie einen lebendigen Menschen zerreißen und fressen, wird davon in seinen Träumen verfolgt.
»Lauf!«, ruft Till. Er ist etwas schneller als sie, aber er wartet, bleibt auf gleicher Höhe, sieht sich immer wieder um.
»Wir müssen ein Auto nehmen!«
»Nein!«, sagt sie, sieht sich ebenfalls um, entscheidet sich dann für ein Auto. Ein Dutzend Betas. Ausgehungerte Betas. Sie haben keine Chance zu entkommen.
»Wie?« fragt sie. Zurück zum Taxi können sie nicht mehr, aber es ist nicht sicher, ob in einem anderen Fahrzeug ein Schlüssel stecken würde. Aria hatte die Deutschen gut genug kennengelernt, um zu wissen, dass ihnen Autos heilig waren.
»Wir haben nur einen Versuch«, keucht sie, ihr Blick huscht von einem Fahrzeug zum anderen. Wie sollen sie im Laufen und bei der Dunkelheit erkennen, ob ein Schlüssel steckt? Sie sieht, dass Till nickt, im Zickzack von Auto zu Auto kreuzt. Die Betas knurren wie Raubtiere, schreien, einige haben primitive Waffen wie Eisenstangen und Knüppel dabei und schlagen damit auf die Karosserien.
Das Rehkitz ist in Sicherheit, denkt Aria und ist von dem Gedanken überrascht. Till zieht seinen Revolver. Jetzt ist es eh zu spät, leise zu sein. Aria läuft an ihm vorbei von Auto zu Auto, zuckt zusammen, als sie den ersten Schuss hört.
»Kommt schon, ihr scheiß Deutschen! Lasst doch mal den Schlüssel stecken«, flucht sie, hetzt von Tür zu Tür und verharrt wie vom Blitz getroffen bei einem roten Wagen. Die Tür ist verschlossen, aber der Schlüssel steckt. Auf der Rückbank sitzen zwei Skelette. Kleine Skelette und eines hält zusammengesunken ein Kuscheltier in den Händen. Einen Pinguin.
Aria schluckt, zögert aber nicht. Mit dem Knauf ihres Revolvers schlägt sie die Fahrerscheibe ein, zwängt sich auf den Sitz, schickt mit geschlossenen Augen ein Stoßgebet gen Himmel und dreht den Schlüssel. Der Motor startet. Sie weiß nicht, wie sie die Kindersicherung entriegelt, also lässt sie die Scheibe auf dem Beifahrersitz hinunter.
»Komm schon!«, ruft sie zu Till. Ihre Stimme überschlägt sich. Wieder fällt ein Schuss. Sie lenkt den Wagen auf die Mitte der Fahrbahn, lässt ihn langsam im ersten Gang kommen, dreht sich um, sucht Till. Sie sieht ihn einige Meter hinter sich laufen, die Betas haben aufgeholt.
»Verdammt, sind die schnell!« Aria lenkt jetzt mit der Linken, fischt mit der rechten Hand nach ihrem Revolver und zielt zwischen den Kinderskeletten durch das Heckfenster auf die Konturen der Infiltrierten. Till schießt wieder, einer der Betas wird zurückgeworfen, fängt sich, rudert mit den Armen, läuft weiter mitten in eine offenstehende Tür hinein. Einer weniger. Weniger von wie vielen? Zwölf, dreizehn?
»Till!« Sie kreischt. Aria hasst es, wenn sie so ist. So panisch. Sie beschleunigt den Wagen, er soll merken, dass sie keine Zeit haben.
»Ja!«, ruft er zurück, sprintet dem Auto nach, greift an den Türgriff, will die Tür öffnen, aber sie bleibt verschlossen.
»Kindersicherung!« Was für ein deutsches Wort, denkt Aria, als sie es sich erklären hört. Till versucht hineinzuspringen, aber mit seinem Rucksack passt er nicht durch die Öffnung.
»Schmeiß ihn weg!« Natürlich schmeißt er ihn nicht weg, läuft und nimmt den Rucksack vom Rücken, wirft ihn in den Wagen. Die Betas sind dicht hinter ihm. Aria schießt. Immer noch schließen sich ihre Augen dabei für einen Moment. Als sie sie nach einer Zehntelsekunde wieder öffnet, hat das eine Skelett, das mit dem Pinguin, keinen Kopf mehr. Till ist zur Hälfte drin, versucht, sich auf den Beifahrersitz zu zwängen. Sie drückt auf das Gaspedal und hat das Gefühl, dass sie gerade noch so einmal entkommen sind. Kurz hinter der Brücke auf der Straße nach Geesthacht sieht sie mehrere Augen das Scheinwerferlicht reflektieren. Die Rehe verharren kurz und fliehen dann in das Dickicht. Aria lacht und weint zugleich.
In Geesthacht hören sie das typische Knistern der Alphas. Als würde man bei Regen unter Hochspannungsleitungen stehen. Und dann sehen sie sie. Alphas stehen nur herum oder wandern orientierungslos umher. Till glaubt, dass sie geerntet werden. Von Außerirdischen. Aria weiß nicht, was sie glauben soll. Sie schleichen durch die Altstadt, den Wagen haben sie nach ein paar Kilometern stehen lassen. Dort beobachten sie die Alphas, versuchen, ihre Lage einzuschätzen.
Sie sind müde, irgendwo bellen Hunde, also betreten sie eine Altstadtvilla. Im Treppenhaus lauschen sie nach verdächtigen Geräuschen, hören aber nichts. Till deutet nach oben, er glaubt, dass die Häuser im Dachgeschoss miteinander verbunden sind, macht eine Geste. Sie nickt, aber ihnen ist unheimlich, als sie sich im ersten Stock durch dichte Gespinste von Spinnweben kämpfen müssen. Dicke Fäden.