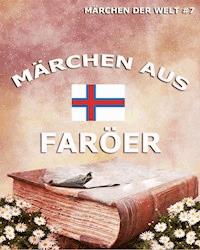
Märchen aus Faröer E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Erleben Sie die Märchen und Sagen aus aller Welt in dieser Serie "Märchen der Welt". Von den Ländern Europas über die Kontinente bis zu vergangenen Kulturen und noch heute existierenden Völkern: "Märchen der Welt" bietet Ihnen stundenlange Abwechslung. Ein Auszug aus dem Inhaltsverzeichnis dieses Buches: Zwerge. Huldervolk. Die Wichteln und die weise Marjun in Öravík. Die Mahre. Der Niagrís und der Loddasastein1 Das Loch der Riesin in Sandoy und die Trollweiber am Fjallavatn in Vágar. Der Neck. Das Meermännlein und der Bauer Anfinn in Elduvík. Der Seedraug. Die Meerfrau. Seekühe und Hulderkühe. Dulurin. Der Gásadalsmann im Hulderboot. Das Hulderweib in Kindsnöten. Auf dem Kreuzweg sitzen. Der Siegstein. Der Riese und die Alte. Das Seehundweibchen. Óli der Starke und Tór der Starke. Wälder auf den Föroyern. Svínoy. Mikines. Das Eiriksriff. Die Schaukelsteine. Tröllanes. Noas Arche. Die Raubschärler. Orm, der Bauer auf Skáli. Die Hausfrau in Húsavík. Fámjin. Die Haube. Die Schlacht im Mannafellsdal. Der Kormoran und der Eidervogel. Narrensagen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 107
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Märchen der Färöer-Inseln
Inhalt:
Geschichte des Märchens
Märchen der Färöer-Inseln
Zwerge.
Huldervolk.
Die Wichteln und die weise Marjun in Örđavík.
Die Mahre.
Der Niđagrís und der Loddasastein.
Das Loch der Riesin in Sandoy und die Trollweiber am Fjallavatn in Vágar.
Der Neck.
Das Meermännlein und der Bauer Anfinn in Elduvík.
Der Seedraug.
Die Meerfrau.
Seekühe und Hulderkühe.
Dulurin.
Der Gásadalsmann im Hulderboot.
Das Hulderweib in Kindsnöten.
Auf dem Kreuzweg sitzen.
Der Siegstein.
Der Riese und die Alte.
Das Seehundweibchen.
Óli der Starke und Tór der Starke.
Wälder auf den Föroyern.
Svínoy.
Mikines.
Das Eiriksriff.
Die Schaukelsteine.
Tröllanes.
Noas Arche.
Die Raubschärler.
Orm, der Bauer auf Skáli.
Die Hausfrau in Húsavík.
Fámjin.
Die Haube.
Die Schlacht im Mannafellsdal.
Der Kormoran und der Eidervogel.
Narrensagen.
Anmerkungen.
Märchen aus Faröer
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
www.jazzybee-verlag.de
Frontcover: © Sweet Angel - Fotolia.com
Geschichte des Märchens
Ein Märchenist diejenige Art der erzählenden Dichtung, in der sich die Überlebnisse des mythologischen Denkens in einer der Bewußtseinsstufe des Kindes angepaßten Form erhalten haben. Wenn die primitiven Vorstellungen des Dämonenglaubens und des Naturmythus einer gereiftern Anschauung haben weichen müssen, kann sich doch das menschliche Gemüt noch nicht ganz von ihnen trennen; der alte Glaube ist erloschen, aber er übt doch noch eine starke ästhetische Gefühlswirkung aus. Sie wird ausgekostet von dem erwachsenen Erzähler, der sich mit Bewußtsein in das Dunkel phantastischer Vorstellungen zurückversetzt und sich, vielfach anknüpfend an altüberlieferte Mythen, an launenhafter Übertreibung des Wunderbaren ergötzt. So ist das Volksmärchen (und dieses ist das echte und eigentliche M.) das Produkt einer bestimmten Bewußtseinsstufe, das sich anlehnt an den Mythus und von Erwachsenen für das Kindergemüt mit übertreibender Betonung des Wunderbaren gepflegt und fortgebildet wird. Es ist dabei, wie in seinem Ursprung, so in seiner Weiterbildung durchaus ein Erzeugnis des Gesamtbewußtseins und ist nicht auf einzelne Schöpfer zurückzuführen: das M. gehört dem großen Kreis einer Volksgemeinschaft an, pflanzt sich von Mund zu Munde fort, wandert auch von Volk zu Volk und erfährt dabei mannigfache Veränderungen; aber es entspringt niemals der individuellen Erfindungskraft eines Einzelnen. Dies ist dagegen der Fall bei dem Kunstmärchen, das sich aber auch zumeist eben wegen dieses Ursprungs sowohl in den konkreten Zügen der Darstellung als auch durch allerlei abstrakte Nebengedanken nicht vorteilhaft von dem Volksmärchen unterscheidet. Das Wort M. stammt von dem altdeutschen maere, das zuerst die gewöhnlichste Benennung für erzählende Poesien überhaupt war, während der Begriff unsers Märchens im Mittelalter gewöhnlich mit dem Ausdruck spel bezeichnet wurde. Als die Heimat der M. kann man den Orient ansehen; Volkscharakter und Lebensweise der Völker im Osten bringen es mit sich, daß das M. bei ihnen noch heute besonders gepflegt wird. Irrtümlich hat man lange gemeint, ins Abendland sei das M. erst durch die Kreuzzüge gelangt; vielmehr treffen wir Spuren von ihm im Okzident in weit früherer Zeit. Das klassische Altertum besaß, was sich bei dem mythologischen Ursprung des Märchens von selbst versteht, Anklänge an das M. in Hülle und Fülle, aber noch nicht das M. selbst als Kunstgattung. Dagegen taucht in der Zeit des Neuplatonismus, der als ein Übergang des antiken Bewußtseins zur Romantik bezeichnet werden kann, eine Dichtung des Altertums auf, die technisch ein M. genannt werden kann, die reizvolle Episode von »Amor und Psyche« in Apulejus' »Goldenem Esel«. Gleicherweise hat sich auch an die deutsche Heldensage frühzeitig das M. angeschlossen. Gesammelt begegnen uns M. am frühesten in den »Tredeci piacevoli notti« des Straparola (Vened. 1550), im »Pentamerone« des Giambattista Basile (gest. um 1637 in Neapel), in den »Gesta Romanorum« (Mitte des 14. Jahrh.) etc. In Frankreich beginnen die eigentlichen Märchensammlungen erst zu Ende des 17. Jahrh.; Perrault eröffnete sie mit den als echte Volksmärchen zu betrachtenden »Contes de ma mère l'Oye«; 1704 folgte Gallands gute Übersetzung von »Tausendundeiner Nacht« (s. d.), jener berühmten, in der Mitte des 16. Jahrh. im Orient zusammengestellten Sammlung arabischer M. Besondern Märchenreichtum haben England, Schottland und Irland aufzuweisen, vorzüglich die dortigen Nachkommen der keltischen Urbewohner. Die M. der skandinavischen Reiche zeigen nahe Verwandtschaft mit den deutschen. Reiche Fülle von M. findet sich bei den Slawen. In Deutschland treten Sammlungen von M. seit der Mitte des 18. Jahrh. auf. Die »Volksmärchen« von Musäus (1782) und Benedikte Naubert sind allerdings nur novellistisch und romantisch verarbeitete Volkssagen. Die erste wahrhaft bedeutende, in Darstellung und Fassung vollkommen echte Sammlung deutscher M. sind die »Kinder- und Hausmärchen« der Brüder Grimm (zuerst 1812–13, 2 Bde.; ein 3. Band, 1822, enthält literarische Nachweise bezüglich der M.). Unter den sonstigen deutschen Sammlungen steht der Grimmschen am nächsten die von L. Bechstein (zuerst 1845); außerdem sind als die bessern zu nennen: die von E. M. Arndt (1818), Löhr (1818), J. W. Wolf (1845 u. 1851), Zingerle (1852–54), E. Meier (1852), H. Pröhle (1853) u. a. Mit M. des Auslandes machten uns durch Übertragungen bekannt: die Brüder Grimm (Irland, 1826), Graf Mailath (Ungarn, 1825), Vogl (Slawonien, 1837), Schott (Walachei, 1845), Asbjörnson (Norwegen), Bade (Bretagne, 1847), Iken (Persien, 1847), Gaal (Ungarn, 1858), Schleicher (Litauen, 1857), Waldau (Böhmen, 1860), Hahn (Griechenland u. Albanien, 1863), Schneller (Welschtirol, 1867), Kreutzwald (Esthland, 1869), Wenzig (Westslawen, 1869), Knortz (Indianermärchen, 1870, 1879, 1887), Gonzenbach (Sizilien, 1870), Österley (Orient, 1873), Carmen Sylva (Rumänien, 1882), Leskien und Brugman (Litauen, 1882), Goldschmidt (Rußland, 1882), Veckenstedt (Litauen, 1883), Krauß (Südslawen, 1883–84), Brauns (Japan, 1884), Poestion (Island, 1884; Lappland, 1885), Schreck (Finnland, 1887), Chalatanz (Armenien, 1887), Jannsen (Esthen, 1888), Mitsotakis (Griechenland, 1889), Kallas (Esthen, 1900) u. a. Unter den Kunstpoeten haben sich im M. mit dem meisten Glück versucht: Goethe, L. Tieck, Chamisso, E. T. A. Hoffmann, Fouqué, Kl. Brentano, der Däne Andersen, R. Leander (Volkmann) u. a. Vgl. Maaß, Das deutsche M. (Hamb. 1887); Pauls »Grundriß der germanischen Philologie«, 2. Bd., 1. Abt. (2. Aufl., Straßb. 1901); Benfey, Kleinere Schriften zu Märchen-forschung (Berl. 1890); Reinh. Köhler, Aufsätze über M. und Volkslieder (das. 1894) und Kleine Schriften, Bd. 1: Zur Märchenforschung (hrsg. von Bolte, das. 1898); R. Petsch, Formelhafte Schlüsse im Volksmärchen (das. 1900).
Märchen der Färöer-Inseln
Zwerge.
Die Zwerge sind klein und dick, bartlos, aber doch nicht hässlich von Aussehen. Sie hausen in grossen Steinen oder in Hügeln unter Blöcken; solche Zwergensteine findet man weit und breit auf den Inseln. Die Zwerge sind gutmütig, aber dulden keine Zänkereien in der Nähe ihrer Wohnungen; da werden sie böse und fahren im Zorne von hinnen; deshalb steht der grosse Zwergenstein in Skúvoy zerspalten, weil zwei Burschen, welche einmal dort standen, fluchten und sich rauften; da flohen die Zwerge und spalteten den Stein. Die Zwerge sind die besten Schmiede; von ihnen lernten die Menschen zuerst den Stahl im Wasser härten; früher dehnten sie das Eisen aus und schmiedeten es, indem sie es mit dem Hammer kalt schlugen. Die Zwergenwerkzeuge schmieden von selbst. Die Kraft der Zwerge ist im Gürtel, mit dem sie sich um die Mitte gürten; nimmst du dem Zwerge den Gürtel, so ist es um seine Macht gethan, und kann man ihn da zwingen, zu schmieden, was man verlangt, und Kleinodien dafür zu geben, um den Gürtel zurückzubekommen. Am Fusse der Steine, wo sie wohnen, kann man oft Asche liegen sehen, welche aus ihrer Schmiede herausgefegt ist.
Ein Stein steht im Gásadál, wo Zwerge wohnen; dort drinnen hört man sie bisweilen schmieden. Ein armer Mann war einmal nördlich in Tunga und stach Torf; er sah den Stein offen und die Zwerge drinnen schmieden; er ging näher, um sie zu beobachten. Ein Zwerg kam da heraus in die Thüre und sagte zu ihm: "Naseweis warst du, so arm du bist; doch sollst du dieses Messer bekommen," und nun warf er ihm ein Messer heraus, das so scharf war, dass es alles schnitt, was mit seiner Schneide in Berührung kam, wie hart es auch sein mochte.
Huldervolk.1
Sie sind von grossem Wuchse, die Kleider sind ganz grau, das Haar schwarz; ihre Wohnsitze sind in Hügeln, sie heissen auch Elfen [álvar]; ein "Elfenhügel" ist auf Norđstreymoy, südlich von Vík (Huldorsvík). Sie leben wie andere Leute, rudern aus, haben Schafe und Rinder, welche unter den anderen Rindern auf der Weide herumgehen. Die Huldern können sich selbst und das, was sie besitzen, für Menschen unsichtbar machen, und deshalb sagt man oft von etwas, das man vermisst, dass die Hulder es versteckt hat. Sie nehmen gern kleine Kinder, die ungetauft sind, aus der Wiege und legen dafür die ihrigen in dieselbe, aber diese werden dann Dummköpfe [Wechselbälge]2 unter den Menschen. Oft verschwinden kleine Kinder, welche draussen allein gehen, und da ist es das Huldervolk, das mit ihnen davon gefahren ist; sie werden zuweilen weite Wegstrecken entfernt von den Wohnsitzen wieder gefunden und haben dann erzählt, dass ein grosser Mann ihnen Speise gebracht habe, während sie fort waren. Die Huldermädchen fassen oft Liebe zu Kristenburschen und versuchen daher sie zu verführen und an sich zu ziehen. Gehen diese hinaus in die Öde und sind durstig und müde, so öffnet sich der Hügel und eine Jungfrau kommt heraus, um ihnen einen Trunk zu bieten, Bier oder Milch; blasen sie da nicht den Schaum von oben ab, so trinken sie sich Vergessenheit, denn in ihm liegt der Zauber, und damit verzaubern sie sie, bekommen Gewalt über sie und nehmen sie mit sich in den Elfenhügel.
Fußnoten
1 wörtlich: die Verhüllten (huldufólk); ich habe die bekanntere norwegische Form (en hulder) gewählt.
2 das färöische bytlingur bedeutet beides.
Die Wichteln und die weise Marjun in Örđavík.
Die Wichteln [vættrar] sind klein, hübsch von Aussehen, gute Geister, welche in den Häusern bei guten Leuten leben und während ihres Aufenthaltes geniessen diese Glück und werden von ihnen unterstützt, so dass alles gut geht in dem Hause, wo Wichteln sind; glücklich ist der Freund der Wichteln, denn ihm können weder Trolle noch Huldern noch jemand lebender unter der Erde oder auf der Erde schaden.
Marjun in Örđavík war vom Norden von Kollafjord [Dorf] nach Suđuroy gekommen und soll eines der zaubergewaltigsten Weiber gewesen sein, die hier im Gedächtnis behalten worden sind; sie war die klügste und tüchtigste Frau in jeder Richtung. Sie war überaus reich und besass eine Menge von Rindern und Schafen und allen Herrlichkeiten – kein Wunder! – die Wichteln wohnten bei ihr. Sie hatte auf ihrem Hofe einen blöden Jungen, welchen sie dazu hielt, dass er die Schafe im Sommer aus dem bebauten Land wegtriebe, wenn sie in die Einhegung hinein kamen; aber dieser Wechselbalg konnte nichts anderes verrichten, als eben dieses. In den Lebtagen Marjuns kamen Vikinger aus den Südlanden, Türken, um die Föroyer zu verheeren. Sie kamen auch nach Suđuroy, alles zu plündern und verwüsten in jenen südlichen Ansiedlungen, wie sie im Norden gethan hatten. Nun sieht sie Marjun von den Höhen herab südwärts gegen Örđavík kommen. Aber sie fürchtete sich nicht wie jene, welche vor ihnen in das Gebirge flohen und sich in Höhlen und Löchern versteckten und schwarzes Tuch vorhängten; – nein, Marjun sandte den Wechselbalg mit dem Wachthunde ins Feld hinaus und sagte ihm, er solle diese Männer aus dem Feld vertreiben. Er dachte an keine Gefahr, der Arme, und ging darum unerschrocken und munter auszuführen, was ihm die Bäuerin befahl, so wie er gewohnt war. Als er nun gegen die Räuber mit seinem kleinen Hunde gelaufen kam, als ob das nichts anderes wäre als einige scheue Schafe, die immer davonliefen, wenn er mit dem Hunde kam, stand die erfahrene Hausmutter an der Hauswand und winkte mit der Hand gegen die Türken. Als sie sehen, dass ein Krüppel von einem Jungen ihnen so kühn mit einem kleinen Hunde entgegen kommt und ein altes Weib so ruhig an der Hauswand steht, werden sie bestürzt und denken bei sich, dass diese beiden doch nicht so schwach sein könnten, als sie gering an Zahl schienen, sondern im Verborgenen das haben müssten, um sich zu wehren, was ihnen teuer zu stehen kommen könnte. So wird erzählt, dass sie nicht länger südwärts auf der Insel vorzudringen wagten, sondern geradenwegs nach Hvalbö umkehrten. Von hier nahmen sie zwei Mädchen mit sich, welche mit Marjun verwandt waren; und als sie das hörte, sagte sie, ehe ihr Blut kalt würde (d.i. ehe das siebente Geschlecht von ihr gestorben wäre) sollte das gerächt werden und dieses Türkenvolk unter einen König aus einem anderen Reiche zu stehen kommen.
Marjun in Örđavík hatte gutes Glück mit sich in allem, was sie anfing, und alles fügte sich ihr wohl; und das kam davon, dass die guten Wichteln





























