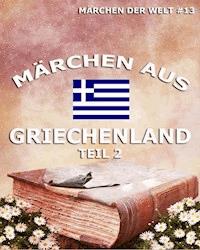
Märchen aus Griechenland, Band 2 E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Erleben Sie die Märchen und Sagen aus aller Welt in dieser Serie "Märchen der Welt". Von den Ländern Europas über die Kontinente bis zu vergangenen Kulturen und noch heute existierenden Völkern: "Märchen der Welt" bietet Ihnen stundenlange Abwechslung. Ein Auszug aus dem Inhaltsverzeichnis dieses Buches: Die Faulenzerin. Der Spruch der Moeren. Die gute Schwester. Der König mit den Bocksohren. Die drei Citronen. Die verzauberte Königstochter oder der Zauberthurm. Die Herrin über Erde und Meer. Der goldne Apfel des unsterblichen Vogels. Prinz Krebs. Die Schönste. Der Capitän Dreizehn. Der Drache. Der Riese vom Berge. Helios und Maroula. Das Schloss des Helios. Die Mutter des Érotas. Maroula und die Mutter des Érotas. Der Garten des Érotas. Tischtuch und Goldhuhn. Die Wunderpfeife. Der Garten des Charos. Gevatter Charos. Die siebenköpfige Schlange. Der Teufel und des Fischers Töchter. Die Sendung in die Unterwelt. Gott und die Riesen. Charos' Strafe. Der Vogel Gkión. Himmel und Meer. Die Neraïde. Die Neraïden an der Mühle. Der Wampyr. Der Teufel in der Flasche. Die Rache der Lámnissa. Die Arachobiten und die Lámnia. Der Drache von Koumariá. Die Räthselwette. Der Einsiedler auf dem Berge Liákoura. Alexander von Makedonien. Die Wirkung des Weines.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 145
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Märchen aus Griechenland – Band 2
Inhalt:
Geschichte des Märchens
Märchen aus Griechenland – Band 2
Die Faulenzerin.
Der Spruch der Moeren.
Die gute Schwester.
Der König mit den Bocksohren.
Die drei Citronen.
Die verzauberte Königstochter oder der Zauberthurm.
Die Herrin über Erde und Meer.
Der goldne Apfel des unsterblichen Vogels.
Prinz Krebs.
Die Schönste.1
Der Capitän Dreizehn.1
Der Drache.
Der Riese vom Berge.
Helios und Maroula.
Das Schloss des Helios.
Die Mutter des Érotas.
Maroula und die Mutter des Érotas.
Der Garten des Érotas.1
Tischtuch und Goldhuhn.
Die Wunderpfeife.
Der Garten des Charos.
Gevatter Charos.
Die siebenköpfige Schlange.1
Der Teufel und des Fischers Töchter.
Die Sendung in die Unterwelt.
Gott und die Riesen.
Charos' Strafe.
Der Vogel Gkión.1
Himmel und Meer.
Die Neraïde.1
Die Neraïden an der Mühle.
Der Wampyr.
Der Teufel in der Flasche.
Die Rache der Lámnissa.
Die Arachobiten und die Lámnia.
Der Drache von Koumariá.
Die Räthselwette.
Der Einsiedler auf dem Berge Liákoura.
Alexander von Makedonien.
Die Wirkung des Weines.
Märchen aus Griechenland, Teil 2
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
www.jazzybee-verlag.de
Frontcover: © Sweet Angel - Fotolia.com
Geschichte des Märchens
Ein Märchenist diejenige Art der erzählenden Dichtung, in der sich die Überlebnisse des mythologischen Denkens in einer der Bewußtseinsstufe des Kindes angepaßten Form erhalten haben. Wenn die primitiven Vorstellungen des Dämonenglaubens und des Naturmythus einer gereiftern Anschauung haben weichen müssen, kann sich doch das menschliche Gemüt noch nicht ganz von ihnen trennen; der alte Glaube ist erloschen, aber er übt doch noch eine starke ästhetische Gefühlswirkung aus. Sie wird ausgekostet von dem erwachsenen Erzähler, der sich mit Bewußtsein in das Dunkel phantastischer Vorstellungen zurückversetzt und sich, vielfach anknüpfend an altüberlieferte Mythen, an launenhafter Übertreibung des Wunderbaren ergötzt. So ist das Volksmärchen (und dieses ist das echte und eigentliche M.) das Produkt einer bestimmten Bewußtseinsstufe, das sich anlehnt an den Mythus und von Erwachsenen für das Kindergemüt mit übertreibender Betonung des Wunderbaren gepflegt und fortgebildet wird. Es ist dabei, wie in seinem Ursprung, so in seiner Weiterbildung durchaus ein Erzeugnis des Gesamtbewußtseins und ist nicht auf einzelne Schöpfer zurückzuführen: das M. gehört dem großen Kreis einer Volksgemeinschaft an, pflanzt sich von Mund zu Munde fort, wandert auch von Volk zu Volk und erfährt dabei mannigfache Veränderungen; aber es entspringt niemals der individuellen Erfindungskraft eines Einzelnen. Dies ist dagegen der Fall bei dem Kunstmärchen, das sich aber auch zumeist eben wegen dieses Ursprungs sowohl in den konkreten Zügen der Darstellung als auch durch allerlei abstrakte Nebengedanken nicht vorteilhaft von dem Volksmärchen unterscheidet. Das Wort M. stammt von dem altdeutschen maere, das zuerst die gewöhnlichste Benennung für erzählende Poesien überhaupt war, während der Begriff unsers Märchens im Mittelalter gewöhnlich mit dem Ausdruck spel bezeichnet wurde. Als die Heimat der M. kann man den Orient ansehen; Volkscharakter und Lebensweise der Völker im Osten bringen es mit sich, daß das M. bei ihnen noch heute besonders gepflegt wird. Irrtümlich hat man lange gemeint, ins Abendland sei das M. erst durch die Kreuzzüge gelangt; vielmehr treffen wir Spuren von ihm im Okzident in weit früherer Zeit. Das klassische Altertum besaß, was sich bei dem mythologischen Ursprung des Märchens von selbst versteht, Anklänge an das M. in Hülle und Fülle, aber noch nicht das M. selbst als Kunstgattung. Dagegen taucht in der Zeit des Neuplatonismus, der als ein Übergang des antiken Bewußtseins zur Romantik bezeichnet werden kann, eine Dichtung des Altertums auf, die technisch ein M. genannt werden kann, die reizvolle Episode von »Amor und Psyche« in Apulejus' »Goldenem Esel«. Gleicherweise hat sich auch an die deutsche Heldensage frühzeitig das M. angeschlossen. Gesammelt begegnen uns M. am frühesten in den »Tredeci piacevoli notti« des Straparola (Vened. 1550), im »Pentamerone« des Giambattista Basile (gest. um 1637 in Neapel), in den »Gesta Romanorum« (Mitte des 14. Jahrh.) etc. In Frankreich beginnen die eigentlichen Märchensammlungen erst zu Ende des 17. Jahrh.; Perrault eröffnete sie mit den als echte Volksmärchen zu betrachtenden »Contes de ma mère l'Oye«; 1704 folgte Gallands gute Übersetzung von »Tausendundeiner Nacht« (s. d.), jener berühmten, in der Mitte des 16. Jahrh. im Orient zusammengestellten Sammlung arabischer M. Besondern Märchenreichtum haben England, Schottland und Irland aufzuweisen, vorzüglich die dortigen Nachkommen der keltischen Urbewohner. Die M. der skandinavischen Reiche zeigen nahe Verwandtschaft mit den deutschen. Reiche Fülle von M. findet sich bei den Slawen. In Deutschland treten Sammlungen von M. seit der Mitte des 18. Jahrh. auf. Die »Volksmärchen« von Musäus (1782) und Benedikte Naubert sind allerdings nur novellistisch und romantisch verarbeitete Volkssagen. Die erste wahrhaft bedeutende, in Darstellung und Fassung vollkommen echte Sammlung deutscher M. sind die »Kinder- und Hausmärchen« der Brüder Grimm (zuerst 1812–13, 2 Bde.; ein 3. Band, 1822, enthält literarische Nachweise bezüglich der M.). Unter den sonstigen deutschen Sammlungen steht der Grimmschen am nächsten die von L. Bechstein (zuerst 1845); außerdem sind als die bessern zu nennen: die von E. M. Arndt (1818), Löhr (1818), J. W. Wolf (1845 u. 1851), Zingerle (1852–54), E. Meier (1852), H. Pröhle (1853) u. a. Mit M. des Auslandes machten uns durch Übertragungen bekannt: die Brüder Grimm (Irland, 1826), Graf Mailath (Ungarn, 1825), Vogl (Slawonien, 1837), Schott (Walachei, 1845), Asbjörnson (Norwegen), Bade (Bretagne, 1847), Iken (Persien, 1847), Gaal (Ungarn, 1858), Schleicher (Litauen, 1857), Waldau (Böhmen, 1860), Hahn (Griechenland u. Albanien, 1863), Schneller (Welschtirol, 1867), Kreutzwald (Esthland, 1869), Wenzig (Westslawen, 1869), Knortz (Indianermärchen, 1870, 1879, 1887), Gonzenbach (Sizilien, 1870), Österley (Orient, 1873), Carmen Sylva (Rumänien, 1882), Leskien und Brugman (Litauen, 1882), Goldschmidt (Rußland, 1882), Veckenstedt (Litauen, 1883), Krauß (Südslawen, 1883–84), Brauns (Japan, 1884), Poestion (Island, 1884; Lappland, 1885), Schreck (Finnland, 1887), Chalatanz (Armenien, 1887), Jannsen (Esthen, 1888), Mitsotakis (Griechenland, 1889), Kallas (Esthen, 1900) u. a. Unter den Kunstpoeten haben sich im M. mit dem meisten Glück versucht: Goethe, L. Tieck, Chamisso, E. T. A. Hoffmann, Fouqué, Kl. Brentano, der Däne Andersen, R. Leander (Volkmann) u. a. Vgl. Maaß, Das deutsche M. (Hamb. 1887); Pauls »Grundriß der germanischen Philologie«, 2. Bd., 1. Abt. (2. Aufl., Straßb. 1901); Benfey, Kleinere Schriften zu Märchen-forschung (Berl. 1890); Reinh. Köhler, Aufsätze über M. und Volkslieder (das. 1894) und Kleine Schriften, Bd. 1: Zur Märchenforschung (hrsg. von Bolte, das. 1898); R. Petsch, Formelhafte Schlüsse im Volksmärchen (das. 1900).
Märchen aus Griechenland – Band 2
Die Faulenzerin.
Zakynthos.
Es war einmal ein junges Mädchen, das war sehr faul und überliess immer seiner Mutter die Arbeiten, die ihm selber oblagen. So wuchs es auf, und die Zeit kam heran, da es sich zu verheirathen wünschte. Da kaufte ihm seine Mutter eine Menge Garn, um Strümpfe zu stricken und Leinwand zu Hemden und andern Kleidungsstücken zu weben. Ein Jahr gab die Mutter der Tochter Zeit, ihre Ausstattung herzurichten: das Jahr darauf sollte die Hochzeit sein. Aber die Tochter liess das ganze Jahr verstreichen, ohne zu arbeiten. Als nun der Tag der Trauung immer näher rückte und sie sah, dass nichts fertig war, da weinte sie Tag und Nacht und war ganz untröstlich. In der letzten Nacht vor der Hochzeit erschienen auf einmal drei Frauen vor ihr. Die eine von ihnen hatte eine Nase, die war so gross, dass sie bis auf die Füsse hinabhing; die zweite hatte eine Unterlippe von ähnlicher Länge; die dritte endlich hatte einen Hinteren, der war grosser als die ganze Person.1 Und sie sprachen zu dem Mädchen: ›Wir sind drei Schwestern, die eine von uns heisst Mytú, die andere Tsachilú und die dritte Kolú.2 Fürchte dich nicht vor uns, liebes Kind. Denn siehe, wir sind deine Moeren. Wir haben dir das Los zugetheilt, dass du eine Faulenzerin bist,3 doch wollen wir dich nicht als solche auch vor deinem Bräutigam erscheinen lassen. Wir sind gekommen, dir zu helfen. Gib nur dein Garn her. Die eine von uns ist Weberin, und weil sie bei ihrer Arbeit bald nach links bald nach rechts sich wendet und die Nase beständig hin und her bewegt, davon ist diese so gross geworden. Die andere ist Nähterin, und darum hat sich ihre Lippe so weit herunter gezogen, indem sie sie beständig mit dem Finger berührt, um diesen zu netzen und den Faden zu drehen. Die dritte von uns ist Strickerin, und von dem ewigen Hocken auf einem Fleck hat sie einen so grossen Hinteren bekommen.‹ Das Mädchen gab den drei Frauen das Garn. Nun machten sich diese an die Arbeit, und in einer Stunde war alles vollendet, was die Faule in einem Jahre hatte machen sollen. Jetzt brachen die Moeren wieder auf, indem sie zu ihr sagten: ›Sieh, wir haben dir dies alles gemacht und verlangen keinen Lohn dafür. Nur bitten wir dich uns zu erlauben, dass wir morgen zu deiner Hochzeit kommen.‹ – ›Ei mit Vergnügen,‹ antwortete das Mädchen. Am folgenden Abend war alles bereit zur Hochzeit. Da liessen sich auf einmal grosse Freudenrufe vernehmen, und Wagen rollten eilends daher. Gleich darauf öffnete sich die Thür, und herein traten die drei Moeren, gingen auf die Braut zu, küssten sie und setzten sich neben ihr nieder. Da fragte der Bräutigam seine Braut ganz verwundert, ob sie diese Weiber kenne, und wie es komme, dass sie so verunstaltet seien. ›Ja,‹ antwortete die Braut, ›das sind Freundinnen von mir,‹ und nun erzählte sie ihm, auf welche Weise sie so hässlich geworden. Da sagte er, von Verwunderung und Angst zugleich erfüllt, zu seiner Braut: ›Ei, ich will ein schönes Weib haben und nicht ein hässliches. Damit es dir also nicht auch so gehe, wie diesen Frauen, sollst du nimmer arbeiten.‹ So erfüllte denn das Mädchen ihr Geschick.
Fußnoten
1 Eine auf Zakynthos häufig gebrauchte hyperbolische Ausdrucksweise.
2 Μυτοῦ, Τcαχειλοῦ, Κωλοῦ, von μύτη (Nase), χεῖλcο (Lippe) und κῶλοc (Hintere) gebildet. Die neugriechischen Feminina auf οῦ entsprechen genau den altgriechischen auf ώ, wie Κλωθώ. Die erste Silbe in Τcαχειλοῦ dient zur Verstärkung des Begriffes und ist ohne Zweifel aus dem alten Praefixum ζα- entstanden.
3 Ἑμεῖc cὲ ἐμοιράναμε, ἀκαμάτρα νὰ ἦcαι.
Der Spruch der Moeren.
Steiri.
Anfang des Märchens. Guten Abend euch allen!1 Es war einmal in alten Zeiten ein junger Mann, ein Kaufmann, heisst es, der befand sich auf der Reise, und als es dunkel wurde, kehrte er in einem Hause ein. Die Frau seines Wirthes hatte kurz vorher ein Kind bekommen, und zwar ein Mädchen. Als nun die Leute im Hause sich schlafen legten, legte sich auch der Fremde nieder. Es war schon ein Theil der Nacht verstrichen, da hörte er drei Frauen sprechen. Er horchte auf, um zu vernehmen, was sie sagten. Da hörte er, dass von dem neugeborenen Kinde die Rede war. Die eine sagte: ›Es soll einen guten Mann bekommen, wenn's gross geworden.‹ Das nämliche sagte auch die zweite. Die dritte aber sprach: ›Nein! Es soll keinen andern Mann bekommen, als den Fremden, der hier auf der Erde liegt und schläft.‹ Als das der Fremde hörte, ward er zornig und sprach zu sich: ›Was? Ich, ein kräftiger Mann von dreissig Jahren, soll diesen Teufel da heirathen?‹ Und damit stand er auf, ergriff das Kind und warf es zum Fenster hinaus. Es fiel aber mit der Seite auf einen Pfahl und wurde angespiesst. Nun machte sich der Fremde aus dem Staube. Als nun am Morgen die Mutter aufstand und ihr Kind nicht mehr sah, suchte sie es in allen Ecken und fand es endlich an dem Pfahle hängend gleich einem kleinen Weinschlauch. Sie nahm es herunter und pflegte es gut, und das Kind genass. Nach Verlauf vieler Jahre beschloss jener Kaufmann sich zu verheirathen und hielt bei vielen an, erreichte jedoch seinen Zweck nicht. Nach einiger Zeit holte er sich eine Frau aus einem andern Orte. Als nun am Abend beide zu Bette gingen, bemerkte der Mann, dass seine Frau in der Seite eine grosse Narbe hatte. Er fragte sie, woher das komme, und da erzählte sie ihm, wie einst, als sie klein war, ein Fremder, der im Hause ihres Vaters eingekehrt, sie zum Fenster hinausgeworfen habe, und wie sie auf einen Pfahl gefallen und an der Stelle, wo die Narbe zu sehen, angespiesst worden sei. Da sagte ihr Mann zu ihr: ›Höre, Weib, ich war jener Fremde, von dem du sprichst. Ich hörte damals die Moeren sagen, das neugeborene Kind solle mich zum Manne bekommen, darüber ärgerte ich mich, da ich bereits dreissig Jahre alt war. Nun sieh, wie die Moeren es fügen: was sie einmal bestimmen, daran ändern sie nichts.‹2 So sprachen sie mit einander und schliefen gut, und wir noch besser.
Fußnoten
1 Ἀρχὴ τοῦ παραμυθιοῦ? καλὴ cπέρα cαc!
2 Κῂ παραιτήριc πῶc τὰ φέρνι ᾑ Μοίρῃc? ὅ, τι γράφνι, δὲν ξεγράφνι.
Die gute Schwester.
Ebendaher.
Es waren einmal ein König und sein Weib, die Königin, und sie hatten eine Tochter. Eines Tages bekam die Königin auch ein Knäblein. In der dritten Nacht nach der Geburt kamen die Moeren, um dem Kleinen sein Los zuzutheilen; und seine Schwester, die in seiner Nähe schlief, wachte auf und hörte, was sie redeten. Die eine von ihnen sprach: ›Er soll, wenn er drei Jahre alt ist, ins Feuer fallen und verbrennen.‹ Die zweite sprach: ›Nein! Wenn er sieben Jahre alt ist, soll er von einem Felsen stürzen.‹ Die dritte endlich sprach: ›Nein! Er soll nicht verbrennen noch von einem Felsen stürzen, sondern, wenn er zweiundzwanzig Jahre alt ist und sich verheirathet hat, soll am ersten Abend, da er mit seiner jungen Frau schlafen geht, eine Schlange oben vom Dachstuhl1 herunterkommen und ihn beissen.‹ Die Schwester merkte sich alles genau, was die Moeren gesagt hatten; sie liess ihren kleinen Bruder nie allein und hatte immer Acht auf ihn. Obgleich sie schon erwachsen war und in dem Alter stand, wo die Mädchen heirathen, so wollte sie doch seit jenem Tage, wo sie die Moeren so Schlimmes hatte verkünden hören, weder andere Kleider anlegen noch an Festlichkeiten Theil nehmen, obwohl sie doch eine Prinzessin war, noch wollte sie heirathen; sondern sie schlich einher, wie eine Unglückliche, und weinte immer. Ihr Vater und ihre Mutter blickten mit grosser Betrübniss auf sie und fragten sie, warum sie so traurig sei Allein weder ihren Eltern noch irgend einem andern wollte sie's gestehen; sie blickte nur immer auf ihren Bruder und weinte. Als dieser nun drei Jahre alt war, näherte er sich eines Tages dem Feuer, das er schüren und mit den Flammen spielen wollte. Schon war er nahe daran hineinzufallen und sich zu verbrennen, da riss ihn die Schwester noch hinweg, und so entrann das Kind dem bösen Schicksal, welches die erste der Moeren ihm vorausbestimmt hatte. Es wuchs nun heran und wurde sehr wild; und eines Tages, da es mit den andern Kindern spielte, war es eben daran, von einem Felsen hinab in die Tiefe zu stürzen, da sprang seine Schwester, die ihm überall hin folgte, rasch herbei, fasste ihren Bruder beim Hemd und zog ihn zurück. Und so entrann er auch dem andern bösen Schicksal, welches die zweite der Moeren ihm vorherbestimmt hatte. Er wurde allmählich gross und wurde ein sehr schöner Jüngling. Und als er das zweiundzwanzigste Jahr erreicht hatte, verheirathete er sich und nahm ein sehr schönes Mädchen, und das war auch eines Königs Tochter. Am ersten Abend nun, als das junge Paar sich niederlegen wollte, stürzte sich eine furchtbare Schlange, wie ein Balken so stark und noch stärker, vom Dachstuhl wüthend auf den Prinzen herab und drohte ihn zu verschlingen. Aber da war wieder seine Schwester zur Stelle mit dem Schwerte ihres Vaters, und in dem Augenblicke, da die Schlange auf ihren Bruder losfuhr, zückte sie das Schwert und schlug sie todt. Und somit entrann jener auch dem von der dritten der Moeren ihm bestimmten Schicksal. Nun, da die drei Gefahren überstanden waren, von denen die bösen Moeren gesprochen hatten, erklärte die Tochter ihrem Vater und ihrer Mutter, aus welchem Grunde sie keine andren Kleider hatte anlegen, nicht an Festlichkeiten Theil nehmen und nicht heirathen wollen, so viele und so gute Männer auch ihre Eltern ihr vorgeschlagen, und warum sie ihrem Bruder überall hin nachgegangen sei. Jetzt entschloss auch sie sich zum Heirathen und bekam einen guten Mann. Und ihr Vater und ihre Mutter gaben ihr was sie nur wünschte, zum Danke für ihren Edelsinn und für die Liebe, die sie ihrem Bruder bewiesen. Und der Bruder schenkte ihr noch mehr. Und so blieb das Königreich nicht ohne Erben, und die Tochter machte noch eine sehr gute Partie, wie ihr edles Herz es verdiente. – So handeln die guten Schwestern!
Fußnoten
1 ἀπ᾽ τὴ μάνα. – Das Märchen überträgt hier die Einrichtung eines griechischen Bauernhauses auf einen Palast.
Der König mit den Bocksohren.
Zakynthos.
Es war einmal und zu einer gewissen Zeit ein junger Bursch, der ging, nachdem sein Vater gestorben war, in Trauerkleidern auf die Wanderschaft, immer der Nase nach.1 Indem er so dahin wanderte, sah er am Wege ein Schilfrohr stehen, das schnitt er ab und machte sich eine Flöte daraus. Als er nun auf der Flöte bliess, liess diese die Worte ertönen: ›Der König, der fünffach verschleierte, hat Bocksohren.‹2 Er zog, immer auf der Flöte spielend, weiter und kam endlich in die Stadt des fünffach verschleierten Königs. Dieser König hatte wirklich Bocksohren, und seine Moeren hatten





























