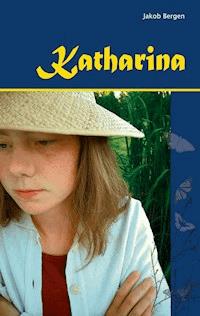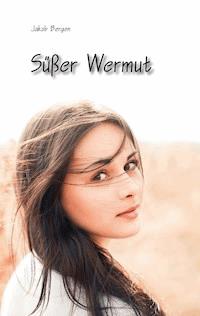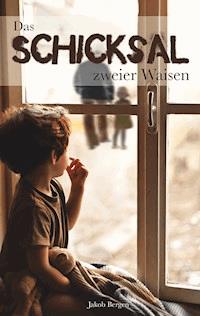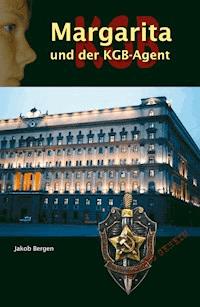
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lichtzeichen Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Die kleine Margarita wird ständig beschattet. Ihre Familie geht einen schweren Weg der Bedrohung und Verfolgung. Sie bleiben aber ihrem Glauben treu und Gott belohnt sie dafür. Eine bewegende Geschichte aus dem Leben der Christen in der Sowjetunion.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 188
Ähnliche
Jakob Bergen
Margarita und der KGB-Agent
Erzählung
Originaltitel: „Маргарита и сотрудник КГБ”
© 2002 Яков Берген
Jakob Bergen
Margarita und der KGB-Agent
Erzählung
© 2013 Lichtzeichen Verlag GmbH, Lage
Übersetzung: Ag. Schneider / K. Rempel
Redaktion: E. Wilhelm / Erna Friesen
Umschlag/Satz: Gerhard Friesen
ISBN: 9783869549828
Bestell-Nr.: 548982
E-Book Erstellung: LICHTZEICHEN Medien www.lichtzeichen-medien.com
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Erlaubnis des Verlegers in irgendeiner Form reproduziert werden.
Inhaltsverzeichnis
Teil I
Teil II
Teil III
„Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr.“ Jesaja 55,8
Teil 1
Alle Familienmitglieder saßen noch am Mittagstisch, als vor dem Fenster ihres Hauses ein PKW der Marke „GAS 69“, der von den Dorfbewohnern einfach „Bobik“ genannt wurde, hielt.
Das war kein gewöhnlicher „GAS 69“, sondern das allen bekannte, dunkelgrüne Auto, mit dem in die deutsche Dörfer immer der KGB-Mann kam. Dieser eifrige Staatsdiener wohnte im Gebietszentrum, trug immer Zivilkleidung, aber in seinem Büro in der Stadt sahen die Leute ihn auch in Uniform, mit Schulterklappen eines Oberleutnants. Die Dorfbewohner kannten ihn alle, es war Tschernow, ein Mitarbeiter, der von der Partei und den höher gestellten Organen, wie man damals zu sagen pflegte, für den Kampf mit der Religion eingestellt war.
Das Familienoberhaupt, vor dessen Fenster der „Bobik“ gehalten hatte, war ein tiefgläubiger Mann namens Kran. Er predigte das Wort Gottes nach besten Kräften und war für Genosse Tschernow deshalb der Feind Nummer eins. Peter und Maria Kran legten sofort ihre Löffel auf den Tisch, sahen zuerst besorgt einander und dann durchs Fenster das Auto des ungeladenen Gastes.
Die junge Familie bestand aus fünf Personen. Der älteste Sohn Hans war von Geburt an geistig behindert, das zweite Kind war die Tochter Margarita, die vor kurzem zehn Jahre alt geworden war. Die jüngste Tochter, die nach der Mutter Maria genannt worden war, war erst einundhalb Jahre alt und saß auf dem Schoß der Mutter.
Als Tschernow an die Tür klopfte, war Peter Kran schon von seinem Platz aufgestanden, um den Gast in Empfang zu nehmen.
„Guten Tag“, begrüßte Tschernow die Familie und schaute sich im Zimmer um. Diesen Gast interessierte alles, darum funkelten seine schwarzen Augen, einen nach dem andern in Augenschein nehmend. Um seine vermeintliche Anständigkeit zu demonstrieren, vielleicht auch um den Hauswirten seine Wichtigkeit zu vermitteln, begrüßte Tschernow die Hauswirte immer mit Händedruck. Dabei schaute er seinem Gegenüber direkt in die Augen, als ob er darin die Gedanken des Gesprächspartners sehen oder erraten wollte. Jetzt, während der Begrüßung des Familienoberhauptes warf er einen Blick auch auf die Hausfrau. Sie bemerkte das auch und begrüßte den Gast kopfnickend.
„Petr Iwanowitsch“, sagte Tschernow, ohne den Blick von ihm abzuwenden, „ich muss mich mit Ihnen unterhalten und es wäre gut, wenn Ihre Ehefrau bei dem Gespräch dabei wäre.“
Der Hauswirt lud den Gast ins Nebenzimmer, wo auf einem kleinen Tischchen die Bibel lag. Tschernow setzte sich bequem an den Tisch und kam direkt zur Sache.
„Mir ist bekannt, Petr Iwanowitsch, dass Sie ein guter Arbeiter sind, aber wir wissen auch, dass Sie, zur Schande Ihrer ehrlichen und gewissenhaften Mitbürger, sich mit einer verbrecherischen Tätigkeit beschäftigen.“
Die Eheleute Kran, deren Gewissen vor Gott und den Menschen rein war, saßen still, das Haupt geneigt. Der behinderte Hans hatte sich neben der Mutter platziert und schaute unverwandt den fremden Mann an. Die kleine Maria saß auf dem Schoß der Mutter. Nur Margarita war in der Küche geblieben, räumte den Tisch ab und lauschte, worüber im anderen Zimmer gesprochen wurde.
Genosse Tschernow, der im Dorf „der schwarze Peter“ genannt wurde, sprach von sich fast immer in Mehrzahl. Wahrscheinlich, weil er Parteimitglied und dazu noch Mitarbeiter der Staatssicherheitsorgane war und folglich im Namen der Partei sprach.
„Wir haben Sie doch gewarnt, Petr Iwanowitsch, und nicht nur einmal, dass Sie Ihre widerrechtliche Versammlungen einstellen sollen und aufhören, den Leuten die Köpfe mit ihren religiösen Predigten vollzustopfen. Den sowjetischen Gesetzen zum Trotz fahren Sie mit Ihrer Propaganda fort. Haben Sie wenigstens mal überlegt, was für einen Schaden Sie damit den ehrlichen Sowjetbürgern zufügen? Sie verdrehen nicht nur den erwachsenen Bürgern den Kopf, sondern vergiften auch die Kinder durch Ihre antisowjetische Tätigkeit! Bedenken Sie, Prediger Kran, dass unsere Geduld bald zu Ende ist! Wir werden es nicht zulassen, dass unsere sowjetischen Bürger Ihre Ansichten übernehmen!“
Tschernow machte eine kurze Pause, sah mit seinem bösen Blick abwechselnd alle Familienmitglieder an, heftete seine Augen auf den ältesten Sohn und fragte: „Haben die Ärzte Ihnen gesagt, wovon Ihr Kind behindert geboren ist?“
Im Zimmer wurde es still. Maria schaute auf ihren Ehemann, dann auf den neben ihr sitzenden Hans und sagte kleinmütig:
„Ja, aber was ändert das schon? Wir sind alle in Gottes Hand und müssen unser Kreuz tragen.“
„Kreuz, sagen Sie“, erwiderte spöttisch Tschernow und fuhr fort, „wer legt Ihnen denn das Kreuz auf? Sie quälen sich ja selbst an den Abenden, statt zu ruhen, in Angst vor ihrer eingebildeten Zukunft! Sie schreiben in den Nächten Bibeltexte, Lieder und Gedichte ab, statt zu schlafen! Ist es so oder nicht?“
Es wurde wieder still und dann sprach der Hauswirt, Peter Kran.
„Genosse Tschernow“, fing er an und hörte die spöttische Bemerkung: „Genosse …“ Aber Peter tat, als hätte er den Vorwurf nicht gehört und fuhr ruhig fort: „Dass wir uns abends versammeln, ist für uns Gläubige keine Last und entspringt nicht der Angst, sondern eine Erholung vom Alltag. Dabei danken wir Gott und bitten um seine Hilfe. Wir danken Gott für die Gesundheit und alles, was wir haben, und beten auch für unsere Regierung, dass er, der große Gott, sie behüte und ihr die Sünden vergebe. Ist das denn verboten? Wir wünschen allen Menschen nur Gutes und Frieden und bemühen uns, auch unsere Kinder in diesem Sinne zu erziehen.“
„Wir kennen Ihre Erziehung!“ unterbrach ihn Tschernow, „aber glauben Sie meinen Worten, wir werden nicht zulassen, dass Ihre Erziehung Anklang bei anderen findet! Sie berauben die Kinder des wahren Glückes! Das ist Ihr Bestreben! Entschuldigen Sie, aber, ehrlich gesagt, machen Sie durch Ihre Predigten gesunde Kinder zu solchen wie dieser Ihr Sohn.“
Tschernow wurde still. Er schielte, ohne den Kopf zu drehen, auf Frau Kran und merkte wohl, trotz seines harten Herzens, dass er zu viel gesagt hatte. Die Mutter des behinderten Hans zuckte zusammen und weinte. Tschernow fand es nicht nötig, sich zu entschuldigen. Alle schwiegen, nur der neben der Mutter sitzende Hans wurde unruhig. Er verstand kein Russisch, aber als seine Mutter, die er über alles auf der Welt liebte, anfing zu weinen, begriff er, dass der fremde Mann sie beleidigt hatte.
„Was will er von uns?“ fragte Hans laut in Plattdeutsch und, auf Tschernow schauend, sagte er fordernd: „Geh weg, geh weg! Du bist ein schlechter Mensch.“
Zum Glück verstand Tschernow ihn nicht, aber er verstand, dass der Junge seine Mutter beschützen wollte. Frau Kran hielt den Mund des Sohnes mit ihrer Hand zu, damit er schweige.
„Ja, ich verstehe, dass Sie es schwer mit ihm haben, aber Sie haben meine Frage noch immer nicht beantwortet, wovon ihr Kind krank ist?“
Maria Kran konnte und wollte nicht mehr mit diesem bösen Menschen sprechen, sie bedeckte ihr Gesicht mit einem Taschentuch und weinte leise.
Tschernow wartete und da entschloss Peter sich, es ausführlich zu erklären.
„Als wir heirateten, arbeitete meine Maria als Melkerin in der Viehfarm, wo sie nicht nur melken musste, sondern im Winter auch die Kühe füttern. Das Futter hatten die Melkerinnen selber in den Kuhstall zu tragen. Das wurde mit großen geflochtenen Körben gemacht. Wenn Sie, Genosse Tschernow, gesehen hätten, wie diese Arbeit verrichtet wurde, dann wüssten Sie, dass die Frauen die Körbe, gefüllt mit schwerem Silofutter, am Bauch gestützt, vor sich her trugen. Und das ist, wie die Ärzte sagen, sehr gefährlich für eine schwangere Frau. Aber das haben wir leider viel zu spät erfahren.“
„Moment mal, Petr Iwanowitsch“, unterbrach ihn Tschernow, „das sieht ja so aus, als sei die Kolchose oder der Vorsitzende daran schuld? Aber Ihre Frau könnte doch diese Körbe zu zweit mit einer anderen Melkerin tragen. Warum bat Ihre Frau nicht eine Kollegin, ihr zu helfen? Wer ist denn daran schuld, auch die Sowjetregierung? Übrigens, wie ist der Name des Arztes, der Ihnen das gesagt hat?“
„Das spielt doch jetzt keine Rolle mehr, unser Sohn ist bereits zwölf Jahre alt. Wir sind nicht gewöhnt zu klagen, Hauptsache, wir werden in Ruhe gelassen“, setzte Kran fort.
„Und wir“, sagte Tschernow, seinen Gesprächspartner anschauend, „wünschen auch sehr, dass Sie die Bewohner ihres Dorfes in Ruhe lassen. Besonders Sie, Genosse Kran, bitten wir eindringlich, dass Sie den Kindern nicht die Köpfe verdrehen. Wir befinden uns an der Schwelle des Kommunismus, und ihr Gläubigen zieht die Jugend zurück in die finstere Vergangenheit.“
„Geh weg, geh weg!“ wiederholte Hans, aber der fremde Mann verstand ihn nicht und beeilte sich nicht, das Haus zu verlassen. Er war im Dienst, erfüllte seine Pflicht und gab sich dabei alle Mühe. Tschernow sprach noch viel über den Schaden der Religion, niemand unterbrach ihn. Das fest an Gott glaubende Ehepaar erlebte das nicht zum ersten Mal und kannte schon den Verlauf solcher Gespräche. Als Tschernow sich alles von der Seele geredet hatte, sagte er vor dem Weggehen:
„Denken Sie daran, Sie haben zwei Töchter, und wenn Sie ihnen nicht erlauben, ein freies Leben zu führen, dann übernimmt die Sowjetregierung ihre Erziehung. Ich hoffe, Genosse Kran, Sie werden über meine Worte nachdenken.“
Anschließend stand Tschernow auf, zog seinen Pelz an und verließ Kran’s Haus.
Die Mutter der Töchter, Frau Kran, hatte sehr gut verstanden, wessen Erziehung Tschernow andeutete. Sie wusste, dass der KGB-Mann nicht an der Erziehung ihres kranken Sohnes interessiert war, sondern an der ihrer ältesten Tochter, der zehnjährigen Margarita.
Am Abend desselben Tages versammelten sich im Kabinett des Parteigruppenorganisators (Partorg) die Kommunisten. Auf der Tagesordnung stand nur ein Punkt: „Organisierte Kontrolle über die Gläubigen.“ Vorab las Genosse Tschernow den neuen Beschluss der Regierung und des Zentralkomitees der KPdSU, danach hielt er eine Rede. Anschließend hörte er sich die Meinung der Genossen an und schlug vor, aus den Reihen der Kommunisten und Komsomolzen (Kommunistische Jugend) verantwortliche Personen für die Kontrolle, wie er sich ausdrückte, der Tätigkeit der Gläubigen zu wählen.
„Als erstes findet die Organisatoren heraus“, riet Tschernow seinen geheimen Helfern. „Denkt daran, das sind unsere Feinde und gegen sie zu kämpfen, ist unsere vorderste Pflicht.“
Gleich am nächsten Tag begann die Bespitzelung der Gläubigen. Unter den einfachen Arbeitern gab es nur wenige Kommunisten, deshalb bildeten die Helfer in erster Linie die Lehrer und einigen Komsomolzen der Kolchose. Die Schuldirektion war eifrig bemüht, die Schüler, die die Versammlungen besuchten, herauszufinden. Es waren nicht viele, aber auch diese wenige galt es zu finden und von der Gemeinschaft der Gläubigen zu isolieren. In der Regel waren das Kinder gläubiger Eltern, wie zum Beispiel Margarita Kran, deren Vater einer der Organisatoren der Gottesdienste war.
Es gab im Dorf einige Dutzend Christen und sie versammelten sich in den Häusern, weil sie kein Gemeindehaus hatten. Aus diesem Grund hatten die aktiven Komsomolzen und Lehrer abends durch die Straßen zu gehen und zu beobachten, zu welchem Haus die Gläubigen gingen, um danach selbst dahin zu gehen und die Anwesenden aufzuschreiben. Eine der aktivsten Mitarbeiterinnen war die junge Lehrerin Nina Kartusina. Sie versammelte abends die Schüler der oberen Klassen und „stürmte“ mit ihnen das Haus, wo die Gläubigen versammelt waren. Sie warfen Steine gegen die Fenster und schlugen mit Stöcken gegen Türen und Fenster, um die Versammelten zu stören und zu ängstigen.
Einmal passierte folgendes: Es war Winter und sehr kalt. Als eine ältere Christin aus ihrem Haus ging und sich in die Versammlung der Gläubigen begab, bemerkte sie einen ihr folgenden „Schatten“. Da das Dorf nicht groß war und alle Bewohner einander gut kannten, kannte auch die betagte Witwe Petker ihren Verfolger gut. Sie erkannte sofort, dass dieser junge Komsomolez heute zum Spitzeldienst bestimmt war, genauer gesagt als Späher. Seine Aufgabe war zu erfahren, wo die Gläubigen sich versammelten. Die alte Frau entschied daher, den jungen Komsomolzen irre zu führen. Sie selbst war warm angezogen und schätzte, dass der Junge schneller als sie frieren würde. Sehr langsam ging sie bis zum Dorfende, während der junge Mann ihr in einer bestimmten Entfernung folgte. Dann kehrte sie um und ging ihrem Späher entgegen. Damit hatte der Jüngling nicht gerechnet und sah sich gezwungen, zum nächsten Haus auszuweichen. Frau Petker ging weiter und schaute sich vorsichtig um, um ihren Verfolger zu beobachten. Bald sah sie ihn wieder und dachte bei sich:
„Na, Junge, das wollen wir doch mal sehen, wer seinem Herrn aufrichtiger dient, du oder ich?“ Die Frau ging noch einmal die ganze Straße entlang und stellte fest, dass der Jüngling verschwunden war. Ihm war wahrscheinlich sehr kalt geworden. Erst dann ging Frau Petker schnellen Schrittes zum Ort der Versammlung.
In der Schule wurden die Kinder dazu angehalten, Pioniere zu werden. Für die ungläubigen Eltern war das nichts außergewöhnliches, für die gläubigen dagegen wurde es zu einem beunruhigenden Problem. Es litten nicht nur die Eltern, sondern vor allem die Kinder. Die Lehrer wussten, dass sie mit ihrer Werbung und Zwangsmitgliedschaft zum Pionier und Komsomol die Kinder von der Gemeinde isolieren könnten. Die Gläubigen wussten, dass das eine Organisation der Gottlosen ist und hegten Besorgnis dagegen. Sie wollten ihre Kinder davor bewahren, aber das war sehr schwierig.
Der Tochter der Eheleute Kran, Margarita, war es bis jetzt gelungen, in den ersten beiden Schuljahren das Sternabzeichen mit dem Bild Lenins nicht zu tragen. In der dritten Klasse wurde dazu angehalten, in die Reihen der Pioniere einzutreten. Das Mädchen wusste von klein auf, dass es einen großen Gott gibt, der alles weiß und sieht und der möchte, dass Kinder und Erwachsene nach seinen Geboten leben.
Jetzt, in der Zeit des aktiven Kampfes gegen die Gläubigen, war auch die Schuldirektion beauftragt, alle Schüler entsprechenden Alters als Pioniere einzuschreiben. Davon war auch Margarita betroffen. Eines Tages kam sie mit einem glänzenden Sternabzeichen aus der Schule. Die Eltern waren etwas beunruhigt. Sie wussten von ihrer Tochter, dass sie sich um keinen Preis von ihrem Heiland Jesus Christus lossagen wollte. Margarita wurde einfach gezwungen, dieses kommunistische Symbol zu tragen.
Am Abend dieses Tages las Peter Kran einen Text aus der Bibel, dann sagte er zu Margarita:
„Meine Tochter, sei nicht all zu traurig darüber, dass du gezwungen wirst, dieses Sternchen zu tragen. Denke daran, Gott möchte Herr deines Herzens sein, bemühe dich, es rein zu erhalten. Trage dieses Sternchen bitte nur in der Schule.“
Damit war das Gespräch zu diesem Thema beendet. Aber der Schuldirektor und die Lehrerin hatten ihre Pläne. Sie wollten Margaritas Eltern mit dem aufgezwungenen Sternchen prüfen. Sie wussten, dass das Mädchen zehn Jahre alt war und dass es an der Zeit sei, sie als Pionier aufzunehmen, und dazu wollten sie sie vorbereiten.
Zwei Monate trug Margarita schon das Sternchen. Ihre Lehrerin, die die gläubigen Deutsche nicht leiden konnte, beobachtete sie sehr genau, sie interessierte sich auch, was sie zu Hause machte und worüber die Eltern sprachen. Einige Schüler lachten über Margarita, weil sie mit zehn Jahren noch immer kein Pionier war.
Eines Tages, kurz bevor Margarita in die Reihen der Pioniere aufgenommen werden sollte, kam sie ohne Sternchen in die Schule. Die Lehrerin, die peinlich darauf achtete, merkte das natürlich sofort.
„Margarita, wo ist dein Sternchen?“ fragte Nina Michajlowna vor der ganzen Klasse, noch bevor der Unterricht begann. Margarita senkte den Kopf und schwieg.
„Ich spreche mit dir, Schülerin Kran, und das heißt, dass du aufzustehen hast.“
Das Mädchen stand auf, wollte aber die sie hassende Lehrerin nicht anschauen und stand deshalb mit gesenkten Augen.
„Margarita, antworte ehrlich, soviel ich weiß, dürfen die Gläubigen nicht lügen, wie auch die Pioniere – darum erwarte ich von dir eine ehrliche Antwort auf meine Frage:
„Verbieten dir deine Eltern das Abzeichen mit Lenins Abbildung zu tragen?“
Nach dieser Frage beobachtete die Lehrerin aufmerksam jeden Schüler und an den Gesichtern konnte sie sehen, wer mit Margarita sympathisierte und auch zu den Gottesdiensten ging, und wer gegen sie eingestellt war.
„Wir warten alle, Margarita, oder wirst du vor deinem Gott die Wahrheit verbergen? Denn er ist doch jetzt hier in der Klasse? So lehrt dich doch dein Papa?“
Einige Kinder fingen an zu lachen, Nina Michajlowna unterstützte sie und lächelte auch, obwohl sie in einem anderen Fall das Lachen streng verboten hätte. Margarita kamen die Tränen, so Leid tat es ihr um sich, um ihren Papa und um Gott, über den diese unglücklichen, ungläubigen Menschen sich lustig machten. Sie hob die Augen, schaute die Lehrerin an und sagte mit klarer Stimme:
„Die Eltern verbieten mir nichts und das Sternchen habe ich verloren.“
„Danke für die Ehrlichkeit, aber vielleicht erklärst du uns, wie du es verlieren konntest, es war doch fest an deiner Schulschürze angeheftet?“
Margarita stand da und weinte. Sie konnte dieses demütigende Verhör vor der ganzen Klasse nicht ertragen. Keiner unterstützte sie, im Gegenteil, fast alle verlachten und verspotteten ihre Mitschülerin. „Gut, Kran, nimm Platz, wir sprechen mit dir noch nach dem Unterricht“, sagte die Lehrerin und fing mit dem Unterricht an. Margarita wusste, was sie nach Schulschluss erwartete, sie dachte über ihre Lage nach und betete leise.
Als es endlich klingelte und alle Kinder aus der Klasse liefen, sagte die Lehrerin zu Margarita:
„Du gehst noch nicht nach Hause, sondern folgst mir ins Lehrerzimmer.“
Dort erwarteten sie schon der Schuldirektor und die Pionierleiterin.
„Nun, dann erzähl uns mal, Margarita, was bei dir zu Hause vorgefallen ist?“ fragte der Direktor.
„Nichts“, sagte Margarita und wurde rot vor Aufregung.
„Margarita, wir verstehen, dass du es nicht leicht hast“, fuhr der Direktor fort, „aber glaub uns, wir möchten dir helfen. Unsere Sowjetregierung tut alles Mögliche, damit ihr Kinder ein gutes und interessantes Leben habt. Wir Lehrer sind eure treue Freunde, wir wollen, dass auch du eine glückliche Kindheit hast. Aber du musst dafür deinen guten Willen zeigen.“
Margarita hörte zu und schwieg. Sie wusste schon in ihrem jungen Alter, dass es keinen Sinn hatte, diesen Leuten zu widersprechen. Aber in der Tiefe ihrer Seele hatte sie ihre feste Überzeugung und ihre eigene Meinung. Während der Direktor ihr über die Wichtigkeit der kommunistischen Erziehung erzählte, dachte Margarita darüber nach, wie sie den Vorfall mit dem Sternchen erklären sollte. Sie wollte nichts verheimlichen und alles so erzählen, wie es sich zugetragen hatte. Als sie wieder nach dem verlorenen Sternchen gefragt wurde, gestand Margarita treuherzig, dass das Abzeichen zusammen mit dem Zimmermüll in den Ofen gelandet sei. Sie sagte auch, dass ihr das keiner aufgetragen hatte, sondern der Stern abhanden gekommen sei, als sie den Fußboden gekehrt hatte.
„Woher weißt du denn, dass das Sternchen in den Ofen gekommen ist, wenn es, wie du sagst, aus Versehen geschah?“
„Als ich den Müll in den Ofen auf die brennenden Kohlen schüttete, sah ich etwas glänzen und erkannte das Sternchen, konnte es aber nicht mehr herausholen.“
Im Lehrerzimmer wurde es still. Nina Michajlowna wurde rot wie ein Krebs und schaute mit ihren bösen Augen auf Margarita, als ob sie vor sich den schlimmsten Feind hatte.
Der Direktor dachte nach, mit dem Bleistift auf dem Tisch klopfend. Dann, nach einer kurzen Pause, sagte er, Margarita anschauend:
„Weißt du auch, Mädchen, was du gemacht hast? Du hast das Abzeichen mit der Abbildung des Revolutionsführers verbrannt!“
„Gestehe sofort, wer hat dir das befohlen zu tun?“ schrie nun Nina Michailowna und rückte ganz nahe an Margarita heran.
„Ich habe Ihnen die Wahrheit gesagt“, antwortete Margarita und weinte.
„Nun gut“, sagte der Direktor, „reg dich nicht auf, Margarita, Nina Michailowna war etwas hitzig zu dir, was aber nicht heißt, dass sie dir Böses wünscht. Wir alle sind besorgt um dich, wir wollen, dass du froh und glücklich wirst. Und jetzt trockne deine Tränen und geh nach Hause, bald bist du ein Pionier und dann wird keiner mehr über dich lachen.“
Der Direktor bemühte sich zu lächeln, aber Margarita merkte, dass sein Lächeln ein künstliches, ohne Wärme und Liebe war.
Als die Schülerin Kran das Büro verlassen hatte, sahen sich die besorgten Pädagogen fragend an.
„Ja, eine unangenehme Geschichte“, sagte der Direktor und wer weiß, wie die RONO (Kreisabteilung für Volksbildung) und das Kreiskomitee darauf reagieren werden, wenn sie die Geschichte erfahren.“
„Pawel Sergejewitsch“, sagte Margaritas Lehrerin, „wir müssen die Wurzel allen Übels erkennen.“
„Was meinen Sie damit, Nina Michailowna?“
„Nicht was, Pawel Sergejewitsch, sondern wen? Es ist doch sonnenklar! Die Gläubigen und in erster Linie Margaritas Vater sind an allem Schuld. Mich wundert nur, dass der Dorfrat und das Kreiskomitee so lange mit ihnen Geduld haben!“
Schon am nächsten Tag wussten sie im Kreiskomitee der Partei, wo alle Angelegenheiten bearbeitet wurden und woher alle Beschlüsse ausgingen, über diesen kleinlichen, aber im politischen Sinn so wichtigen Vorfall Bescheid. Ein paar Tage später, am Samstag, gab das örtliche Radio den Dorfbewohnern mehrmals bekannt, dass am Abend im Klub eine Zusammenkunft der Bürger stattfinden würde. Die Tagesordnung lautete: „Beurteilung einer Bürgergruppe, die antisowjetische Propaganda betreibt.“
Die Organisatoren hatten sich sehr gut auf diese Versammlung vorbereitet. Besonders interessiert am Erfolg der Versammlung war Tschernow, obwohl er selbst nicht anwesend war. Es sollte so aussehen, als ob die Initiative vom Volk, das heißt von den Dorfbewohnern ausgehe.
Die Versammlung war für acht Uhr abends angesetzt. Auf der Bühne stand ein langer Tisch, der mit einem roten Tischtuch bedeckt war. Am Tisch saßen die Ankläger: der Vorsitzende des Dorfrates, der Sekretär des örtlichen Parteikomitees, der ehemalige Vorsitzende Genosse Himburg, ein Veteran und Kommunist, und noch einige Kolchosbauern. Alle diese Genossen saßen auf der Bühne als wichtige und ehrenhafte Vertreter der Macht und Justiz.
Auf der ersten Bank, vor der Bühne, saßen die Angeklagten, die als sowjetfeindlich galten. In Wirklichkeit waren das die gewissenhaftesten Arbeiter. Sie stahlen nicht, soffen nicht wie sogar einige aus den Reihen der Kommunisten und verweigerten keine Arbeit. Ihr einziges „Verbrechen“ bestand darin, dass sie an Gott glaubten. Da es unter den Deutschen nur wenige Parteimitglieder gab, hatte man sie einzeln im ganzen Raum verstreut, damit es so aussah, als ob im Raum viele Ankläger seien. Die Lehrer saßen natürlich auch zwischen der Bevölkerung und waren gut informiert, worüber sie reden sollten.
Auf der Bank der Angeklagten saß auch Margaritas Vater. Er wusste schon, dass er der „Hauptverbrecher“ war und die Verurteilung mit ihm beginnen würde.