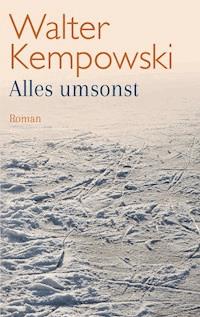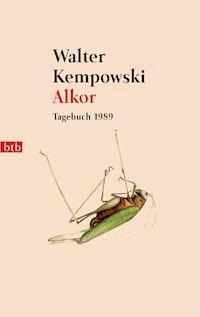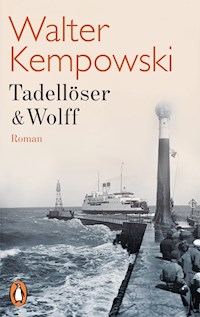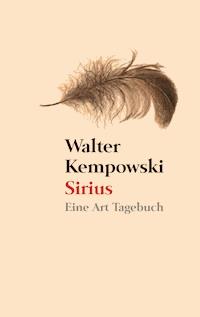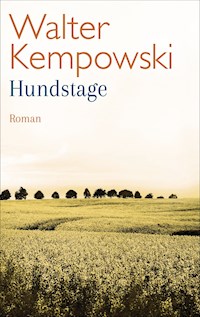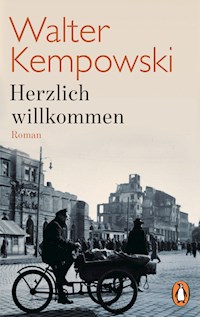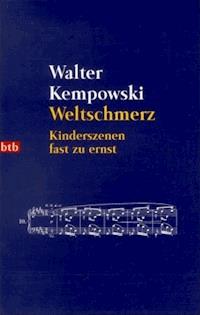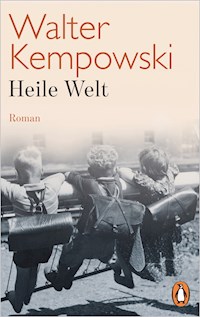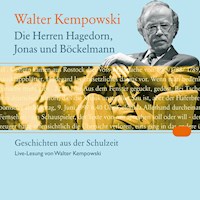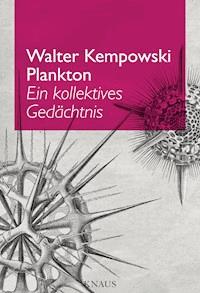12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Weitere Romane
- Sprache: Deutsch
Ein deutscher Journalist auf den Spuren seiner Familie in Ostpreußen
Jonathan Fabrizius, Journalist in Hamburg, erhält kurz nach dem Fall der Mauer den Auftrag, nach Ostpreußen zu reisen. Dieses Land ist ihm fremd, obwohl seine Mutter dort am Ende des Krieges ums Leben gekommen und sein Vater auf der Frischen Nehrung gefallen ist. Nach einigem Zaudern akzeptiert Jonathan den Auftrag. Doch auf das, was ihn in Polen erwartet, ist er nicht vorbereitet. Denn die Vergangenheit ist nicht vergangen, die Wunde nicht verheilt. Wie ein Schock reißt diese Erfahrung Jonathan aus der Routine seiner feuilletonistischen, bundesrepublikanischen Existenz.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 236
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Über das Buch:
Jonathan Fabrizius, Journalist in Hamburg, lebt von gelegentlichen Aufträgen und der Unterstützung, die ihm ein wohlhabender Onkel gewährt. Eine Autofirma macht ihm das Angebot, nach Ostpreußen zu reisen, um eine PR-Tour vorzubereiten. Dieses Land ist Jonathan fremd, obwohl seine Mutter dort am Ende des Krieges ums Leben gekommen und sein Vater auf der Frischen Nehrung gefallen ist. Nach einigem Zaudern akzeptiert Jonathan das Angebot und entkommt auf diese Weise seiner Freundin Ulla, einer Kunsthistorikerin, die ihm mit den Vorbereitungen zu einer Ausstellung über die „Grausamkeit in der Kunst“ auf die Nerven fällt.
Der neue Achtzylinder der Santubara-Werke wird von einem Ex-Rennfahrer gesteuert, mit von der Partie ist auch noch die anstrengend-geschwätzige Pressefrau des Autokonzerns. Mit hinreißender Komik werden die Pannen und Abenteuer des seltsamen Trios erzählt. Im Verlauf der Fahrt tritt eine andere, tiefere Dimension immer deutlicher hervor. Jonathan erkennt, wie sehr dieses Land von deutscher Kultur – und deutscher Schuld – geprägt ist: die Marienburg, aber auch die Wolfsschanze, der ehemalige Führerbunker im Osten, sind Stationen der Reise.
Mit zunehmender Dauer erweist sich die Reise auch als eine Erkundung der eigenen Befindlichkeit, ihrer Widersprüche und Abgründe. Das Vergangene ist nicht vergangen. Wie ein Schock reißt Jonathan diese Erfahrung aus der Routine seiner feuilletonistischen Existenz.
Über den Autor:
Walter Kempowski, geboren am 29. April 1929 in Rostock, starb am 5. Oktober 2007 in Rotenburg an der Wümme. Er gehört zu den bedeutendsten deutschen Autoren der Nachkriegszeit. Einem breiten Publikum bekannt wurde er durch seinen Roman „Tadellöser & Wolff“, der auch verfilmt wurde. Seine monumentale Collage „Das Echolot“ war 1993 eine literarische Sensation und fand zwölf Jahre später mit der Veröffentlichung des zehnten Bandes, der die Bestsellerliste stürmte, ihren krönenden Abschluss. Der letzte zu Lebzeiten des Autors veröffentlichte Roman „Alles umsonst“ brachte Walter Kempowski auch internationale Anerkennung.
Im Knaus Verlag erschienen in über dreißig Jahren zahlreiche Romane, Erzählungen, mehrere Tagebücher und Befragungsbücher. Eine Übersicht über Walter Kempowskis Gesamtwerk befindet sich am Ende des vorliegenden Romans.
Walter Kempowski
Mark und Bein
Roman
Knaus
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
Copyright © 1992, 2008, 2016 beim Albrecht Knaus Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Covergestaltung: Bürosüd
Covermotiv: Gettyimages / H. Armstrong Roberts/ClassicStock
Für Robert
Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer denn kein zweischneidig Schwert, und dringt durch, bis daß es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens.
Hebr. 4,12
Inhaltsverzeichnis
1
In Hamburg, in der Isestraße, gibt es noch eine ganze Reihe stattlicher Wohnhäuser aus der Zeit der Jahrhundertwende, hinter alten, schwarzen Kastanien stehen sie, mit frühlingshaften Stuck-Ranken verziert, fünf, sechs Stockwerke hoch, herrschaftlich gebaut, mit einer triumphierenden Jahreszahl am Giebel. Die Treppenhäuser sind gekachelt, und altersschwache Aufzüge ruckeln darin hinauf und hinunter, deren Türen aus Schmiedeeisen gemacht sind. Wie in Paris kommt man sich vor, wenn man in ihnen hinauf- oder hinunterruckelt, wie in Paris, London oder Mailand.
Die Isestraße wäre nicht «stehengeblieben» im Krieg, wenn die Bombenschützen der alliierten Luftflotten eine hundertstel Sekunde früher oder später auf den Auslöseknopf gedrückt hätten. Ringsumher Feuersturm, Explosionen und Verschüttungen – die Isestraße blieb stehen, und sie steht noch heute, mit gekachelten Treppenhäusern und ruckelnden Aufzügen, trotz Spekulantentums und Renovierungssucht.
Durch die von den übergroßen Kastanien in vornehmem Schatten gehaltene Straße – und das ist etwas Besonderes – donnert alle fünf Minuten die Hochbahn über stählerne Schienenträger, die von den Antiquitätenhändlern der Gegend wohl schon längst ihrer Jugendstilverzierungen beraubt worden wären, wenn sich das hätte machen lassen. Unter der Hochbahn werden Autos geparkt, und zweimal die Woche ist dort Bauernmarkt, mit blassem Schlachtgeflügel, Schwarzwälder Steinofenbrot und unreifen Südfrüchten.
Vorn die Hochbahn und hinter den Häusern der Isebek-Kanal, ein stillgelegter trüber Seitenarm der Alster, auf dem Touristen mit Tretbooten umherfahren.
In einem dieser Häuser wohnte Jonathan Fabrizius, von seinen Freunden «Joe» genannt, dreiundvierzig Jahre alt, mittelgroß, ein Mensch, der sich sein gescheiteltes Blondhaar vom Haarschneider kürzen und nicht von einem Hair-Styler stylen ließ.
Das beste an ihm waren seine Augen. Ohne durch Mikroschielen oder astigmatische Krümmungen behindert zu sein, weder kurz- noch weitsichtig, registrierte er alles, was ihm begegnete. Zwar waren seine Ohrläppchen immer etwas unsauber. Auch hatte er sich schon mal in einen Papierkorb erbrochen – seine Augen aber waren hell und klar, und das sahen auch die Menschen, die mit ihm zu tun hatten.
«Er mag sein, wie er will», sagten diese Leute, «aber irgendwie … ich weiß es nicht …»
Jonathan hatte allerhand studiert, Germanistik, Geschichte, Psychologie und Kunst. Er war hineingestiegen in die Streben der alten Mühle, immer höher hinauf ins staubige Gebälk, und er hatte hinausgeguckt aus den spinnenblinden Schlitzfenstern, über die satte Ebene hinweg, und Klarheit und Wahrheit waren über ihn gekommen. Und da saß er nun mit seiner Klarheit und Wahrheit, und er sah sich um: Was sollte er beginnen mit der Veredelung seiner Ganglien? Wozu sollte sie ihm taugen?
Immatrikuliert war er noch, das hatte was mit der Krankenversicherung zu tun, aber das Studieren hatte er aufgegeben. Er lebte von Zeitungsartikeln, für die er von Magazinen und Zeitschriften regelmäßig Aufträge erhielt, denn die Redakteure schätzten den Schmiß seiner Diktion und die Pünktlichkeit, mit der er ablieferte. Leben konnte er nicht von diesen Aufträgen, das hatte er auch gar nicht nötig, denn er bekam einen monatlichen Wechsel von seinem Onkel, der in Bad Zwischenahn eine Möbelfabrik besaß, in der preiswerte Auszieh-Schlafcouchen einfachsten Zuschnitts hergestellt wurden, für die sich noch immer Abnehmer hatten finden lassen.
Jonathan bewohnte das hintere Zimmer der Wohnung, mit Blick auf den Isebek-Kanal, seine Gefährtin Ulla wohnte nach vorn, zur Straße hin. Die Schiebetür, die die beiden großen Räume verband oder trennte, wie man’s nimmt, war zugestellt, auf Jonathans Seite mit einem schadhaften Ledersofa, bei Ulla hingegen mit einer Bücherwand und einer Stereoanlage, aus der, besonders abends, altvertrauter Wohlklang strömte, auf den Ulla Wert legte: Das Es-Dur-Klavierkonzert oder die Prager Symphonie, immer wieder, und der Kickser des Horns immer an derselben Stelle. Über ihrem Biedermeiersofa hingen in Gold gerahmte Bleistiftskizzen von Du Bois, und über dem Couchtisch verbreitete eine französische Lampe mit orangerotem Glasschirm behaglichen Schein.
Jonathan besaß weder eine Stereoanlage noch eine Sitzecke. Das große Ledersofa, auf dessen Sitzfläche Roßhaar aus einem Hakriß sproß, war sein wichtigstes Möbelstück. Hier schlief er, hier verkleckerte er seinen Yoghurt, und hier las er populärwissenschaftliche Literatur der verschiedensten Sparten, damit er den Überblick behielt, wenn er auch nicht recht wußte: wofür. Auf einem weißen Küchentisch vor dem Sofa stand die offene Hämmerschreibmaschine, deren e nicht funktionierte. Daneben Zeitungen und Bücher und eine Untertasse mit Streichhölzern, benutztes Ohropax, gebrauchte Socken. Von der Decke herunter, aus einem verstaubten Stuckkranz heraus, hing eine schirmlose Glühbirne, die gab genügend Licht.
Der Parkettfußboden seines Zimmers war mit Stragula belegt. Jonathan hatte den abstrakt gemusterten Belag herausreißen wollen, weil der Holzfußboden darunter nicht atme, wie er meinte, ein großes Stück hatte schon dran glauben müssen, dann hatte seine Freundin jedoch festgestellt, daß es sich bei dem Design des Bodenbelags um eine interessante Arbeit aus den frühen Dreißigern handelte, Wladimir Kolaschewski, also aufhebenswert! Seither wirkte sein Zimmer mit dem ruinierten Fußbodenbelag recht provisorisch, so als hätte man die Handwerker nicht bezahlen können. Jonathan starrte hin und wieder nägelkauend auf das Stragula-Muster. In seiner Phantasie stellte es eine Landkarte dar mit Straßen, Flüssen und Städten, Anreiz für längere Gedankenspiele. Schade, daß das herausgerissene Stück nicht mehr vorhanden war, man hätte es einrahmen und an die Wand hängen können.
Statt dessen hing an der Wand ein Gemälde von Botero, ein feistes Kind in duffen Farben. Jonathan hatte es in den Sechzigern erworben und hundertmarkweise abgestottert. Gelegentlich fragte ihn der Händler, von dem er es gekauft hatte, ob er es noch braucht? Ob er es nicht wieder abstoßen will?
Auf dem klebrigen Fußboden, die Wände entlang, lagen Bücher unordentlich aufgeschichtet, das Material für eine größere Arbeit über nordische Backsteingotik: ein Unternehmen, das ihm etwas aus dem Blick geraten war. Die Zeitschrift, für die er sie schreiben wollte, hatte nur zurückhaltendes Interesse gezeigt. Es war eine süddeutsche Zeitung gewesen, deren Redakteure Stralsund und Wismar nicht auseinanderhalten konnten. Die Fotos von den ungeschlachten Riesenbauten hatten eher etwas Abstoßendes für sie: Kolberg, das ungefüge Schleppdach und außerdem kaputt?
Ein Spind mit zerknautschten Sakkos, und daneben eine abenteuerliche Waschecke. Sie war mit einem Plastikvorhang, der an einem dünnen Rohr sich schieben ließ, vom Zimmer abgetrennt. Wenn Jonathan sich in dem verkrusteten Becken die Hände wusch, konnte er aus dem Fenster sehen, und da fiel dann sein Blick auf eine Trauerweide, deren Zweige in das trübe Wasser des Isebek-Kanals hingen. Schwäne standen nicht darunter, aber doch zumindest Enten.
Die restlichen Zimmer der Wohnung gehörten einer Generalin. Sie stammte aus dem Osten, selten kam sie heraus aus ihren dunklen Grüften, in denen sie den Erinnerungen an eine längst vergangene Zeit lebte. Hin und wieder war feuchter Husten zu vernehmen, von dem sie sich in den Küchenausguß hinein befreite.
Jonathans Lebensgefährtin hieß mit vollem Namen Ulla Bakkre de Vaera. Sie stammte, obwohl dunkelhaarig, aus Schweden und trug gern einen langen Strickrock, in allen Farben quergestreift, dazu ein blankgewetztes Herrenjackett aus Kammgarn, in dessen Kavalierstasche eine silberne Arbeiteruhr steckte. Ulla hatte ein hübsches rundes Gesicht, in dem sich die Jahre noch nicht gesetzt hatten, lieb auf den ersten Blick und fest auf den zweiten. Ihr ganzer Kummer war der linke große Schneidezahn, dem vor Jahren der Nerv entfernt worden war und der nun nachdunkelte und ihren mädchenhaften Zügen einen Makel zufügte. Morgens sah sie sich diesen Makel an, im Spiegel. Dann war sie für einen Augenblick traurig. Ausreißen? oder überkronen? das war die Frage nun schon Jahr um Jahr …
Ulla Bakkre de Vaera besaß einen feinen Ring, eine abgewetzte Kamee auf einem caramelfarbenen Stein, den hatte sie von ihrem Vater. Er stammte aus dem zweiten Jahrhundert vor Christus, wie seit Generationen behauptet wurde, und hätte eigentlich auf eine Seitenlinie der Familie vererbt werden sollen. Dieser Ring war es gewesen, dem sie die Teilzeitbeschäftigung im städtischen Kunstmuseum zu verdanken hatte. Sie studierte nämlich Kunstgeschichte und finanzierte ihr Studium selbst. Obwohl dem Museumsdirektor ein Brief ihres Vaters vorgelegen hatte, der für gut Wetter sorgen sollte, hatte Dr. Kranstöver sie schon ablehnen wollen, wie sie da saß in seinem Büro – eine Idee zu hübsch? –, aber da war dann sein Blick auf den Ring gefallen, und das hatte den Ausschlag gegeben. Ulla kriegte den Job. Sie durfte also ausländische Gäste führen, Kataloge redigieren und bei Ausstellungseröffnungen diskret in einer Ecke stehen und dem Direktor anerkennend zunicken. Irgendwann einmal würde er mit ihr essen gehen, damit war zu rechnen.
Sie hatte auch beim Entwurf einer Kinder-Museumsecke helfen dürfen, mit Tastobjekten, Glubberteppichen und einer Rutschbahn von der Art, wie man sie früher in Schuhgeschäften sah. Heranwachsenden war es gestattet, hier mit bunter Kreide die Wände zu bemalen, Kunstwerke, die leider nicht ins Magazin aufgenommen werden konnten, da sie des Morgens von kopfschüttelnden Raumpflegerinnen beseitigt wurden.
Im Augenblick bereitete Ulla eine Ausstellung vor über die Grausamkeit in der bildenden Kunst. So standen denn in ihren Regalen Bücher mit Abbildungen von allen möglichen Inquisitionstorturen, dem Dreißigjährigen Krieg, und natürlich war auch Goya vertreten mit seinen spanischen Skizzen. Hier hatte sie auch ihre Sachkartei untergebracht, die mit A (Ausweiden) begann und mit Z (Zahnausbrechen) endete. Eine Grausamkeitensammlung, die keinen Aspekt menschlicher Infernalität unberücksichtigt ließ. Nicht nur mittelalterliche Tafelbilder, auch die Tageszeitungen lieferten Material für ihr Interesse: Polizisten in moderner Rüstung, blutverschmierte Terroropfer und Neger in Südafrika mit angezündeten Autoreifen um den Hals. Auf die Neger war das Augenmerk schon mal zu richten, denn eine künstlerische Objektivierung dieser Lynchspezialität stand zu erwarten.
All diese schrecklichen Bilder, die keinesfalls zur Seite gelegt wurden, wenn Jonathan das Zimmer betrat, beeindruckten Ulla nicht im geringsten, sie betrachtete an ihnen eher das Formale, so wie sie es in ihrem Studium gelernt hatte, die Diagonalen zum Beispiel, von denen extremste Martern mit Heilsdingen verbunden wurden, oder Gewichtigungen durch Licht und Schatten, vom Künstler kaum beweisbar vorgenommen, um dem Betrachter eine weiterbringende Aussage zu vermitteln. Die Ausstellung dieser Zeugnisse sollte nicht das Niedere im Menschen anstacheln, sondern Abscheu wecken und darüber hinaus die energische
2
An einem kühlen Morgen, im August 1988, sprang Jonathan an der Reinemachefrau vorüber die Treppen hinauf. Er hatte auf dem Markt eine Tüte Brötchen gekauft und einen Blumenstrauß. Beim Hinaufspringen, immer drei Stufen auf einmal, riffelte er mit dem Zeigefinger der linken Hand an den Seerosenkacheln des Treppenhauses entlang. In der Rechten hielt er die Blumen und die Tüte mit den Brötchen. Die Blumen waren für seine Freundin bestimmt, die heute neunundzwanzig Jahre alt wurde. Drei Jahre hielt sie es nun schon bei ihm aus (wie sie es ausdrückte), obwohl eigentlich er es war, der hier was auszuhalten hatte.
Ulla lag noch im Bett. Daß es bereits auf zehn Uhr zuging, wußte sie, und daß Jonathan die Brötchen holte, hatte sie schon mitgekriegt. Sie lag noch immer im Bett, weil das an diesem Tag ihr gutes Recht war. Sie dachte an ein Puppenhaus, das sie im Lehmweg gesehen hatte, mit Bibliothek und Herrenzimmer, es ließ sich auf Knopfdruck zerstören: als Therapie für Kinder gedacht, deren Destruktionstrieb damit abzureagieren war. Spielzeug interessierte Ulla von jeher: Figuren mit Rauchpatronen hinten drin, Aufziehtiere, die mit den Zähnen fletschten. Auch daß es zur Feier der Französischen Revolution kleine Guillotinen zu kaufen gab, war von Interesse. Da mal nachhaken! Sich so ein Ding besorgen und dem Direktor des Museums als «Objekt» für ein Environment anbieten.
Nun rumorte Jonathan in der Küche, und kurz darauf brach er in die dumpfe Atmosphäre ihres Dämmerschlafes ein. Er ratschte die Gardine zur Seite und setzte sich auf ihren Bettrand. Hier war nun zu gratulieren. Die Peinlichkeit der kleinen Zeremonie überspielte Jonathan durch angelernte Ungeschicklichkeiten sowie dadurch, daß er die Freundin mit der Rechten zwar irgendwie liebkoste – Toten drückt man so die Augen zu –, mit der Linken jedoch den Frühstückstisch deckte und die Eier aufstellte. Zum Anzünden der Kerze und Herrichten des kleinen Blumenstraußes mußte er aufstehen, womit die kleine Feier beendet war.
Er goß Kaffee ein und schüttelte die Brötchen in den Korb. Dann entnahm er der Brieftasche sein Geburtstagsgeschenk, eine winzige Radierung von Callot, auf der eine Zersägung dargestellt war. Er gab ihr das briefmarkengroße Blatt, wobei er sie scharf ansah, was sie dazu sagt, daß er ihr so was Schönes schenkt. Und er hatte ins Schwarze getroffen! Ulla verschlang die Zersägung mit den Augen – «süß!» – und stellte sie an den Schaft des Kerzenleuchters, damit sie sie immer und immer wieder betrachten kann. Und dann zog sie ihren Freund zu sich herab und gab ihm Küsse wie feurige kleine Geldstücke, und dazu hielt sie seinen Kopf in beiden Händen.
Als ihm die Freiheit wiedergegeben war, zog er die Post aus der Jackentasche und sortierte sie: Fünf Briefe waren an das Geburtstagskind gerichtet, zwei an ihn. Sie setzte sich auf, strich sich ein Brötchen mit Honig und las die Briefe, in denen das stand, was sich denken läßt.
Auch Jonathan wurschtelte seine beiden Briefe mit dem Zeigefinger auf. Der eine war von den Santubara-Autowerken in Mutzbach, offenbar eine Reklamesache, der andere von seinem Onkel Edwin aus Bad Zwischenahn. Er enthielt einen Scheck über zweihundert Mark und den Vorschlag, damit an diesem Tag irgend etwas Sinnvolles anzufangen.
«Leistet Euch was», schrieb der Onkel, «genießt das schöne Leben.»
Verwickelte Gefühle hinderten Jonathan daran, seiner Freundin, die mit ihren Briefen arg beschäftigt war, den Scheck zu zeigen. Er beließ ihn im Kuvert, das er rasch in die Tasche steckte.
Während Ulla geordneten Familienverhältnissen entstammte, mit Bausparkasse und goldgerahmten Ahnenbildern, war Jonathan im Februar 1945 in Ostpreußen geboren, und zwar auf einem Treckwagen, bei eisigem Wind und scharfem Eisregen. Die junge Mutter war dabei «draufgegangen», wie Jonathan es ausdrückte.
«Meine Eltern habe ich nicht gekannt», sagte er meist gleichmütig, «meinen Vater hat es auf der Frischen Nehrung erwischt, und meine Mutter ist bei meiner Geburt draufgegangen, in Ostpreußen, neunzehnhundertfünfundvierzig», was ihm vor seinen Freunden einen Leidensvorsprung sicherte, der nicht zu übertreffen war.
Sein Onkel hatte den mit einem Teppichdach versehenen Treckwagen gefahren, damals, im kalten Februar, als das Unglück geschah, den Wagen mit der sich im Stroh wälzenden Schwangeren. Vergebens hatte er an die Türen von Bauernhäusern geklopft, als die Wehen einsetzten, und so war sie dann eben gestorben.
Die Leiche war im Vorraum einer Dorfkirche abgelegt worden, neben dem Kasten mit den hölzernen Gesangbuchnummern, rasch und ohne Formalitäten, und man war weitergefahren. Zufällig hatte sich eine kräftige Bauersfrau gefunden, die ihr eigenes Kind verloren hatte und für einen Platz auf dem Wagen statt dessen nun Jonathan stillte. Auch das stellte sich Jonathan vor: die schwere Frau auf dem Wagen sitzend, und er an ihrer großen Brust, und diese Vorstellung deckte sich einigermaßen mit der Realität.
«Mich hat Mutter Erde gesäugt», dachte er ab und zu, und dann reckte er sich und fühlte neue Kraft in seinen Adern.
Heute nun hatte Onkel Edwin zweihundert Mark geschickt – die neue Schlafcouch Avanti hatte sich als Renner erwiesen.
«Leistet Euch was Sinnvolles»? – das würde sich machen lassen.
Auch Ulla hatte inzwischen ihre Post gelesen: die herrische Mutter, der weiche Vater, der Psychologen-Bruder in Berlin und Evchen, das Patenkind, deren Gratulationsbrief – «wie geht es Dir, mir geht es gut» – ungelenk geschrieben und mit Marienkäfern verziert war.
Sie stieg aus dem Bett und trat an das Bücherregal, in dem das Geschenk stand, das sie sich selber gemacht hatte, eine Fünfziger-Jahre-Vase, dänisch, über die sich die beiden nun freuten. Sie wurde ins Licht gehalten, vielfach gedreht und rühmend als «scheußlich» bezeichnet, dann, als es genug war, ins Fenster gestellt, in dem schon andere Horribilitäten standen, die spottbillig gewesen waren, nun jedoch einen gewissen Wert repräsentierten, vorausgesetzt, daß man sie noch ein paar Jahre dort stehen ließ.
Jonathan wurde nochmals umarmt und darüber aufgeklärt, daß die kleine Radierung von Callot «genau das Richtige» gewesen sei, dann war er entlassen. Er ging also nach drüben, was er gerne tat, da nun das Geburtstagskind mit dem Telefonieren begann, dessen Halbdialoge ihn nicht interessierten.
Jonathan setzte sich auf sein Sofa. Er blies Staubflocken vom Tisch und «guckte sich fest» «, das helle Fenster, gegenüber, und an der weißen, schmuddeligen Wand das feiste Kind.
Er gähnte, und sein Blick schwamm über die phantastische Stragula-Geographie seines Fußbodens, und er sah den Isthmus von Korinth, diesen haarsträubenden Durchstich durch den Fels, ein kleines Schiff sah er und die steilen Wände links und rechts.
Das Wasser fließt, dachte er, und das Schiff glitt wie durch einen Sog beschleunigt den Kanal hinunter.
Er gab sich einen Ruck und las den Brief der Santubara-Werke, und es stellte sich heraus, daß es sich keineswegs um eine Reklamesache handelte, sondern um ein ernst zu nehmendes Angebot.
Man bewundere schon seit geraumer Zeit seine unbestechliche Feder, schrieb ein Herr Wendland von der Presseabteilung der Autofabrik, ob Jonathan nicht Lust und Laune habe, mal nach Ostpreußen zu fahren? Nach Masuren, genauer gesagt, also in das jetzige Polen? Die Sache sei die, daß die Santubara-Werke mit Motorjournalisten eine Testtour unternehmen wollten, damit sie sich endlich einmal von der außergewöhnlichen Qualität ihrer neuesten Achtzylinder überzeugen könnten. Eine solche Tour müsse natürlich gut vorbereitet werden, ob er dabei nicht helfen wolle? Er könne die vorbereitende Probetour begleiten und kulturell mal abschmecken, ob vielleicht was Sehenswertes in der Gegend herumsteht, Gutsschlösser vielleicht, Kirchen oder Burgen, deren Existenz und Geschichte eine solche Tour anfetten könnten, irgendwie. Und dann einen einfühlsamen Text darüber schreiben von sagen wir zwölf Schreibmaschinenseiten – «Masuren heute» –, der geeignet wäre, die Journalisten davon zu überzeugen, daß es interessant sein kann, sich in dieser gottverlassenen Gegend etwas umzutun und bei der Gelegenheit die neuen Achtzylinder zu testen. Er sei in allem gänzlich frei, und man könne ihm fünftausend Mark bieten, plus Spesen. Fahrt und Unterkunft natürlich frei, fünftausend also, plus Mehrwertsteuer, worüber sich außerdem noch reden ließe.
Masuren? Polen? – Jonathans erste Reaktion war nein! Wenn es eine Fahrt durch Spanien gewesen wäre oder Schweden. Aber Polen?
Nein.
Oder doch? Fünftausend Mark? Über die sich außerdem noch reden ließe?
Jonathan nahm sich den Iro-Weltatlas von 1961 vor, den er immer noch benutzte, weil er ihn nun einmal hatte, und schlug die Karte «Deutsche Ostgebiete unter fremder Verwaltung» auf. Ganz schöner Brocken, dies Ostpreußen … Wie sonderbar und widernatürlich, die auf einem Lineal gezogene Linie quer durch. So was kannte man allenfalls von Kolonialafrika oder aus der Antarktis! aber mitten in Europa? – Jonathan mußte an Sezierschnitte denken, in der Pathologie, die man mit einem Skalpell in einen schieren weißen Frauenleib legt.
Die Frische Nehrung, auf der es seinen Vater erwischt hatte, und die Kurische Nehrung … Bilder aus alten Erdkundebüchern fielen ihm ein: Wanderdünen, Elche. Ein Fischer, der auf seinem umgedrehten Boot sitzt und ein Netz flickt. Bernsteintagebau.
Doch die Pest ist des Nachts gekommen Mit den Elchen über das Haff geschwommen.
Jonathan suchte den Ort Rosenau, sein Finger fuhr die Straße entlang: Hier war es passiert: Hier hatte er das Licht der Welt erblickt, auf Kosten seiner Mutter. Hier, in der Kirche dieses Dorfes war sie niedergelegt worden, und dann auf dem Kirchhof verscharrt, vielleicht an der Mauer, unter einem Goldregenstrauch, die junge Frau. Ein einziges Foto gab es noch von ihr, Olympiade 1936, es hatte die Flucht überlebt: ein junges Mädchen in BDM-Uniform, die Baskenmütze schräg auf dem Ohr. Mit einem Reißbrettstift hatte Jonathan es an die Wand geheftet. – Das letzte Bild seines Vaters, ein junger Deutsche-Wehrmacht-Leutnant mit Dienstmütze in Feldausführung, lag in einer Mappe, in der auch Jonathans Geburtsurkunde lag sowie die Police seiner Fahrrad-Versicherung.
Man würde die Tour von Danzig aus beginnen, stand in dem Brief der Santubara-Werke. Von Hamburg nach Danzig fliegen, und dort steht dann das Auto, mit dem die Strecke abgefahren wird. Und da könne er dann in Ruhe seine Notizen machen.
Danzig? dachte Jonathan, Danzig würde er brauchen können für seinen Essay über die Backsteingotik: «Die Riesen im Norden». Die Marienkirche war eine von den Riesen im Norden, die ihm noch in seiner Sammlung fehlte. Lübeck, Wismar, Stralsund, diese Städte hatte er sich angesehen, mit ihren mittelalterlichen Kolossen, alles schön und gut, aber von Danzig war keine sinnliche Anschauung vorhanden, sie in einem Essay zu beschreiben, damit würde er sich schwertun.
Wenn er den Auftrag annähme, würde er zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und den bekannten Veredelungsvorgang in Gang setzen: Geld verdienen und damit Kenntnisse erwerben, die später dann wiederum zu Geld zu machen sind.
Jonathan wusch sich die Hände wie ein Chirurg. Dabei sah er aus dem Fenster. Drüben, jenseits des Isebek-Kanals, schwärmte eine Schulklasse aus, von einer Lehrerin ängstlich beisammengehalten: «Fallt da nicht rein!», und am Himmel stand ein riesiges Flugzeug, das befand sich im Landeanflug auf Fuhlsbüttel.
3
Um drei Uhr holte Ulla ihren Freund zum Spaziergang ab: «Du mußt hier mal wieder lüften …», sagte sie, trat hinter ihn und wendete die Zettel auf seinem Tisch um, was er da für einen Blödsinn aufzuschreiben hat. Gebärmutter? Das Kirchenschiff mutet wie eine Gebärmutter an? Also, das sei doch wohl so ziemlich das Letzte … Türkenhosen trug sie und eine offene Männerweste über der Bluse.
Fehlt bloß noch ein Turban, dachte Jonathan, als er sie so sah. Er selbst hatte sich ein ungebügeltes Flanellhemd angezogen, dazu einen Tula-gemusterten Anzug mit schwarzer Fliege. Er hatte eine Weile ernsthaft überlegt, ob er sich nicht seinen Strohhut aufsetzen sollte, von dem seine Freunde sagten: «Du, der steht dir aber gut!»
An der Elbe war noch nichts los um diese Zeit. Halbwüchsige fuhren mit dem Fahrrad umher, junge Leute waren das, die hierher gehörten, und Kinder, deren Mütter nicht als Leiche in einer Kirche abgelegt worden waren. Ein Herrchen spielte am Wasser mit seinem Hund. Er ließ das ahnungslose Tier ahnungslos das Stöckchen aus der Cadmiumbrühe holen. Wermutbrüder saßen auf der Bank und sangen:
O du schöner Westerwald … über deine Höhen pfeift der Wind so kalt jedoch der kleinste Sonnenschein dringt tief ins Herz hinein.
Es war auch eine Frau unter den Wermutbrüdern, die sah aus wie ein australischer Ureinwohner. Eine Büchse Chappi hielt sie in der Hand, sie hatte einen Fleischbrocken mit zwei Fingern herausgeholt und tat so, als wolle sie ihn in den Mund schieben.
Aus der Ferne war das Heulen von Polizeisirenen zu hören und das an Fußballerlärm erinnernde johlende Skandieren eines demokratischen Demonstrationszuges. – Großstadt! – Alles hat seine Ordnung: Das Demonstrieren, das Aufpassen und das Zugucken. Auch das Scheibeneinschmeißen hat seine Tradition.
Die beiden gingen die Övelgönne entlang, an den sogenannten Kapitänshäusern vorüber, die sich pensionierte Fahrensleute um die Jahrhundertwende von ihren Ersparnissen gebaut hatten, weil sie sich von der See nicht trennen konnten. Jetzt wurden die Häuserchen von Maklern umlagert, da sie inzwischen Millionen wert waren, die winzigen Katen, mit Gärtchen davor, Bootsschuppen, Laube und Fahnenstange. In den Fenstern standen englische Symbolkatzen, Buddelschiffe und auf dem Fischmarkt erworbene übergroße Muscheln. Mancher Anwohner hatte offenbar den Wunsch, sich den Passanten zu erklären: «AKW – nee!» stand auf einem Stück Karton, das an einen Gartenzwerg gelehnt war. – Über allem lag Essensgeruch: Fischfilet und Sauerkrautsuppe.
Schiffe waren auf der Elbe nicht zu sehen, die waren schon in der Nacht ausgefahren. Übers Wochenende im Hafen zu liegen, das kann sich heute niemand mehr leisten.
Auch Schiffe haben etwas Mütterliches an sich, dachte Jonathan, dies Laden und Löschen …, und er stellte sich vor, daß er in einer Kiste läge, in Heu gebettet, und würde von einem Kran in den Laderaum hinabgelassen. Dieser Gedanke war ihm angenehm.
Man kann nicht gerade sagen, daß sich die beiden gut unterhalten hätten. Die Notwendigkeit, nett sein zu müssen an diesem Tag, führte zu beiderseitigen Ungeschicklichkeiten: «Damals hast du behauptet, daß …», wurde gesagt oder: «Kannst du nicht mal von was anderem reden? Hast du noch immer nicht gerafft, daß mir das auf den Geist geht?»
Außerdem sorgte die Angewohnheit Ullas, mit Jonathan zwar im Gleichschritt zu gehen, aber stets einen halben Meter voraus, für Unbehaglichkeiten. Und überall Hundekot, über den man sich wundert, daß man da nicht reintritt, manchmal aber eben doch.
Jonathan überlegte, ob er seiner Freundin von der Einladung nach Ostpreußen erzählen sollte. Er hatte es bereits auf der Zunge … Besser nicht, dachte er, lieber warten damit – sie würde sicher wieder neidisch werden, wenn sie davon erführe. Strahlend zu der Liebsten eilen, den Brief in der Hand – so stellte er sich das Zusammensein mit seiner Freundin vor. Das war zwischen ihnen nicht drin. Schade! Ulla Bakkre de Vaera wurde immer gleich so häßlich.
Auch Ulla hatte etwas, das sie bewegte: Ein großer Blumenstrauß war abgegeben worden, ein wenig zu groß dafür, daß er von ihrem Chef geordert war. Auch sie hätte zu ihrem Liebsten eilen müssen und rufen: «Stell dir vor, der Alte hat mir Blumen geschickt!» Aber das hatte sie nicht getan, und nun war es bereits ein bißchen zu spät dafür.
Sie schossen sich gerade aufeinander ein, da sahen sie an einem der kleinen Häuser ein Schild: ELB-GALERIE. Hier hatte sich also ein Künstler etabliert, dem mußte ein Besuch gemacht werden.