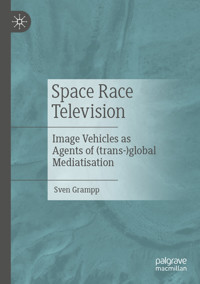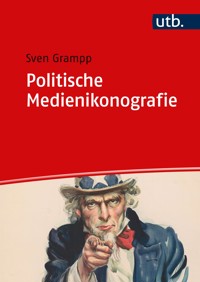31,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: UTB GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Medium ist die Botschaft! Kaum ein Medien- und Kulturforscher ist so verworren und provokativ wie Marshall McLuhan. Dennoch sind seine Ideen aus dem Kanon der Medien- und Kulturwissenschaft nicht wegzudenken. Sven Grampp betrachtet McLuhan aus verschiedenen Perspektiven. Gezeigt wird, welchen Traditionslinien seine Ideen folgen, wie unterschiedlich McLuhan interpretiert werden kann und was er uns noch heute zu sagen hat. Kurzum: Ein unverzichtbares Buch für Studierende der Medien-, Kommunikations- sowie der Kultur- und Sozialwissenschaften.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 655
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Sven Grampp
Marshall McLuhan
Vier Lesarten zur Einführung
UVK Verlag
Umschlagabbildung: © hakkiarslan ∙ iStock
Autorenbild: © privat
DOI: https://doi.org/10.36198/9783838563763
© UVK Verlag 2025— Ein Unternehmen der Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
Einbandgestaltung: siegel konzeption | gestaltung
utb-Nr. 3570
ISBN 978-3-8252-6376-8 (Print)
ISBN 978-3-8463-6376-8 (ePub)
Inhalt
PD Dr. Sven Grampp ist Akademischer Oberrat am Institut für Theater- und Medienwissenschaft der Universität Erlangen-Nürnberg.
Get a Life! McLuhan im Schnelldurchlauf
Wie kein anderes Jahrzehnt vorher waren die 1960er Jahre durch massenmediale Spektakel und technologische Vernetzungsprozesse geprägt. Das Fernsehen avancierte in diesem Jahrzehnt endgültig zum ‚Leitmedium‘ der ‚westlichen‘ Hemisphäre. Damit brachte der Vietnamkrieg seine Schrecken nun direkt in die nordamerikanischen Wohnzimmer. Die Studentenrevolte wurde zu einer nahezu globalen Angelegenheit. Pop-ArtPop-Art war die dominierende Kunstrichtung, die sich vorrangig mit Motiven und Materialien der Alltagskultur und Massenmedien beschäftigte. Am Ende dieses Jahrzehnts fand die Hippie-Bewegung ihren friedlichen Höhepunkt im Woodstock-Festival. Kurz davor, im Juli 1969, verfolgten knapp eine halbe Milliarde Menschen den ersten Schritt eines Menschen auf dem Mond live am Fernsehen. Währenddessen kreisten bereits knapp 400 Satelliten um die Erde, unablässig Daten empfangend, speichernd, verarbeitend und sendend.
Dieses Jahrzehnt, das in amerikanischen Fernsehserien wie WUNDERBARE JAHRE (ABC, 1988–1993) häufig nostalgisch verklärt wird, hat mit Sicherheit auch einige von Marshall McLuhans ‚wunderbarsten Jahre‘ erlebt. Zumindest war es mit Abstand das erfolgreichste Jahrzehnt des kanadischen Medienforschers. Das Geheimnis seines Erfolges lag wohl nicht zuletzt darin, für all die oben angeführten Ereignisse (und noch für vieles andere, ja, wie zu sehen sein wird, eigentlich für buchstäblich „Alles“1) pointierte, mitunter erstaunlich einfache, dann wieder sehr dunkle, meist provokative und irritierende Erklärungen bereitzuhalten. Diese Erklärungen standen unmittelbar oder mittelbar so gut wie immer mit dem neuen Zauberwort des Jahrzehnts in Verbindung, ein Zauberwort, das seither selten in Beschreibungen gesellschaftlicher Befindlichkeit fehlen darf und das bis dato wenig an seiner Zauberkraft eingebüßt zu haben scheint, nämlich ‚die Medien‘.2 Zwar wusste man damals (wie im Übrigen auch heute noch) nicht recht, was genau mit ‚die Medien‘ gemeint sein soll (und was nicht). Noch weniger wusste (und weiß) man, was sie mit uns eigentlich tun, während wir etwas mit ihnen tun. Dass ‚die Medien‘ aber ‚magische Kanäle‘ sind, die undurchsichtige, geheimnisvolle Wirkungen auf uns ausüben, uns ‚verzaubern‘, diesen Verdacht artikulierte McLuhan wie kaum ein Zweiter.3 Dass er den Menschen damals (und in seinen Schriften uns auch heute noch) überdies verspricht, man könnte ‚die Medien‘ womöglich dennoch verstehen und vielleicht sogar kontrollieren, dürfte die Attraktivität seiner Beobachtungen über ‚die Medien‘ nicht gerade geschmälert haben.
Hohepriester der PopkulturPopkultur
Im Jahr 1969 bezeichnete das PLAYBOY-Magazin McLuhan als „Hohepriester der Popkultur und Metaphysiker der Medien“.4 Das ist für ein ‚Herrenmagazin‘, das sich in weiten Teilen ganz anderen Bedürfnissen widmet, eine erstaunlich hellsichtige Beschreibung. Denn McLuhan hat die mediale Signatur seiner Gegenwartskultur immer wieder in kühnen metaphysischen Spekulationen umrissen, die eigentümlich zwischen Kalauern, Pop-Jargon, Aphorismen, New-Age-Vokabular, hanebüchenen Assoziationen, labyrinthischen Verzweigungen voller Widersprüche, weitsichtigen Analysen, historischen Tiefenbohrungen und theologischer Spekulation oszillieren. Die abenteuerlichsten Behauptungen konnte er dabei im Brustton vollkommener Gewissheit äußern. Damit trägt McLuhan durchaus Züge eines ‚Hohepriesters‘.
Wie es sich für einen erfolgreichen Hohepriester gehört, war McLuhan in jenen Jahren, zumindest verbal, in Bestform. Man lud ihn gern und häufig als Gastredner ein. Auch in Wirtschaftskreisen war man von ihm augenscheinlich so angetan, dass er häufig angefragt wurde, vor Unternehmerverbänden oder vor Manager:innen von Firmen wie IBM zu sprechen. Ab Mitte der 1960er Jahre war er zudem Dauergast in Fernsehtalkshows, was für die damaligen Verhältnisse durchaus ein Novum bedeutete. Denn es war verpönt, sich als Akademiker:in Medien populärkultureller Unterhaltung allzu häufig auszuliefern. Auch umgekehrt kam es normalerweise, zumindest was die kanadischen und US-amerikanischen Fernsehanstalten betrifft, nicht gerade zu Begeisterungsstürmen, wenn sich Akademiker:innen televisuell zu Wort melden wollten. Doch bei dem eloquenten wie gewitzten kanadischen Professor für englische Literatur, der sich in kurzen, dennoch druckreif dichten Sätzen zu artikulieren wusste, war das augenscheinlich anders.5
McLuhan war ganz ohne Zweifel ein Mann mit einer Mission. Aber, und hier enthüllt sich die tiefere Bedeutung der Bezeichnung McLuhans durch den PLAYBOYPlayboy, er war nicht einfach irgendein Hohepriester, sondern eben einer der PopkulturPopkultur. Damit ist nicht nur gemeint, dass McLuhan die Populärkultur seiner Zeit deutete und dies häufig in populären Medien wie dem Fernsehen tat. Darüber hinaus übte er sein Hohepriesteramt mit einer der Popkultur entsprechenden selbstironischen Distanz und Gelassenheit aus, die mitunter clowneske Züge annehmen konnte. Legendär ist etwa seine Standardantwort, wenn er gebeten wurde, den einen oder anderen Gedanken noch einmal genauer zu erläutern, den er in einem Vortrag äußerte, oder ihm ein Widerspruch in der Argumentation vorgehalten wurde. McLuhan pflegte auf solche Einwürfe achselzuckend zu antworten: „Wenn Ihnen das nicht gefällt, erzähle ich Ihnen etwas anderes.“6 Nicht weniger legendär ist seine Aussage: „Ich behaupte nicht, meine Theorien zu verstehen – schließlich sind sie ziemlich schwierig.“7 Vor allem gegen Ende der 1960er Jahre schien der ‚Hohepriester der Popkultur und Metaphysiker der Medien‘ so hoch im Kurs zu stehen, dass ein deutscher Rezensent, der Schriftsteller Helmut Heißenbüttel, bereits ein Jahr vor dem angeführten PLAYBOYPlayboy-Interview in einem Radio-Feature über McLuhan von einem „Zeitalter des McLuhanismus“8 sprechen konnte.
Der Aufstieg
McLuhan erfuhr in den 1960er Jahren einen geradezu kometenhaften Aufstieg. 1941 hatte er über einen eher unbekannten Satiriker aus dem 17. Jahrhundert, nämlich Thomas Nashe, in englischer Philologie promoviert. Diese Doktorarbeit ist für McLuhans Verständnis der ‚Grammatik der Medien‘ zwar retrospektiv äußerst aufschlussreich; damals jedoch interessierte sich für diese Arbeit außer deren Gutachter wohl kaum jemand. Anfang der 1950er Jahre veröffentlichte der inzwischen immerhin zu Professorenehren gekommene McLuhan ein Buch, an dem er knapp zehn Jahre (wenngleich sporadisch) gearbeitet hatte. DIE MECHANISCHE BRAUT, so der Titel, gewählt in Anlehnung an eine Phrase von Marcel Duchamp, die dieser im Zusammenhang mit der Herstellung seines Werkes DAS GROSSE GLAS (1915–1923) häufig verwendete, nämlich „Junggesellenmaschine“, enthielt eine Reihe von Werbeanalysen mit dezidiert kulturkritischem Unterton. Vor allem die Form dieses Buchs ist ungewöhnlich: Beim Blättern findet man auf den linken Seiten meist eine Werbeanzeige, einen Zeitungsausschnitt oder einen Comicstrip, auf der rechten McLuhans Analysen und Assoziationen dazu. Obwohl sich McLuhan durch diese Art Auseinandersetzung mit der Gegenwartskultur intellektuelle Anerkennung und öffentliche Aufmerksamkeit erhoffte, blieb beides weitgehend aus. Der Autor selbst führte das auf die Eingriffe und Beschneidungen des Verlages zurück. In einem Brief an Ezra Pound heißt es diesbezüglich 1951 sichtlich frustriert und unverhohlen chauvinistisch: „Publishers offices now are crammed with homosexuals who have a horror of any writing with balls to it.“9
Erst mit der Zeitschrift EXPLORATIONSExplorations, die sich aus Geldern der Ford-Stiftung finanzierte und die McLuhan (mit Unterbrechungen) gemeinsam mit dem Anthropologen Edmund CarpenterCarpenter, Edmund zwischen 1953 und 1959 herausgab, sollte sich die intellektuelle Anerkennung in größerem Umfang einstellen.10 In Wissenschaftskreisen machten Carpenter und McLuhan im Rahmen der EXPLORATIONS mit ungewöhnlichen und innovativen Ideen auf sich aufmerksam. Nicht weniger als die ‚Grammatik der neuen Medien‘ sollte in dieser Zeitschrift untersucht werden, wie es bündig im Vorwort zu einer Anthologie heißt, die zentrale Texte der Zeitschrift versammelt: „Without an understanding of media grammars, we cannot hope to achieve a contemporary awareness of the world in which we live.“11 Um die Strukturen der gegenwärtigen Medienwelt verstehen zu können, versammelten Carpenter und McLuhan diverse namhafte Forscher:innen aus unterschiedlichen disziplinären Zusammenhängen, etwa den Architekturhistoriker und Wölfflin-Schüler Siegfried Giedion oder McLuhans Kollege an der Universität in Toronto, den Literaturwissenschaftler Northrop Frye, die Anthropologin Dorothy Lee oder Daisetz Teitaro Suzuki, einen der damals führenden Experten für Zen-Buddhismus. Diese Art der (interdisziplinären) Medienanalyse war für Geisteswissenschaftler:innen, allen voran Philolog:innen, neu. Der ganz große Durchbruch jenseits des akademischen Elfenbeinturmes war für McLuhan damit jedoch immer noch nicht erreicht. Dieser erfolgte erst in den 1960er Jahren.
Der Durchbruch
1962 erschien DIE GUTENBERG-GALAXIS.12 Darin präsentierte McLuhan zum ersten Mal in Buchform, nachdem er die Thesen des Wirtschaftshistorikers Harold A. InnisInnis, Harold A. zur tragenden Rolle von Medientechnologien für Geschichtsverläufe kennen gelernt hatte, seine Vorstellung kulturgeschichtlicher Prozesse als medienbestimmte. Für dieses Buch, das größtenteils wie eine kommentierte Zitatencollage wirkt und dessen Titel im populärkulturellen Gedächtnis der folgenden Jahrzehnte einen festen Platz einnehmen sollte, erhielt McLuhan den in Kanada angesehenen Governor-General’s Award für kritische Prosa. Im selben Jahr wurde eigens für ihn das Centre for Culture and Technology an der Universität in Toronto gegründet.13 Damit sollten die Abwanderungspläne zerstreut werden, die McLuhan durchaus hegte, wurde er doch nun auf einmal von anderen Universitäten, vor allem aus den USA, umworben. Die Strategie der Universität Toronto hatte Erfolg: Bis zu seinem Tod im Jahre 1980 sollte McLuhan, abgesehen von einigen Gastdozenturen, das Center leiten.
1964 wurde dann das Buch veröffentlicht, das wohl bis dato McLuhans berühmtestes, auf jeden Fall wissenschaftlich einflussreichste sein dürfte, nämlich UNDERSTANDING MEDIA.14 Dieses Buch ging weg wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln. Binnen kürzester Zeit waren bereits knapp 100.000 Exemplare verkauft; noch im selben Jahr wurde eine zweite und dritte Auflage gedruckt.15 Das ist durchaus erstaunlich. Denn es handelt sich um ein inhaltlich recht sperriges Werk, das aus knapp 400 eng bedruckten Seiten besteht. In den Folgejahren wurde es in viele Sprachen übersetzt. Die deutsche Übersetzung, im Übrigen die erste Übersetzung eines Buches von McLuhan ins Deutsche, wartete mit einem noch verheißungsvolleren Titel als das Original auf. UNDERSTANDING MEDIA wanderte in den Untertitel und als Haupttitel wählte man stattdessen: DIE MAGISCHEN KANÄLE. Das entsprach durchaus präzise der Zielrichtung des Buches. Denn es geht darin primär um die Beobachtung und Erläuterung, wie Medien, quasi hinter unserem Rücken, jenseits unserem willentlichen Zugriff auf sie und scheinbar wie eine übernatürliche Instanz unsere Wahrnehmungen, Erkenntnisse und Kommunikationsweisen beeinflussen, ja umformen. Das Buch wurde zwar nicht nur gefeiert, vor allem europäische Intellektuelle reagierten darauf äußerst skeptisch, aber eben beinah weltweit als eine Position wahrgenommen, zu der man sich zumindest zu verhalten hatte, wollte man im akademischen Diskurs Schritt halten.16
Zur Steigerung des Bekanntheitsgrades in der Öffentlichkeit trug Mitte der 1960er Jahre wohl noch sehr viel mehr als dieses Buch ein Porträt bei, das kurz nach der Veröffentlichung von DIE MAGISCHEN KANÄLE erschien und aus dem noch Jahre später immer wieder zitiert wurde.17 Dieser Artikel prägte McLuhans Bild in der Öffentlichkeit wie wohl kein anderer. Der Journalist und Schriftsteller Tom WolfeWolfe, Tom, der heute wohl vor allem noch bekannt sein dürfte für den Roman FEGEFEUER DER EITELKEITEN und die Verfilmung seines Berichts über die Frühphase des amerikanischen Weltraumprogramms THE RIGHT STUFF, veröffentlichte im November 1965 ein längeres Porträt über McLuhan in der Sonntagsbeilage von WORLD JOURNAL TRIBUNE. Unter dem Titel WHAT IF HE IS RIGHT? entwirft Wolfe darin das Bild eines zerstreuten Professors, der sich um sein Aussehen keine größeren Gedanken macht. Ein charakteristisches Detail hebt Wolfe dabei hervor, nämlich eine spezielle Krawatte: „If he feels like it, he just puts on the old striped tie with the plastic neck band. You just snap the plastic band around your neck and there the tie is, hanging down and ready to go, Pree-Tide.“18 Für diese Art von Krawatte wurde McLuhan in der Folge nachgerade berühmt. Nachdem Wolfe zu Beginn seines Porträts das schrullige und clowneske an McLuhans Auftreten mit milder Ironie beschrieben hat, folgt ein Satz in Frageform, der recht erfolgreich Karriere in der nordamerikanischen und der europäischen Presse machen sollte. Darin wird das gängige Klischee des zerstreuten Professors mit einer nicht weniger gängigen Erweiterung versehen. Es handelt sich um den Topos des herausragenden Genies, das von Normalsterblichen nicht recht verstanden werden kann und aufgrund seiner neuartigen Gedanken zunächst zur Lachnummer mutiert. Über kurz oder lang werden sich aber die revolutionären Gedanken Bahn brechen. Dieses Klischee unterbreitet uns Wolf bezogen auf McLuhan zumindest in Form einer Möglichkeit, wenn er schreibt: „Suppose he is what he sounds like, the most important thinker since Newton, Darwin, FreudFreud, Sigmund, Einstein, and Pavlov, studs of the intelligentsia game suppose he is the oracle of the modern times – what if he is right?“19 In dieser Ahnengalerie fühlte sich McLuhan durchaus wohl, wie er dem Verfasser des Artikels in einem Brief versicherte.20
1967 veröffentlichte McLuhan sein bis heute auflagenstärkstes Buch. Es trägt den Titel THE MEDIUM IS THE MASSAGE (dt.: DAS MEDIUM IST MASSAGE).21 Dies ist ein Wortspiel, das auf den bekanntesten Slogans McLuhans aus DIE MAGISCHEN KANÄLE referiert, nämlich „The Medium is the Message“.22 Aus der ‚Message‘ wird hier die ‚Massage‘. Das Buch beinhaltet Textausschnitte und Thesen aus McLuhans vorhergehenden Büchern und kombiniert diese mit Fotografien, Collagen, Zeichnungen und Letterdruck-Experimenten, die der Publizist und Autor Jerome Agel gemeinsam mit dem Buchdesigner Quentin Fiore entwarf. Dieses kleine Buch, das man innerhalb einer Stunde durchgeblättert hat, verkaufte sich innerhalb eines Jahres sage und schreibe über eine Million Mal.23
Mit unterschiedlichen Kooperationspartner:innen und Verlagen waren zudem Ende der 1960er Jahre mindestens acht weitere Buchprojekte angedacht. Ferner war eine Buchreihe geplant, DIE MARSHALL MCLUHAN BIBLIOTHEK, die von McLuhan ausgewählt die maßgeblichen Texte für das Verständnis der Gegenwartskultur umfassen sollte. Der Unternehmer Eugene Schwarz konzipierte für McLuhan gar eine Art Late-Night-Talkshow: In THE MARSHALL MCLUHAN SHOW sollte der Medienforscher Gäste aus Kunstkreisen, Wissenschaft und Wirtschaft empfangen und in lockerer Atmosphäre mit diesen über die wichtigen Dinge der Zeit plaudern. Aus den meisten dieser Projekte wurde schließlich nichts, wohl auch, weil McLuhan beinah obsessiv immer weitere Projektideen in immer kürzeren Abständen entwarf, für deren tatsächliche Realisierung dann aber immer weniger Zeit blieb. „I wish I had time to go into it in detail, but […].“24 Diese Wendung findet sich häufig in McLuhans Briefen. Kaum war ein Projekt kurz skizziert, hetzte McLuhan zum nächsten. Zusehends verzettelte er sich – ganz buchstäblich.25 Jedenfalls zeigt die Existenz solcher Projekte und Kooperationspläne, welch hohe Popularität McLuhan zu dieser Zeit genoss oder zumindest, welche Anziehungskraft man ihm von unterschiedlicher Seite zutraute.
Der Absturz
Entsprechend der klassischen Dramaturgie einer Geschichte von Aufstieg und Fall folgt dem kometenhaften Aufstieg in den Swinging Sixties der Niedergang in den 1970er Jahren – ein sehr rascher Niedergang im Übrigen. Sicherlich hat dieser Abstieg vielfältige Gründe, denen man eigentlich länger nachgehen müsste, als es hier der Fall sein wird. Jedenfalls wurde seine Popularität immer geringer, obwohl McLuhan weitere Bücher veröffentlichte, Vorträge hielt und im Fernsehen auftrat. Es sei dahingestellt, ob das daran lag, dass McLuhan nichts wirklich Neues mehr lieferte oder seine Ideen immer krudere Formen annahmen oder man einfach seiner Clownerie überdrüssig war, sei es, dass er körperlich wie geistig durch einige Schlaganfälle geschwächt, nicht mehr den Esprit früherer Tage versprühte. Vielleicht hatte sich auch einfach der Zeitgeist verändert. Wie dem auch immer sei, der Widerstand aus der Wissenschaft jedenfalls wuchs in dieser Zeit enorm und kulminierte bereits 1971 in einem Buch von Jonathan MillerMiller, Jonathan.
Millers Buch war die erste Monografie zu Marshall McLuhans Werk überhaupt – und beinhaltete ein vernichtendes Urteil. McLuhan hat auf die Besonderheit von Medien hingewiesen, das sei unbestritten sein Verdienst, so Miller. Doch im Resümee heißt es dann, McLuhans größte Leistung besteht darin, „uns mit einem gigantischen System von Lügen erschreckt“26 zu haben. Zwar gab es auch davor sehr viele kritische Stimmen zu McLuhan, besonders aus dem wissenschaftlichen Lager. Die Kommentator:innen hoben immer wieder den wirren Stil, die Redundanz, die fehlende empirische Sättigung, das vermeintlich Apolitische und Affirmative des Werkes von McLuhan hervor. So umfassend und systematisch wie in Jonathan Millers Monografie wurden McLuhans Thesen und Behauptungen jedoch zuvor nicht durchleuchtet und argumentativ durchaus überzeugend für unwissenschaftlich erklärt. McLuhan selbst reagierte auf dieses Buch merklich irritiert; er sprach von einem „anti-McLuhan crusade“.27 Ja, er ließ sich sogar dazu hinreißen, von einem „anti-Catholic-crusade“28 zu sprechen, warf Miller vor, ihn als „undercover agent for Rome“29 zu verunglimpfen, weil dieser ihm den Vorwurf gemacht hatte, religiöses Gedankengut als wissenschaftlich valide hinzustellen. Argumentativ ging McLuhan auf diese Kritik jedoch, zumindest strategisch gesehen, eher suboptimal ein. Auf Millers Vorwurf, er habe keine Beweise oder Bestätigungen für seine Behauptungen, antwortet McLuhan schlicht: „The last thing in the world that anybody wants is proof of anything I am saying. The evidence is plentiful for those who are interested.“30 Unter Forscher:innen, die sich auch nur ein klein wenig um wissenschaftliche Redlichkeit scheren, dürfte sich McLuhan mit diesem rüden Verweis auf Evidenz nicht gerade Freunde gemacht haben.
Schnell wurde MillersMiller, Jonathan Buch populär. An einigen wenigen Hinweisen lässt sich das veranschaulichen: Vier Jahre gingen ins Land, bis die deutschsprachige Übersetzung von UNDERSTANDING MEDIA publiziert wurde. Die ins Deutsche übersetzte Ausgabe von Millers Buch stand dagegen schon ein Jahr nach dem Original in den Regalen. Zudem erschien es dort in der Reihe MODERNE THEORETIKER und war damit dezidiert als eine Einführung in McLuhans Werk ausgewiesen. Schon ein Jahr zuvor, 1970, war McLuhan von Hans Magnus Enzensberger in seinem, im deutschsprachigen Bereich wahrscheinlich noch wirkmächtigeren Text BAUSTEINE ZU EINER THEORIE DER MEDIEN ganz ähnlich beurteilt worden. Dort heißt es, McLuhan ist ein Autor, dem „alle analytischen Kategorien zum Verständnis gesellschaftlicher Prozesse fehlen.“31 Enzensberger spricht ihm kurzerhand die wissenschaftliche „Satisfaktionsfähigkeit“32 ab. 1977 veröffentlichte der berühmte italienische Semiotiker und Romanschriftsteller Umberto EcoEco, Umberto seine Sicht auf McLuhan. Wenngleich diese Kritik weit weniger polemisch ausfiel als die Enzensbergers und Millers, war sie dennoch ähnlich vernichtend.33 Für den wissenschaftlichen und kritisch-intellektuellen Bereich war McLuhan damit von der Agenda gestrichen. In der öffentlichen Wahrnehmung sank der Stern McLuhans sogar noch schneller. Indiz dafür ist ein Cartoon aus dem NEW YORKER vom 26. September 1970. Dort ist eine Frau abgebildet, die zu ihrem Mann beim Verlassen einer Cocktailparty leicht vorwurfsvoll sagt: „Ashley, bist du sicher, dass es nicht zu früh ist, auf Partys herumzulaufen und die Leute zu fragen: ‚Was ist eigentlich aus Marshall McLuhan geworden?‘“34
Die Renaissance
Ja, was ist eigentlich aus Marshall McLuhan geworden, nachdem er in den 1970er Jahren in der Bedeutungslosigkeit verschwunden war?35 Physisch lässt sich das ziemlich genau beantworten: In der Silvesternacht 1980 ist er an den Folgen eines erneuten Hirnschlages gestorben. Doch gerade gegen Ende dieser Dekade, an deren Beginn McLuhan starb, erfuhren seine Ideen eine ungeahnte Renaissance, sowohl in der Öffentlichkeit als auch in der Forschung. Zu tun hat das wohl nicht zuletzt mit neuen, dramatischen medientechnologischen Entwicklungen und dem Bedürfnis, diese irgendwie fassbar zu machen. So wurde seit den 1980er Jahren allmählich die Computertechnologie auch jenseits von Großrechenanlagen etabliert und in den 1990er Jahren die digitale Vernetzung auch außerhalb von universitären und militärischen Zirkeln durch das Internet vorangetrieben. McLuhan selbst hat diese Entwicklungen nur noch sehr sporadisch miterlebt und wahrscheinlich noch weniger verstanden. Seine Beschreibungen der Gegenwartskultur bezogen sich auf ein mit der Telegrafie aufgekommenes Zeitalter der Elektrizität, an deren Endpunkt tatsächlich der Computer als Medium totaler Vernetzung in einem globalen Dorf aufscheint. Aber geprägt werde das Zeitalter, das die Gutenberg-Galaxis verabschieden sollte, laut McLuhan, vor allem durch das Fernsehen. Im Fernsehen hat das Zeitalter sein ideales Leitmedium gefunden, verändert sich doch, davon war McLuhan überzeugt, mit dem Fernsehen unsere Wahrnehmung, unsere Beziehung zur Welt und zu den anderen Menschen radikal.36
Viele Kommentare seit den 1980er Jahren wollen in McLuhan indes einen Vordenker des vernetzten Computers und damit einen Visionär des digitalen Zeitalters erkennen – ohne dass McLuhan dies selbst klar hätte sehen können. Er wird so zu einem Vordenker der globalen Vernetzung, der seine Visionen eben nur (historisch bedingt) auf das falsche Medium bezogen hat.37 Der kanadische Medienforscher wird seither zu einer Art Moses stilisiert, der zwar den Weg in das gelobte Land weist, dieses aber selbst nie (oder zumindest nur aus weiter Ferne) zu Gesicht bekommt. Das Computermagazin WIREDWired erhob McLuhan dementsprechend konsequent zu ihrem „patron saint“,38 also zum Schutzheiligen. So wurde der Professor für englische Literatur vom Hohepriester der 1960er Jahre am Ende des Jahrtausends zum Schutzheiligen des Computerzeitalters.
Die Renaissance McLuhans lässt sich ganz einfach daran ablesen, dass seine Schriften in den 1980er und 1990er Jahren neu aufgelegt wurden.39 Allmählich gelangte McLuhan in den Stand eines Klassikers, inklusive dementsprechender philologischer Bearbeitung. Zentrale Stellungnahmen zu McLuhans Werk aus knapp 40 Jahren wurden in einer dreibändigen Publikation gesammelt.40 Nicht weniger als drei umfangreiche Biografien erschienen in den letzten Jahren über ihn.41 Seit 2002 liegt eine kritische Ausgabe von UNDERSTANDING MEDIA vor.42 Eine Auswahl seiner Briefe wurde veröffentlicht und im Jahr 2003 sogar seine bis dahin noch nie publizierte Dissertation gedruckt. Man machte sich Gedanken über den DIGITAL MCLUHAN,43 über das GLOBAL VILLAGE TODAY,44 verteidigte McLuhans Gedankengut vehement gegen den „McLuhanism“;45 im Schloss Thurnau bei Bayreuth fand 2007 ein großes internationales Symposium statt, auf dem man McLuhan hinsichtlich der Aufgaben, die da im 21. Jahrhundert auf uns warten, „neu lesen“ wollte.46 Zu seinem 100. Geburtstag, 2011, traf man ebenfalls allerorten auf Tagungen und Publikationen zu McLuhan.47
Seit 2014 ist der REPORT ON PROJECT IN UNDERSTANDING NEW MEDIA, den McLuhan im Auftrag der National Association of Educational Broadcasters (NAEB) für das Department of Education mit Sitz in Washington 1960 anfertigte, als Typoskript online zugänglich.48 Zum 50-jährigen Jubiläum der Erstveröffentlichung von UNDERSTANDING MEDIA gab es Tagungen, Sammelbände und Zeitschriftenausgaben, die ebenfalls erkunden wollten, was McLuhan uns heute noch zu sagen haben könnte oder wie sein Gedankengut zumindest historisch akkurat zu verorten ist.49 Die gesamten Artikel der Zeitschrift EXPLORATIONSExplorations, zum ersten Mal herausgegeben von Carpenter und McLuhan zwischen 1953 und 1959, ist seit 2016 in acht Bänden gesammelt wieder aufgelegt.50 Im selben Jahr findet sich eine Sammlung mit Texten von McLuhan aus den Jahren 1952 bis 1978 unter dem großspurigen Titel ON THE NATURE OF MEDIA (neu) veröffentlicht.51 Im Themenheft der Zeitschrift IMAGINATIONS, das 2017 unter dem Titel MARSHALL MCLUHAN AND THE ARTS erschien, schaffen es die Herausgeber:innen in ihrer Einleitung auf weniger als zwei Seiten McLuhan als Vorläufer der Immanenzphilosophie von Deleuze, des spekulativen Realismus, neuerer Affekttheorien sowie dem New Materialism zu inthronisieren, um von dort aus die Relevanz von McLuhans Denken für die Gegenwartskunst näher zu beleuchten.52 Im Jahr 2020 wurde ein Buch mit dem Titel EIN MEDIUM NAMENS MCLUHAN veröffentlicht, das 37 Statements von Mediewissenschaftler:innen zur Stellung McLuhans in der gegenwärtigen Forschung vorstellt.53 Zwei Jahre später erschien ein Sammelband unter dem Titel RE-UNDERSTANDING MEDIA, der sich zur Aufgabe macht, eine kritische Re-Lektüre von UNDERSTANDIG MEDIA zu offerieren – und zwar in Form von, wie es im Untertitel heißt, FEMINIST EXTENSIONS OF MARSHALL MCLUHAN.54 Die Liste ließe sich fortsetzen.55
Dass McLuhan kanonisch geworden ist, zeigt sich recht klar auch daran, dass mittlerweile jeder und jede Medienwissenschaftsstudent:in wissen muss, was es mit dem Ende der Gutenberg-Galaxis auf sich hat oder was mit der paradoxen Formel vom Medium, das die Botschaft sein soll, gemeint ist (zumindest so ungefähr). Studierende der Medienwissenschaft, die das nicht wissen, haben es schwer, erfolgreich über ihre Grundkurse hinauszugelangen.
Über die Schwierigkeit McLuhan zu lesen – vier Lesarten
Nicht zuletzt im deutschsprachigen Forschungsgefilde wurde McLuhan seit Ende der 1980er Jahre als wichtiger Medienforscher wiederentdeckt. Vor allem für die sich allmählich konstituierenden Medienwissenschaften erhielt McLuhan, mancherorts zumindest, einen ganz ähnlichen Stellenwert wie für das Computermagazin WIREDWired. In vielen Publikationen figuriert McLuhan nämlich als der (wenngleich etwas wilde und wirre) ‚Gründungsvater‘ der Medienforschung. Seither werden Generationen von Studierenden, vorrangig der Medienwissenschaften, mit McLuhans Thesen und Behauptungen konfrontiert – ja geradezu malträtiert, ist es doch recht mühsam, sich durch das Gestrüpp von McLuhans Texten zu kämpfen.
Kaum ein Medienforscher ist so widerborstig, verworren, enzyklopädisch angelegt und gleichzeitig den technikutopischen wie medienkritischen Szenarien seiner Zeit verhaftet wie McLuhan. Zudem sind seine Texte, was man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht vermuten würde, vergleichsweise voraussetzungsreich. Um ihn einigermaßen zu verstehen oder doch zumindest einordnen zu können, sollte man nicht nur die maßgeblichen Texte von McLuhan kennen. Ein wenig Bescheid sollte man auch darüber wissen, was in den 1960er Jahren kulturell, medientechnologisch und gesellschaftspolitisch vor sich ging. Darüber hinaus – und das ist noch weit wichtiger –, sollte man ideen- und wissenschaftsgeschichtlich beschlagen sein. Es ist bspw. zur Einordnung McLuhans sehr hilfreich zu wissen, was der New CriticismNew Criticism ist und worauf der Wirtschaftshistoriker Harold A. InnisInnis, Harold A. abzielte. Daneben sollte man am besten zumindest in groben Grundzüge die Theologie Thomas von AquinsAquin, Thomas v. kennen, ebenso das antike Trivium aus Dialektik, Rhetorik und Grammatik, das für McLuhans Forschungs- und Schreibverständnis von zentraler Bedeutung ist. Die Kenntnis grundlegender Darstellungsprinzipien der künstlerischen AvantgardeJoyce, James sind ebenfalls sehr hilfreich, um zu verstehen, warum McLuhans seine Texte so seltsam gestaltet und sich wenig um argumentative Kohärenz gekümmert hat. Freilich ist es mühsam, sich solch ein Wissen anzueignen. Man weiß ja nicht, ob die Mühe überhaupt lohnt. Genau deshalb gibt es schließlich Einführungsliteratur.
McLuhan zur Einführung – ein Literaturbericht
An einführenden Texten zu McLuhan herrscht im deutschsprachigen Raum deshalb auch kein wirklicher Mangel. Wenngleich es nach MillersMiller, Jonathan oben angeführter ‚Einführung‘, die 1972 ins Deutsche übersetzt wurde, bis zur Erstauflage vorliegender Monografie kein Buch gab, ja nicht einmal ein Büchlein, das sich einführend ausschließlich mit McLuhan beschäftigte, so gab und gibt es zumindest etliche Einführungen in die Medienwissenschaft bzw. Medientheorie, aber auch in die Kommunikationswissenschaft, die sich mehr oder minder ausführlich McLuhans Gedanken widmen. Zumeist findet man dort eine von zwei Darstellungsvarianten. Entweder wird McLuhan in der Tradition Millers und Enzensbergers kurzerhand als unwissenschaftlich oder gleich als „Schwätzer“1 abgetan. Oder aber er wird als ‚Gründungsvater‘ bzw. Ideengeber der Medienforschung gefeiert, um dann, nach einem kurzen Exkurs über die seltsame Schreibweise McLuhans, seine Ideen anhand von wahlweise zwei,2 drei3 oder vier4 Slogans zu erläutern, gern anhand von kurzen Textpassagen aus DIE MAGISCHEN KANÄLE.
Radikale Komplexitätsreduktion ist als Maßnahme bei solch einem Autor durchaus nachvollziehbar. Und schließlich greift man ja zu einer Einführung, um eine systematische, kompakte Reduktion auf das Wesentliche und/oder eine kritische Einschätzung des Gegenstands zu erhalten. Nur leider geht dabei, zumindest im Fall McLuhans, allzu oft der Spaß oder doch zumindest die Faszination an der intellektuellen Auseinandersetzung mit dem Autor schnell verloren. Dass McLuhan – um in der Sprache seiner Zeit zu formulieren – ‚irre Texte‘ schrieb, ist schwer zu bestreiten. Dass er sie so schrieb, wie er sie schrieb, liegt aber nicht einfach daran, dass er irre war, seine Thesen und Argumente einfach nicht ordnen konnte.5 Diesen Irrsinn zu verwerfen, hat man freilich alles Recht der Welt. Nur sollte man es, zumindest als Wissenschaftler:in, mit guten Gründen tun. Man sollte sich klar machen, dass dieser Irrsinn Methode hat (oder zumindest haben könnte), zudem eine Geschichte, die über das hinausgeht, was durch die Lektüre einer oder zwei kurzen Textpassagen aus DIE MAGISCHEN KANÄLE zu vermuten ist. Weiterhin eignet sich die Lektüre McLuhans bestens zur Auseinandersetzung mit Positionen heutiger Medienforschung. Denn in seinem Œuvre ist, wenn schon nicht alles, so doch vieles angelegt, das gegenwärtig, wenngleich meist in anderem Vokabular, diskutiert wird.
Zugriffsweisen
Woher McLuhans Ideen kamen, wie sie organisiert sind, wie unterschiedlich sie rezipiert wurden, ob man damit auch heute noch etwas anfangen kann, und wenn ja, was, darüber möchten die folgenden Seiten Aufschluss geben. Es soll aber nicht um eine chronologische Darstellung der Entwicklung McLuhans gehen, weder ideengeschichtlich noch biografisch fundiert. Was ich zu McLuhans Biografie zu sagen habe, wurde bereits mit dem vorliegenden Kapitel weitestgehend erschöpft. Es werden also nicht Quellen fein säuberlich nacheinander ausgebreitet, aus denen sich McLuhan bediente und dann die einzelnen Werke McLuhans in ihrem zeitlichen Verlauf vorgestellt und interpretiert, um daran anschließend darzustellen, wer sich nun wieder der Ideen McLuhans bediente usw.6 Anstatt einer solchen gradlinigen, diachronen Darstellungsform habe ich eine andere, wie ich hoffe, spannendere und zumindest für wissenschaftliche Interessen aufschlussreichere Zugangsweise gewählt.
McLuhans Werk möchte ich aus verschiedenen Perspektiven in den Blick nehmen, um unterschiedliche Facetten und Lesarten vorzustellen. ‚Verschiedene Perspektiven‘ zu wählen heißt in diesem Fall nicht zuletzt, widerstrebende Facetten und Lesarten vorzustellen, die in einigen Fällen sogar untereinander inkompatibel sind. Damit wähle ich im Übrigen eine Herangehensweise, die McLuhan selbst immer wieder forderte. Im Sinne McLuhans sind solche Zugänge Proben oder Tests, die einer Experimentalanordnung gleichen: Man fordert den Untersuchungsgegenstand durch die Schaffung künstlicher, am besten extremer Rahmenbedingungen (bspw. eine überspitzte Hypothese) heraus und schaut dann, wie der Gegenstand darauf regiert, was er von sich preisgibt. Anschließend wählt man eine weitere, nicht weniger extreme Rahmenbedingung, die möglichst wenig mit der ersten zu tun hat usf. Daraus ergibt sich dann eine Art MosaikMosaik, auf dem sich der Gegenstand, wenngleich gebrochen und unscharf, abzuzeichnen beginnt.7 Wichtig sind nach McLuhan an dieser Methode vor allem zwei Aspekte. Erstens muss man sich von dem Glauben an die eine, vermeintlich richtige Herangehensweise verabschieden, also konsequent multiperspektivisch arbeiten. Zweitens sollte man sich mit endgültigen Urteilen über seinen Gegenstand zurückhalten, da sonst der Erkenntniswert und die Komplexität des Gegenstandes unangemessen eingeschränkt werden. Deshalb nennt McLuhan diese von ihm präferierte Herangehensweise auch „Technik des schwebenden Urteils“.8
Die McLuhans
Konstruktivistisch gewendet heißt das, dass mit jedem Zugang entschieden ist, was und wie ein Gegenstand überhaupt in den Blick genommen werden kann, damit eben auch: was und wie nicht. Ja, noch radikaler: Es werden mit unterschiedlichen Zugangsweisen nicht einfach unterschiedliche Aspekte eines Gegenstands beleuchtet. Vielmehr verändert jede Zugriffsweise die Wahrnehmbar- und Erkennbarkeit des untersuchten Phänomens qualitativ. Mit anderen Worten: Jeder Zugriff erschafft seinen ganz eigenen McLuhan. Gerade an den Zugängen zu dem Forschungsobjekt McLuhan möchte ich nachvollziehbar machen, was das konkret bedeutet. Zu dieser multiperspektivischen Perspektive gehört auch, dass der jeweils in den unterschiedlichen Ansätzen gepflegte Jargon aufgegriffen wird. So argumentiert ein oder eine Ideologiekritik:in bspw. nicht nur anders als ein oder eine Pragmatiker:in, hat nicht nur andere Ziele und Interessen am Gegenstand, sondern formuliert diese auch in einem ganz anderen Vokabular und bedient sich eines anderen Stils. Durch die Übernahme der unterschiedlichen Argumentationsweisen, Vokabulare und Sprechweisen sollen die gewählten Zugänge eindeutig unterscheidbar gemacht werden. Das scheint mir insofern sinnvoll, als so die unterschiedlichen ‚McLuhans‘ möglichst klar Kontur gewinnen können.
Mit dieser Ausrichtung verfolgt die Einführung zwei eng zusammenhängende Ziele. Mein erstes Ziel ist es, das facettenreiche Werk McLuhans vorzustellen, dessen Grundlagen, Wirkungsgeschichte und Relevanz für eine kulturwissenschaftlich ausgerichtete Medienforschung möglichst verständlich darzulegen. Leisten will ich das, eben indem ich unterschiedliche Zugriffsweisen auf das Werk wähle. Damit ist denn auch das zweite Ziel benannt: Nicht nur soll McLuhan als ein Autor vorgestellt werden, der facettenreich ist bzw. aus vielen ‚McLuhans‘ besteht. Darüber hinaus will ich andersherum ebenfalls zeigen, dass die jeweilige Zugriffsweise entscheidet, welche Facetten überhaupt beobachtbar werden, welcher ‚McLuhan‘ durch welchen Zugriff zuallererst ‚erschaffen‘ wird. So sind en passant Begrenzungen, Relativität, Unvereinbarkeit, aber auch Produktivität differenter wissenschaftlicher Zugriffsweisen konkret und exemplarisch zu veranschaulichen – und damit deren zentrale rhetorischen wie argumentativen Operationsweisen einführend vorgestellt. Dem und der Leser:in wird es dabei überlassen bleiben, Verbindungslinien zwischen den einzelnen Lesarten herzustellen, Widersprüche zwischen ihnen aufzulösen oder auszuhalten, Vor- und Nachteile der einzelnen Ansätze zu beurteilen.9
Vier Lesarten
Doch wie sehen diese Zugangsweisen denn nun genau aus? Vier recht unterschiedliche Zugriffe habe ich gewählt. Sie sind in den Geistes- und Kulturwissenschaften beheimatet und dort, so möchte ich behaupten, gängige oder doch zumindest traditionelle Grundlagen für Analysen. Gewählt wurden genau diese vier, weil sie es möglich machen, unterschiedliche Facetten von McLuhans Werk zu betrachten und zu beleuchten. Im Einzelnen sind das erstens eine rhetorische Lesart, zweitens eine hermeneutische, drittens ein kritische und viertens eine pragmatische. Diese Lesarten sollen auch und gerade in ihrer Inkommensurabilität ein Spannungsfeld erzeugen, in dem zumindest einige wichtige Umrisse von McLuhans Werk sichtbar werden. Zwar können die einzelnen Zugriffsweisen unabhängig voneinander rezipiert werden. Ihre Abfolge im Text ist aber nicht zufällig gewählt. Diese folgt vielmehr einer sukzessiven Reihe von Irritationen, die die Lektüre von McLuhans Werk auszulösen imstande sind, und den Versuchen, auf diese Irritationen zu reagieren.
In der ersten Lesart werde ich mich mit den rhetorischen Strategien auseinandersetzen, derer sich McLuhan bedient; vor allem auf die Darstellungsform möchte ich mich hier konzentrieren. Die Analyse der Schreibweise soll am Anfang stehen, da hier unmittelbar Verwirrungen des Lesers und der Leserin zu erwarten sind. McLuhan schreibt keine klassischen wissenschaftlichen Texte. Kohärente Argumentation, Explikation seiner Thesen, Plausibilisierung anhand von Beispielen – all das sucht man (zumeist) vergeblich in McLuhans Texten. Seine Argumentation ist ganz im Gegenteil sprunghaft, dann wieder voller Wiederholungschleifen; unterschiedliche Diskurse werden collagenartig vermischt; die Texte sind mit allerlei rhetorischem Prunk geschmückt: Wortspiele, Alliterationen, Ellipsen, Metaphern und Paradoxien. Auf diese Irritation gilt es zuerst einzugehen, um herauszufinden, welches Strukturierungsverfahren dem Ganzen zugrunde liegt und welche Funktionen diese Darstellungsform haben könnten.
Im zweiten Kapitel wird eine hermeneutische Perspektive eingenommen. Dabei wird das angewandt, was man in der Philosophie als Prinzip der wohlwollenden Interpretation kennt. Es handelt sich um die Unterstellung, dass die sich äußernde Person überwiegend wahre und rationale Gründe für ihre Handlungen und Aussagen hat. Damit ist den Rezipient:innen aufgegeben, aktiv und wohlwollend die bestmögliche, kohärenteste und sinnvollste Interpretation dieser Äußerungen zu finden. Aus dieser Perspektive wird der Versuch unternommen, McLuhans Texte als ein in sich geschlossenes, kohärentes und sinnvolles Werk zu verstehen. Eine hermeneutische Herangehensweise bedeutet für mich dementsprechend hier zweierlei: Erstens soll McLuhan innerhalb seines historischen Kontextes verortet und gefragt werden, auf welche Traditionen er zurückgreift, vor welchem Hintergrund er überhaupt erst zu verstehen ist. Zweitens wird McLuhans Werk als eines verstanden, das trotz aller Brüche, scheinbarer Widersprüchlichkeiten und Wandlungen als die kohärente Entfaltung einiger grundlegender Gedanken und Argumente zur ‚Grammatik der Medien‘ gelesen und verstanden werden kann, deren Bedeutungsgehalt sich im sukzessiven, interpretativen Nachvollzug anzunähern ist.
Das genaue Gegenteil wird mit der dritten Lesart versucht. In einer Art dialektischem Umschlag soll hier vor allem darauf geachtet werden, was brüchig ist, inkonsequent, widersprüchlich, ideologisch bedenklich. Dafür scheinen McLuhans Texte sogar das ideale Übungsfeld; denn es gibt kaum etwas in diesen Texten, das nicht kritisierbar wäre. Gerade in der Differenz der Herangehensweisen der zweiten und dritten Lesart zeigt sich, dass in den einzelnen Kapiteln nicht einfach unterschiedliche Facetten des Werks von McLuhan beleuchtet werden. Vielmehr soll deutlich werden, dass mitunter sogar dieselben Phrasen, Textstellen, dieselben Argumente, die in der hermeneutischen und in der kritischen Lektüre auftauchen, jeweils so unterschiedliche Deutungen erfahren, dass schwerlich noch von demselben McLuhan zu sprechen ist.
In der letzten Lesart wird erneut eine Kehrtwendung vollzogen. Hier wird nach den pragmatischen Aspekten in McLuhans Texten gefragt. So geht es denn nicht mehr darum, die rhetorischen Strategien McLuhans zu analysieren, aus hermeneutischer oder kritischer Perspektive zu fragen, was McLuhans Werk eigentlich ausmacht. Vielmehr wird gefragt, welche Aspekte durch Rezipient:innen mit unterschiedlichen Interessen nutzbar gemacht wurden bzw. heute noch nutzbar zu machen sind, völlig unabhängig von Fragen der Schlüssigkeit des Gesamtwerks, dessen Widersprüche oder seiner ideengeschichtlichen Kontextualisierung. McLuhans enigmatisches, je nach Interpretation faszinierend facettenreiches oder einfach nur wirres Werk ist, um hier nur ein Beispiel anzuführen, nützlich allein schon deshalb, weil es denjenigen, der in McLuhans Gedankenwelt einführen will, dazu provoziert, eine ungewöhnliche Darstellungsweise zu wählen.
1Lesart: Rhetorik – McLuhan singen
Rhetorik der Form
Das erste massive Problem, mit dem sich Leser:innen konfrontiert sehen dürften, wenn sie einen Text von McLuhan lesen, betrifft die ungewöhnliche Form. Argumentative Folgerichtigkeit, umsichtige Entfaltung des Gegenstandes oder eine klare Fragestellung – solche Dinge scheinen McLuhan kaum zu kümmern. Das hat im Laufe der Rezeption seines Werkes zu einigen Irritationen geführt (um es zurückhaltend zu formulieren).1 Nicht, dass McLuhans Werk mit vielen Sentenzen aufwartet, die sich in endlosen Satzwindungen verzweigen. McLuhan ist meilenweit entfernt von den syntaktischen Girlanden eines Jacques DerridasDerrida, Jacques oder den verschachtelten Genitivungetümen Martin HeideggersHeidegger, Martin. Ganz im Gegenteil sogar: McLuhans Schreibweise ist eher geprägt von vergleichsweise kurzen, prägnanten Formulierungen. Andere Dinge sind es, die eine Lektüre von McLuhans Texten anstrengend machen und frustrieren können: Es sind die wilden Assoziationsketten und kühnen Analogien, der permanente Einsatz von Slogans (und damit notorisch unscharfen Formulierungen), die elliptische, sprunghafte Darstellungsform, nicht zuletzt der Metaphernreigen mit einem Faible für Paradoxien und Kalauer. Darüber hinaus beinhalten McLuhans Bücher einen für wissenschaftliche Texte erstaunlich hohen Redundanzanteil. So kann man sich bei der Lektüre eines Buches von McLuhan trotz aller Sprunghaftigkeit und Uneindeutigkeit kaum des Eindrucks erwehren, in einer Endlosschleife gefangen zu sein. Die immer gleichen Slogans und Plattitüden verfolgen einen auf Schritt und Tritt.
Diese eigentümliche Form – und das hat der kanadische Medienforscher selbst immer wieder betont2 – ist wichtig für das Verständnis von McLuhans Texten. Was mit einigem Recht durchaus als wirr und unwissenschaftlich bezeichnet werden kann,3 lässt sich zwar kaum in etwas umdeuten, das auch nur entfernt klassischen wissenschaftstheoretischen Minimalstandards genügt. Nichtsdestotrotz folgt die Form einer rhetorischen Strategie, der nachzugehen lohnend ist. Die Sprunghaftigkeiten und Redundanzschleifen sind durchaus kalkuliert. McLuhan will auf seine Rezipient:innen mit der eigentümlichen Organisation seiner Texte eine bestimmte, noch näher zu klärende Wirkung ausüben. Die Leser:innen sollen im klassisch rhetorischen Sinne überredet, statt argumentativ überzeugt werden. Diese ‚Überredungskunst‘ erfolgt aber weniger auf inhaltlicher Ebene; vielmehr wird die Form relevant. Dass die Form generell das Entscheidende ist bei der Rezeption von Artefakten – und damit eben auch bei der Lektüre von Texten –, und weniger ihr Inhalt, dieser Kardinalmaxime der Ästhetik (und spätestens seit McLuhan auch der Medienforschung) gilt in einem besonderen Sinne gerade für McLuhans Werk selbst. Hier wird nämlich die Form zu einer rhetorischen Strategie, die jenseits argumentativer Inhalte und Folgerichtigkeit alle nur denkbaren Phänomene zwischen Pop und GottGott verbindet. Eine rhetorische Strategie ist das deshalb, weil die Rezipient:innen dazu gebracht werden sollen, selbst solch einen vernetzten und vernetzenden Standpunkt einzunehmen. Insofern betrifft die Rhetorik der Form einen wichtigen, vielleicht sogar den entscheidenden Aspekt der ‚McLuhan’schen Botschaft‘. Das heißt ebenfalls, dass jeder Lektüre, die McLuhans Texte vor allem im Hinblick auf ihre Argumente und Inhalte hin liest und beurteilt, die eigentliche Pointe dieses Œuvres entgehen muss.
1.1Close Reading
‚Wilde Assoziationen‘, ‚kühne Analogien‘, ‚Ellipsen‘, ‚Metaphern‘, ‚Paradoxien‘, ‚Kalauer‘, ‚Wiederholungsschleifen‘, ‚sloganfähige Formulierungen‘ – solche Bezeichnungen wurden eingangs gewählt, um die stilistische Eigentümlichkeit der Texte McLuhans zu kennzeichnen. So etwas schreibt sich leicht und schnell hin (und verkürzt McLuhans Werk selbst auf einige wenige, inzwischen in der Forschungsliteratur gängige ‚Slogans‘). Um aber diesen Formulierungen mehr Substanz zu verleihen, soll die Funktionsweise der Form genauer an einem konkreten Beispiel beschrieben werden. Dabei werde ich jedoch zunächst nicht, wie in der Sekundärliteratur zu McLuhan sonst üblich, auf die wenigen bekannten Slogans McLuhans eingehen. Dort wird gern auf den Hang McLuhans zur paradoxen Formulierung verwiesen, wie er sich idealtypisch zeigt in der Wendung „Das Medium ist die Botschaft“. Oder man macht darauf aufmerksam, dass die Wendung „Gutenberg-Galaxis“ eine Alliteration und überdies hochgradig metaphorisch ist.1 Zusätzlich wird noch auf die mosaikartige Struktur der Texte McLuhans verwiesen,2 um sich dann aber rasch in Richtung des vermeintlich eigentlichen Gegenstandes, eben den inhaltlichen Thesen, von der Beschreibung der Form zu verabschieden.
Für eine angemessene Beschreibung der Textorganisation sind aber solche kurzen Verweise auf die Form einiger prägnanter Slogans nicht ausreichend. Erfolgsversprechender ist es, eine längere Textpassage einem close reading zu unterziehen.3 Denn überhaupt erst im genaueren Nachvollzug eines längeren Textabschnitts kann gezeigt werden, wie die Darstellungsform McLuhans spezifische Konturen gewinnt und sich entfaltet. Zu diesem Zwecke wurde aus McLuhans bis dato bekanntestem Buch, nämlich DIE MAGISCHEN KANÄLE, das 19. Kapitel ausgewählt; es trägt den Titel „Rad, Fahrrad und Flugzeug“.4 Ein anderer Ausschnitt hätte zur Veranschaulichung ebenfalls gewählt werden können. Denn der spezifische ‚McLuhan-Sound‘ findet sich, so zumindest meine Unterstellung, überall in den MAGISCHEN KANÄLEN, ja, mehr oder weniger ausgeprägt in jedem Buch des Medienforschers. Aus einem einfachen Grund wurde aber genau dieses Kapitel gewählt: Es ist kein herausragendes Kapitel, kein besonders klares, aber umgekehrt auch nicht voller ungewöhnlich wilder Textpassagen. „Rad, Fahrrad und Flugzeug“ ist ein Kapitel wie viele andere im Textuniversum McLuhans und eben genau deshalb exemplarisch.5
„Rad, Fahrrad und Flugzeug“
Auf gerade einmal knapp 12,5 Seiten legt McLuhan in diesem 19. Kapitel einen beeindruckenden Parforceritt hin: Nahezu die gesamte Kultur- und Technikgeschichte wird durchkämmt. Vom „Nahrungssammeln der Nomaden“6 bis zur vermeintlich kurz bevorstehenden „elektromagnetische[n] Automation“7 mithilfe des Computers geht die Reise. Dabei schreitet der Text aber keineswegs chronologisch voran. Es wird also nicht eine Kultur- und Technikgeschichte erzählt, die sukzessive von der Erfindung des Rades über das Fahrrad hin zum Flugzeug voranschreitet, wie es doch die Überschrift „Rad, Fahrrad und Flugzeug“ nahelegt. Vielmehr wird ständig die Perspektive gewechselt und neu angesetzt. Oder anders formuliert: McLuhan schlägt horizontale Schneisen durch das Dickicht der Kultur- und Technikentwicklung, anstatt seinem Gegenstand in der historischen Entwicklung linear zu folgen. Dabei verkettet er unterschiedliche Phänomene in Folgebeziehungen. Schematisch lassen sich mindestens zehn solcher Schneisen unterscheiden, die Folgebeziehungen ausbilden und im Text nacheinander entfaltet werden (vgl. Abb. 1).
Folgebeziehungen im Kapitel „Rad, Fahrrad und Flugzeug“
Diese Liste von Folgebeziehungen soll hier nicht auf ihre inhaltliche Plausibilität hin überprüft werden.8 Wichtiger ist die Präsentation und Organisation des Materials. Auffällig ist zunächst: Immer ein technisches Artefakt bildet den Ausgangspunkt einer Entwicklungslinie. Häufig werden dabei sehr ungewöhnliche Folgebeziehungen behauptet. Dass die Töpferscheibe verantwortlich für die Sesshaftigkeit des Menschen sein soll (Folgebeziehung 8) oder dass das Feudalsystem ein Resultat der Erfindung des Steigbügels darstellt (Folgebeziehung 1), sind nicht nur recht exotische und erklärungsbedürftige Kausalverkettungen. Sie sind überdies in ihrer sprachlichen Pointierung irritierend, jedoch auch durchaus betörend: „[D]as Feudalsystem als gesellschaftliche Erweiterung des Steigbügels“9 zu bezeichnen, hat aphoristische Qualität, die viele Formulierungen McLuhans, gerade seine bekanntesten Slogans, charakterisiert. Darauf wird zurückzukommen sein.
Die einzelnen Folgebeziehungen sind weder chronologisch angeordnet noch auf derselben Ebene angesiedelt. So ist die sechste Folgebeziehung von der Erfindung des Rades über das Fahrrad zum Flugzeug vielleicht erklärungsbedürftig, zumindest jedoch noch chronologisch nachvollziehbar. Zudem sind Rad, Fahrrad und Flugzeug kategorial auf derselben Ebene angesiedelt, sind doch alle Fortbewegungsmittel. Mit dem Übergang zur siebten Reihe greift McLuhan jedoch das Thema Fahrrad noch einmal auf, geht also chronologisch gesehen wieder einen Schritt zurück. Das Fortbewegungsmittel Fahrrad wird dann mit gesellschaftlichen Spezialisierungstendenzen in Zusammenhang gebracht, deren Resultat Wahrnehmungs- und Übertragungsmedien wie Telegrafie, Radio und Fernsehen sein sollen, die wiederum nach McLuhans Überzeugung die Tendenzen der Spezialisierung im elektronischen Zeitalter umkehren. In der achten Reihe erfolgt demgegenüber ein zeitlicher Sprung von einigen tausend Jahren zurück zur Töpferscheibe. Diese Rückkehr in die Vergangenheit wird nicht eigens begründet oder gar direkt mit der zuvor dargelegten Reihe verknüpft. Überdies wird hier die Kategorie gewechselt, geht es doch nun nicht mehr, wie zuvor noch, um Fortbewegungs-, Wahrnehmungs- oder Vermittlungsmedien, sondern um ein technisches Hilfsmittel zur Herstellung von Haushaltswaren. Gegen Ende dieser Folgereihe kommen wir wieder zum Rad, also dem Ausgangspunkt der sechsten Reihe zurück. Hier wird aber nicht mehr, wie zuvor, die Linie Rad → Fahrrad verfolgt. Stattdessen zeichnet McLuhan die Entwicklung eines Straßennetzes als Resultat der Erfindung des Rades nach. Eine andere Entwicklungslinie wird, erneut ausgehend vom Rad, in der nächsten Sequenz verfolgt: Dort werden Effekte des Rades auf Zentralismus und Städteentwicklung diskutiert. Dabei landet McLuhan, über den Umweg des Autos, letztlich wieder, wie bereits in der sechsten Reihe, beim Flugzeug und dessen Effekten.
‚Forschungsreisen‘
McLuhans Geschichtsschreibung operiert in dem Kapitel „Rad, Fahrrad und Flugzeug“ also mit Brüchen, zeitlicher wie kategorialer Art. Ständig wird neu angesetzt, verschiedene Folgebeziehungen werden ausgebildet und neue Zusammenhänge ausprobiert. Der Text scheint damit, auf den ersten Blick zumindest, eine rastlose, ja ziellose Suchbewegung zu dokumentieren, permanent neu ansetzend, weitere Bahnen ziehend, die sich überschneiden und verzweigen. In einem Interview, das mit McLuhan geführt wurde, wird diese Herangehensweise von ihm selbst sehr präzise charakterisiert:
Ich begebe mich auf Forschungsreisen, bei denen ich nie weiß, wohin sie mich führen werden. […] [M]eine Bücher zielen eher darauf, den Prozeß des Entdeckens offenzulegen, als mit einem fertigen Ergebnis aufzuwarten. Statt meine Ergebnisse traditionsgemäß steril in schön geordnete Versuchsreihen, Kategorien und Schubladen zu stecken, verwende ich sie wie Probebohrungen, um Einblick in gewisse Dinge zu gewinnen und Strukturen zu erkennen.10
Nicht die Ergebnisse einer ‚Forschungsreise‘ werden also in einem ‚Forschungsbericht‘ vorgestellt. Vielmehr wird eine ‚Forschungsreise‘ samt ihrer ausufernden Verzweigungen im Text selbst in Szene gesetzt.
Solch eine Darstellungsform ist aber keineswegs einfach chaotisch oder wirr. Denn, wenn auch McLuhans ‚Probebohrungen‘ nicht systematisch aufeinander aufbauen und keine kontinuierlichen Kausalketten ausbilden, so heißt das noch lange nicht, dass die einzelnen Segmente untereinander ohne Zusammenhang sind. Im Gegenteil sogar: Zwischen den einzelnen Folgereihen sind mannigfaltige Verbindungsoptionen angelegt. Damit ist nicht nur gemeint, dass McLuhan im Text immer wieder aus unterschiedlichen Perspektiven auf Rad, Fahrrad und Flugzeug zu sprechen kommt. Einige Segmente sind darüber hinaus chronologisch wie kausal zu verbinden. So lässt sich bspw. retrospektiv die achte Folgereihe vor die sechste setzen und damit zeitlich wie kausal mit dieser verbinden. Denn das Rad bildet das Ende der einen Folgereihe und den Ausgangspunkt der anderen. Somit geht es von der Töpferscheibe zum Rad und von dort zum Flugzeug. In diesem Sinne lassen sich auch die achte und die zehnte Reihe verbinden. Das letzte Element der achten Reihe, die Straße, lässt sich nämlich direkt an den Ausgangspunkt der zehnten Reihe, das Auto, anschließen.
Die AppellstrukturAppellstruktur der Texte
Entscheidend ist: Ordnen müssen diese Segmente die Rezipient:innen selbst. Die Leser:innen erhalten also unterschiedliche Folgereihen, die nicht chronologisch oder gar kausal angeordnet sind. Sie sind Elemente wie in dem Computerspiel TETRIS: Die Spieler:innen erhalten relativ willkürlich Bausteine, die sie zu Reihen ordnen müssen. Dabei entstehen immer wieder unvollständige Reihen und Lücken. Durch das Schließen nachfolgender Reihen erhalten die Spieler:innen jedoch wieder die Möglichkeit, die Lücken mit anderen Elementen aufzufüllen. Ganz ähnlich müssen die Leser:innen bei McLuhan unterschiedliche Reihen resp. Bausteine selbst zusammensetzen, um chronologische und kausale Ordnung herzustellen. Zudem, und das zeigt das Beispiel eben auch, haben die Leser:innen unterschiedliche Möglichkeiten, die Folgereihen zu verbinden und kommen so zu unterschiedlichen ‚Geschichten‘. Wenn man etwa die achte Reihe vor die sechste setzt, dann erhält man eine andere Folgebeziehung, als wenn man stattdessen die achte Reihe mit der zehnten verbindet. Einmal verzweigt sich der Weg vom Rad ausgehend einmal hin zum Fahrrad, das andere Mal hin zum Auto (ohne dass diese wiederum in eine Folgebeziehung gebracht werden). Einige Teile passen also zwar zueinander, können aber unterschiedlich ‚ineinandergesteckt‘ werden. Oder um es mit einer kriminalistischen Metapher zu umschreiben, die McLuhan selbst gewählt hat: Er formulierte einmal, er fühle sich wie ein Panzerknacker. „Ich weiß nie, was ich innen finden werde. Ich setze mich einfach hin und beginne zu arbeiten. Ich suche herum, ich höre hin, ich teste etwas aus […]. Ich probiere es in einer anderen Reihenfolge […].“11 Genau solche Panzerknacker sollen die Leser:innen McLuhans ebenfalls werden. Sie müssen suchen, testen, unterschiedliche Reihenfolgen ausprobieren „bis sich das Schloß öffnet und die Tür aufspringt.“12
…Falls denn das Schloss aufspringt. Denn so leicht macht es einem McLuhan nicht. Es bleiben, selbst wenn man die Reihen akribisch neu geordnet und unterschiedliche Verzweigungen bedacht hat, erhebliche (Verständnis-)Lücken. Auch bei einer einigermaßen chronologischen Gruppierung der Segmente bleibt bspw. die Folgebeziehung von Radpflug und Steigbügel weiterhin ein Rätsel. Ebenso verharrt das Verhältnis der Effekte untereinander, die das Rad in seinen unterschiedlichen Funktionen und zu unterschiedlichen Zeiten ausgelöst haben soll, im Dunkeln. Was Ernährungsveränderung, Zentralisierung oder Spezialisierung miteinander zu tun haben, verharrt im Unbestimmten. Im Kapitel „Rad, Fahrrad und Flugzeug“ werden also viele Verbindungen nahegelegt, aber die genaue Verbindungen der Textsegmente bleiben zumeist unscharf.
McLuhan operiert hier mit einer vor allem aus fiktionalen Texten bekannten Strategie, die der Literaturwissenschaftler Wolfgang IserIser, Wolfgang als „AppellstrukturAppellstruktur“13 literarischer Prosa bezeichnet. Fiktionale Texte operieren nämlich vornehmlich mit sogenannten Leerstellen. Mit Isers Beschreibung dieser Leerstellen scheint aber auch ziemlich genau der Appellcharakter der Texte McLuhans charakterisierbar zu sein: „Immer dort, wo Textsegmente unvermittelt aneinanderstoßen, sitzen Leerstellen, die die erwartbare Geordnetheit des Textes unterbrechen.“14 Die Pointe solcher Leerstellen besteht also darin, eine relative Unbestimmtheit zu erzeugen. Ein weites Beziehungsgeflecht ist angelegt, das nur teilweise expliziert wird. Damit sind dem Text auch viele Beziehungsmöglichkeiten eingeschrieben, die im ‚Akt des Lesens‘, also zuallererst durch die Rezipient:innen, aktualisiert bzw. realisiert werden. Den Leser:innen wird in McLuhans Texten, analog zur modernen Literatur, die nach Iser mit einem hohen Anteil an Leerstellen operiert, eine aktive Rolle zugewiesen. Die Leser:innen müssen selbst sehr kreativ mit dem Text umgehen und ein, zumindest im Vergleich zu konventionellen wissenschaftlichen Texten, hohes Maß an Fantasie und kombinatorischem Geschick aufbringen, wollen sie die Leerstellen sinnhaft schließen. Oder um es in McLuhans Vokabular zu formulieren: Die Leser:innen von McLuhans Texten müssen recht gewiefte, kreative und geduldige Panzerknacker sein. Und selbst, wenn sie das Schloss tatsächlich knacken und die Tür aufspringt, besteht immer noch die Gefahr, wie McLuhan selbst nicht ohne Ironie betont, dass „der Safe“ durchaus „leer“ sein könnte.15
Auf der Suche nach Ähnlichkeit
In dem hier näher untersuchten Textabschnitt wird Kultur- und Technikgeschichte aber nicht nur mittels diverser Folgebeziehungen vorgestellt, die mehr oder minder aneinander anschließbar sind und unterschiedlichen Interpretationen offenstehen. Ein weiteres Merkmal, das im Kapitel „Rad, Fahrrad und Flugzeug“ omnipräsent in Erscheinung tritt, ist die Perspektive, aus der McLuhan die Kultur- und Technikgeschichte durchforstet. Unablässig scheint er auf der Suche nach Ähnlichkeiten zu sein. So wird bspw. eine Ähnlichkeit hergestellt zwischen der Mobilität eines europäischen Bauern aus dem 13. Jahrhundert, der seinen Wagen von einem Ochsen ziehen lässt, und der Mobilität eines „motorisierten Farmer[s]“16 in Kanada des 20. Jahrhunderts. Dabei wird keine wie auch immer geartete Folgebeziehung behauptet, sondern nur eine Strukturanalogie: Spezifische Prinzipien der Landwirtschaft des 13. Jahrhunderts sollen dieselben sein wie solche, die im 20. Jahrhundert zu finden sind.
Universeller und um einiges verschachtelter funktioniert eine Analogie, die für das 19. Kapitel der MAGISCHEN KANÄLE relevant ist, aber bereits im ersten Kapitel eingeführt und erläutert wird:17 Alle technischen Artefakte sind laut McLuhan Ausweitungen des menschlichen Körpers. Dabei erfüllen sie in strukturell ähnlicher Weise (wenngleich meist jedoch sehr viel effizienter) bestimmte Funktionen von Körperteilen oder Sinnen.18 So soll etwa das Rad, wie McLuhan im 19. Kapitel nicht müde wird zu betonen, die mechanische Erweiterung des Bewegungsablaufs der Füße sein. Das Rad funktioniert demgemäß also ähnlich wie die Füße und wird gleichzeitig entwicklungslogisch als deren Fortsetzung verstanden. Dasselbe gilt für architektonische Einrichtungen, wie bspw. Städte: Ihre Entwicklung und Aufteilung entspricht der des menschlichen Organismus. Deshalb werden Städte als die technik- und kulturhistorische Ausweitungen des Körpers verstanden.19 Also auch hier: Körper und Städte werden strukturanalog gesetzt und in eine Folgebeziehung gebracht.
Um einiges kühner noch werden Rad und Töpferscheibe im 14. Abschnitt des Kapitels „Rad, Fahrrad und Flugzeug“ ins Verhältnis gesetzt. Die Drehbewegung der Töpferscheibe, die zur vertikalen Herstellung eines Gegenstandes dient, wird mit der Drehbewegung eines Rades, das die horizontale Fortbewegung eines Gegenstandes ermöglicht, analog gesetzt. Nachdem die Strukturanalogie gefunden ist, werden Töpferscheibe und Rad in einer (doch recht kontraintuitiven) Kausalkette verbunden: Die Töpferscheibe ermöglicht es uns, Gefäße aus Ton herzustellen. Das wiederum macht es möglich, Dinge länger zu lagern, zu horten und gegen andere Dinge in großen Mengen zu tauschen. Für diesen Austausch wiederum ist ein geeignetes Transportmittel nötig, was letztlich zur Erfindung des Rades geführt haben soll. Durch das tertium comparationis, die Drehbewegung, werden also Dinge in Beziehung zueinander gesetzt, die zumindest nicht unmittelbar etwas miteinander zu tun haben.
Noch vertrackter als der Analogieschluss von der Töpferscheibe zum Rad ist der vom Rad zum Film, entfaltet in den Abschnitten 7 und 8 des 19. Kapitels. McLuhan weist in diesen Abschnitten darauf hin, dass in Filmkameras und -projektoren das Prinzip des Rades Anwendung findet. Was schlicht heißt: Es finden sich Rädchen in Kameras und Projektoren. So weit, so trivial. Der Analogieschluss zwischen Rad und Film ist auf einer anderen Ebene vollzogen. Der Film wird dafür zunächst in Verbindung zu einer natürlichen Bewegung gebracht, genauer zur Bewegung eines Pferdes. Der Erfindungslegende des Films entsprechend greift McLuhan dabei auf ein häufig kolportiertes Ereignis zurück: Der Fotograf Eadweard MuybridgeMuybridge, Eadweard wurde von Leland Stanford 1872 engagiert, um herauszufinden, ob ein galoppierendes Pferd alle vier Füße gleichzeitig von der Erde hebt oder eben nicht. Für die Beantwortung dieser Frage entwickelte Muybridge die Serienfotografie, die das Pferd in kurzen Zeitintervallen nacheinander im Galopp fotografiert. Dadurch konnte nicht nur bewiesen werden, dass Pferde im Galopp tatsächlich alle vier Füße von der Erde heben, sondern es war damit en passant ein Grundprinzip des Films gefunden: Bewegungsabläufe müssen zuerst in Einzelbilder segmentiert werden, bevor sie wieder zur Bewegungsillusion des Films synthetisiert werden können.20
Die Reihenfotografie MuybridgesMuybridge, Eadweard wird in Analogie zur Körperausweitung des Rades gesetzt. Wie aber lässt sich das verstehen? In der Reihenfotografie Muybridges wird ein Pferd im Galopp aufgenommen. Da es dabei darum ging, ob alle vier Füße zur selben Zeit von der Erde gehoben werden, kann McLuhan schreiben: „Die Filmkamera und der Projektor entwickelten sich aus dem Gedanken, den Bewegungsablauf der Füße zu rekonstruieren.“21 Da McLuhan das Rad als technische Erweiterung der Füße, genauer der Füße in Bewegung versteht, kann er die Filmaufnahme von Füßen, die in Bewegung sind, und die Ausweitung der Bewegung der Füße zum Rad in ein Ähnlichkeitsverhältnis setzen. Gleichzeitig vernetzt er beides kausal (ohne zu vergessen, noch ein Wortspiel einzubauen): „Das Rad, das als Ausweitung der Füße begonnen hatte, macht einen großen Schritt [sic!] nach vorne zum Filmtheater.“22 Kategorial unterschiedliche Dinge, Fortbewegungs- und Aufzeichnungsmittel werden durch das tertium comparationis ‚Füße in Bewegung‘ ähnlich gemacht, obwohl die Bezugnahmen auf die Füße ganz offensichtlich auf unterschiedlichen Ebenen erfolgen. Denn das Rad ist im ersten Fall historischer Ausgangspunkt der Entwicklung eines Fortbewegungsmittels, im zweiten Fall hingegen Objekt einer Aufzeichnungs- bzw. Darstellungsapparatur. Fuß, Rad und Film werden aber trotz aller kategorialen Differenzen via Analogie in eine ungewöhnliche Folgebeziehung gebracht.
Im darauffolgenden Abschnitt geht McLuhan vom Film aus und entwickelt eine Analogiekette, bei der er am Ende bei Flossen und Flügeln ankommt. Da der Film Fotografien aneinanderreiht, funktioniert er nach McLuhan wie ein „Fließband […]“.23 Gleichzeitig findet aber beim filmischen Prinzip eine „gewaltige Beschleunigung“ statt: „organische Prozesse und Bewegungen“ werden sichtbar.24 Strukturanalog dazu funktioniert wiederum das Flugzeug: „Durch Beschleunigung rollt das Flugzeug die Autobahn in sich selbst auf. Die Straße verschwindet im Flugzeug, wenn es sich von der Rollbahn abhebt […]. In diesem Stadium wird das Rad wieder von der Vogel- oder Fischform aufgenommen, die das Flugzeug annimmt, wenn es sich in die Lüfte hebt.“25 Die Analogiekette reicht also von Rad und Fließband über den Film zum Flugzeug, zu Flossen und Flügeln. In dieser Kette werden die Phänomene nicht etwa alle gleichgemacht. Ähnlichkeiten sind keine Identitäten. Mit den Analogien werden hier vielmehr sogar Differenzen modelliert. Wie gerade an den letzten Zitaten zu sehen ist, kann die Bedeutung innerhalb der Analogiekette geradezu ins Gegenteil umschlagen: vom mechanischen Prinzip ins organische, vom Rad zurück zu Flosse und Flügel. Damit macht McLuhan seine Analogien auch fruchtbar für seine Kultur- und Technikgeschichte, impliziert doch seine Analogiekette eine Rückkehr zu quasiorganischen Formen und eine Verabschiedung mechanischer Prinzipien.
Auf der Suche nach Querverbindungen
Per Analogien werden bei McLuhan Folgereihen generiert und ebenfalls „Querverbindungen“26 hergestellt und zwar mitunter zwischen sehr unterschiedlichen Dingen und Phänomenen, die räumlich wie zeitlich weit voneinander entfernt sein können: ‚Querverbindungen‘ zwischen Fuß und Rad, Rad und Fahrrad, zwischen Töpferscheibe und Fortbewegungsmittel, Stadt und Zentralismus, zwischen Film, Flugzeug und Fischflosse. Sie sollen die untergründigen ‚Wechselwirkungen‘ der Dinge beleuchten, die, so zumindest McLuhans Einschätzung, in der Wissenschaft bisher vernachlässigt wurden. Er schreibt: „Die verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen Rad, Fahrrad und Flugzeug überraschen jene, die noch nie darüber nachgedacht haben. Die Gelehrten neigen zur Arbeitshypothese, daß Dinge isoliert betrachtet werden müssen.“27 Das heißt: McLuhan will keine Isolation und keine Untersuchung, die die Phänomene in Einzelteile segmentiert, keine lineare Kultur- und Technikgeschichte, die fein säuberlich Ereignis an Ereignis reiht. Und das heißt dann umgekehrt eben auch nach der Maxime vorzugehen: Suche nach Querverbindungen und Wechselwirkungen! Anstelle linearer Darstellungen von Geschichtsprozessen geht es also um Vernetzung mittels Analogie.28
Ebenso ist diese Vernetzungsstrategien in der assoziativen Reihenbildung zu finden. Im Grunde geht es auch hier um Ähnlichkeiten. Nur werden nicht einzelne Dinge explizit in ein Ähnlichkeitsverhältnis gesetzt (‚das Rad ist wie der Fuß‘), sondern Phänomene, Merkmale oder auch Handlungen implizit aus einem Kontext in einen anderen übertragen und dabei von einem Textsegment in das nächste überführt. Mit Jacques Lacan könnte man so etwas eine metonymische Reihe nennen, die die syntagmatischen Beziehungen, also die Art und Weise der Wort- und Satzfolge des Textes, regelt:29 Ein Element aus dem einen Bereich wird herausgenommen und in einen benachbarten überführt; dort wird wiederum ein Element herausgegriffen und in einen weiteren benachbarten Kontext überführt usf. Somit finden sukzessive Verschiebungen der Bedeutungen und Kontexte statt, die nicht auf argumentativen Ableitungen oder kausalen Folgebeziehungen beruhen, sondern auf Assoziationen.
Ein Beispiel aus dem Kapitel „Rad, Fahrrad und Flugzeug“ soll dieses Prinzip der metonymischen Reihe verdeutlichen: In Abschnitt 10 beschäftigt sich McLuhan mit der Rolle des Fahrrades in Samuel Becketts Theaterstücken. Er deutet das Fahrrad als „Ursymbol des cartesianischen Geistes“.30 Als solches wird es als Ausdruck der Entfremdung des modernen Menschen verstanden. Wie fragwürdig solch eine Deutung auch sein mag, wichtig ist etwas anderes: McLuhan kommt in diesem Kontext darauf zu sprechen, dass der Mensch in Becketts Stücken als Clown in Szene gesetzt wird. In Abschnitt 11 wird genau dieser Aspekt aufgegriffen und auf Humpty Dumpty, eine fiktive Figur, bezogen, die aus einem populären Kinderreim stammt und in der Erzählung ALICE IM WUNDERLAND einen kurzen, aber wichtigen Auftritt hat. Das menschenähnliche Ei Humpty Dumpty ist nach McLuhan ein Clown, der auf einer Mauer sitzt. In Abschnitt 12 erfährt dann das Thema Mauer eine nähere Entfaltung. Die Mauer wird als Zeugnis menschlicher Spezialisierung und Entfremdung interpretiert, die das Schicksal Humpty Dumpties besiegelt: Es fällt von der Mauer und zerspringt. „Mauern sind aus einheitlichen Ziegelsteinen gemacht, die mit der Spezialisierung und den Bürokratien aufkommen. Sie sind Todfeinde ganzheitlicher Wesen, wie es das Ei ist. Humpty Dumpty antwortete auf die Herausforderung der Mauer mit einem aufsehenerregenden Sturz.“31 Der Sturz bildet im nächsten Abschnitt den Ausgangspunkt für den Verweis auf den Roman FINNEGANS WAKE von James JoyceJoyce, James. Nach McLuhan ist das große Thema des Romans das „Zeitalter der Elektrizität“,32 in dem ganzheitliches Denken, nach einer langen Zeit der Spezialisierung und Entfremdung, wieder möglich ist. Joyce betrachtet aus dieser Perspektive ein Zeitalter, das dabei ist – und hier kommt McLuhan in Form einer Metapher auf das menschenähnliche Ei zurück – „Humpty-Dumpty wieder zusammenzusetzen“33 (vgl. zu dieser metonymischen Reihe: Abb. 2).
Metonymische Reihung und Leerstellen
Ist die assoziative Reihe von Abschnitt 10 bis 13 noch vergleichsweise stabil und findet mit der Interpretation künstlerischer Darstellungen ein einigermaßen homogenes Themenfeld, so fällt der Übergang zu Abschnitt 14 sehr hart und unvermittelt aus. Von Humpty Dumpty, dem Zeitalter der Elektrizität und FINNEGANS WAKE wird nämlich mit einem harten Schnitt einige Jahrtausende zurückgesprungen, nämlich zur Töpferscheibe als Agens geschichtlicher Entwicklung (vgl. Abb. 2). Damit wären wir wiederum bei dem bereits genannten formalen Aspekt von McLuhans Texten angelangt, dem Einsatz von Leerstellen: Abschnitt 13 stößt unvermittelt an Abschnitt 14, „die erwartbare Geordnetheit“ des Textes wird „unterbrochen.“34