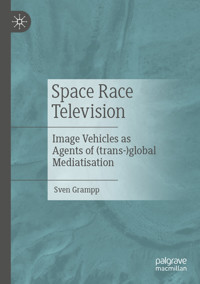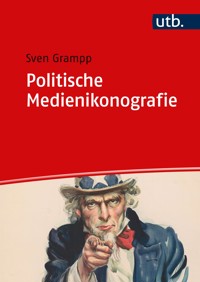35,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: UTB GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieses Lehrbuch stellt medienübergreifend unterschiedliche Analysezugriffe vor, so dass der Leser befähigt wird, mediale Kontexte unterschiedlich zu analysieren. Dargestellt am konkreten Beispiel der Fernsehserie Buffy the Vampire Slayer bezieht sich das Lehrbuch ebenso auf die Bereiche Fotografie, Film, Comic oder Computerspiel.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 492
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Sven Grampp
Medienanalyse
UVK Verlag · München
Umschlagmotiv: © Sven Grampp
© UVK Verlag 2021— ein Unternehmen der Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetztes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
Einbandgestaltung: Atelier Reichert, Stuttgart
utb-Nr. 5333
ISBN 978-3-8252-5333-2 (Print)
ISBN 978-3-8463-5333-2 (ePub)
Inhalt
1 Zur Einführung I Eine Warnung
Eine Warnung vornweg: Nicht alle, ja nicht einmal besonders viele Medien werden hier analysiert.
Die, die ich näher in den Blick nehme, untersuche ich auf den folgenden Seiten aus einer recht eingeschränkten Perspektive, nämlich aus einer medienwissenschaftlichen, genauer noch: aus dem Blickwinkel einer kulturwissenschaftlich ausgerichteten Medienwissenschaft.
In sechs Schritten sollen die Implikationen solch einer Ausrichtung ausbuchstabiert werden, um deutlich zu machen, was die Leser und Leserinnen auf den folgenden knapp dreihundertfünfzig Seiten erwarten können und eben auch, was nicht.
1.1Kulturwissenschaftliche Medienanalyse
Unter Medienwissenschaft wird hier erstens eine kulturwissenschaftliche Erforschung von Medien verstanden (vgl. zur Auflistung zentraler Merkmale solch eines Zugriffs Abb. 1.1). Das bedeutet zunächst einmal eine Beschneidung möglicher Zugriffe: Es wird nicht primär um quantitativ fundierte Studien gehen, in denen etwa Einschaltquoten einer Fernsehserie im Zentrum stehen, die Geschwindigkeit der viralen Verbreitung eines Meme oder die Häufigkeit eines Hashtakes wie #MeToo gezählt und ausgewertet werden. Vielmehr handelt es sich – wie zumindest bei traditionell kulturwissenschaftliche Analysen üblich1 – um qualitative Ansätze und damit um mehr oder minder spekulative, wenngleich begründungsorientierte Interpretationsvorschläge zum angemessenen oder doch zumindest besseren Verständnis medialer Artikulationsformen in deren jeweiligen kulturellen, sozialen, institutionellen wie technischen Situiertheit.2
Zentrale Merkmale und Zugriffe einer medienwissenschaftlich orientierten Medienanalyse in kulturwissenschaftlicher Tradition
Zweitens: Medienwissenschaft wird hier als ein Forschungsfeld verstanden, das sich in drei Teilgebiete ausdifferenzieren lässt, nämlich in Theorie, Historiografie und Analyse (vgl. Abb. 1.2).3 Einerseits unterscheiden sich diese Teilgebiete in ihrem jeweiligen Zugriff auf den Gegenstand Medien. So geht es in der Medientheorie um die universelle Bestimmbarkeit von Medien und um das, was Medialität prinzipiell auszeichnet. Historiografie ist demgegenüber das Teilgebiet, in dem am Gegenstand das interessiert, was sich im Lauf der Zeit verändert und wie sich diese Veränderungen beschreiben lassen. Analyse kann wiederum von Theorie und Historiografie insofern abgrenzt werden, als dabei das konkrete Medienprodukt im Fokus steht. Weder wird die Fernsehserie in ihrem Wesen bestimmt noch werden Fernsehserien im zeitlichen Verlauf ins Verhältnis zueinander gesetzt. Stattdessen wird eine Fernsehserie in ihre zentralen Einzelteile zerlegt und deren Verhältnis zueinander bestimmt.
Das Universale, das Wandelbare und das Konkrete: Medienwissenschaftliche Teilbereiche
Anderseits sind die drei Teilgebiete medienwissenschaftlicher Forschung eng miteinander verzahnt. Um das nur am hier relevanten Teilgebiet der Medienanalyse durchzuspielen: Ohne Hypothese darüber, was die Fernsehserie an und für sich auszeichnet, kann keine konkrete Analyse einer Fernsehserie durchgeführt werden. Ohne historische Verortung einer Fernsehserie im Verhältnis zu anderen Fernsehserien, keine Idee davon, was an der untersuchten Serie anders oder exemplarisch sein könnte. Aber auch andersherum gilt: Ohne Analysen von Fernsehserien wären medientheoretische Hypothesen über die vermeintliche Medialität der Fernsehserie nicht überprüfbar, ja, nicht einmal zu formulieren. Ebenso wenig sind Fernsehserien in ihrem historischen Verlauf ins Verhältnis zu setzen ohne ein Mindestmaß an Kenntnis der zentralen Elemente einzelner Serien, die zuallererst deren Vergleichbarkeit garantiert. Auf dieses Zusammenspiel wird später noch einmal konkreter zurückzukommen sein.4
Doch zuvor soll zur näheren Bestimmung, dessen, was die Medienanalyse ausmacht, genauer auf deren Spezifika eingegangen werden: Im Zentrum der Medienanalyse steht – wie angeführt – das Konkrete. Das heißt drittens: Analysen von Medien finden ihren medienwissenschaftlichen Ausgangspunkt und Kern in einzelnen Medienprodukten. Nicht die Medien oder der Film sind Ausgangspunkt der Medienanalyse, sondern eine mediale Artikulationsform, etwa ein spezifischer Film. An solch einer medialen Artikulationsform sind wiederum zuvorderst die unmittelbar sinnlich wahrnehmbaren Eigenschaften, insbesondere die audiovisuellen Erscheinungsformen, und deren mögliche symbolische Bedeutungen als Zeichenträger relevant. Dieses Verständnis von Medienanalyse ist zuvorderst einer philologischen Tradition verpflichtet, bei der es einerseits primär um die kleinteilige Auslegung und Kommentierung einzelner Texte geht. Anderseits werden Texte in dieser Tradition häufig als Reflexionsinstanzen übergreifender kultureller Zusammenhänge betrachtet oder als exemplarischer Ausdruck beispielsweise für den Stil eines Autors, einer literarischen Epoche, einer Gattung oder sogar als symptomatisch für kollektive psychologische Dispositionen, Ideologien und Weltbilder interpretiert.5 Ganz ähnlich werden auch jenseits literarischer Texte mediale Artefakte so aufgefasst. Beispielsweise muss ein bestimmtes Gemälde als Ausdruck einer exemplarischen Bildaufteilung frühholländischer Landschaftsmalerei herhalten, ein Film für die Continuity-Regeln des Classical Hollywood Cinema. Ein Musikvideo wiederum wird so zur Reflexionsinstanz gemacht, die die Praktiken der Medienindustrie ironisch kommentiert. Eine Serie muss herhalten als Beispiel für die Funktionsweise des Cliffhanger in Daily Soaps oder noch weitreichender als symptomatischer Ausdruck der Funktionslogik einer neoliberalistischen Aufmerksamkeitsökonomie dienen.6
Viertens wird vorausgesetzt: Zur Analyse von Medien werden Methoden benötigt. Vom Wortstamm her bedeutet Methode das Aufzeigen eines Weges, dem jeder folgen können soll, der die Wegbeschreibung beherzigt.7 Weniger metaphorisch und gegenstandsorientierter gewendet: Methoden sind über mediale Einzelfälle hinaus intersubjektive, auf Wiederholung angelegte Verfahrensregeln, wie mediale Gegenstände zu untersuchen sind. Ich gehe damit von einer – in den Kulturwissenschaften durchaus umstrittenen8 – Prämisse aus, nämlich: Es gibt analog zu quantitativ-statistischen Zugängen auch in den qualitativ-interpretierenden Wissenschaften allgemeine und erlernbare Regeln, wie bei einer Analyse medialer Artikulationsformen vorzugehen ist. Noch normativer ausgedrückt: Neben allen Reflexionen, Hinterfragungen und Relativierungen, die unzweifelhaft die Kernkompetenzen aller Kulturwissenschaften sind, muss es dennoch Methoden geben, die die konkreten Untersuchungen Einzelfall übergreifend ermöglichen. Ohne die Wahl einer Methode bleibt jede Untersuchung medialer Artikulationsformen ein beliebiges, subjektives Geschmacksurteil, im besten Fall noch eine interessante, wenn auch unbegründete Meinung, im schlechtesten Fall die affektive Artikulationsreaktion auf einen Stimulus von der Qualität eines „Schau, wie schön!“ oder „Ach, wie unfassbar interessant!“.
Fünftens: Aus der Voraussetzung, dass es Methoden zur Analyse geben muss, folgt aber keineswegs der Schluss, es gebe die Methode zur Analyse der Medien. Das Gegenteil ist vielmehr der Fall – und das ist gut so: Gerade die Vielfältigkeit der Methoden, die die Medienwissenschaft gleichzeitig bevölkern, ist nicht Ausdruck dafür, dass Medienwissenschaft unwissenschaftlich sei, beliebig in ihrer Wahl des Zugriffs oder ihrer Gegenstände. Die vielen Methoden der Medienwissenschaft sind im Gegenteil deren reflexive, kritische wie kreative Stärke. Dementsprechend gilt es in vorliegender Einführung nicht nur zu zeigen, dass es medienwissenschaftliche Methoden gibt bzw. geben sollte und wie diese aussehen. Darüber hinaus wird auch vorgeführt, welche unterschiedlichen, mitunter widerstreitenden Methoden existieren und inwieweit die Wahl einer bestimmten Methode mitentscheidet, was wie überhaupt in den Blick kommen kann (und eben auch, was damit dem Blick entzogen bleiben muss). Je mehr methodische Zugriffe bekannt sind, desto eher ist zu beurteilen, welche Methode zur Analyse eines bestimmten medialen Artefakts bzw. bestimmter Aspekte eines medialen Artefakts geeignet sind. Andersherum gilt freilich auch, das damit deutlich(er) wird, was ausgeschlossen oder stillschweigend vorausgesetzt ist und was wiederum mit einem anderen methodischen Zugriff anders oder besser in den Blick kommen könnte.
Dementsprechend lautet eine der zentralen Devisen vorliegender Einführung in Anlehnung an einen markanten Buchtitel des Wissenschaftstheoretikers Paul Feyerabend: ‚Wider den Methodenzwang!‘9 Damit soll aber gerade nicht gemeint sein, Medienanalysen seien ohne Methoden durchzuführen oder es ist ganz egal, welche Methoden zur Anwendung kommen, sondern es ist vielmehr ein Plädoyer dafür, keinem Zwang zu einer Methode zu unterliegen, da immer auch andere Möglichkeiten der Analyse bestehen und andere Möglichkeiten als Alternativen zur jeweils gewählten Methode bewusst sein sollten. Denn so bleibt die jeweils gewählte Methode (und damit die selbst gewählte Untersuchungsperspektive) kritisch zu hinterfragen und gegen andere, möglicherweise produktivere Zugänge auszutauschen oder zumindest mit diesen abzugleichen. Damit ist die vorliegende Einführung in die Medienanalyse genaugenommen auch ein doppeltes Plädoyer. Gilt doch: ‚Wider den Methodenzwang!‘ Statt Zwang soll es eine Vielzahl an Methoden geben. Aber genau so gilt: ‚Wieder (!) den Methodenzwang!‘ – denn beharrt wird darauf, dass Medienanalysen (wieder und wieder) klaren Regeln folgen müssen.
Sechstens: Medienwissenschaftliche Analysen nehmen ihren Ausgangspunkt – wiederum in der Tradition philologischer Disziplinen – häufig bei der Untersuchung ästhetischer Formen von Kunstwerken, insbesondere fiktionaler Provenienz. Es ist indes nicht so, dass in medienwissenschaftlichen Analysen keine dokumentarischen Formate, politischen Bildikonen oder Tweet-Nachrichten untersucht werden. Nichtsdestotrotz stehen diese Formate und Bereiche nicht im Zentrum des medienwissenschaftlichen Analysegeschäfts. Dieser Tradition soll auch hier gefolgt werden: Ausgangs- und Schwerpunkt werden exemplarische Analysen ästhetischer Formen und Formbildungsprozesse eines fiktionalen audiovisuellen Medienproduktes sein. Bei diesem fiktionalen Medienprodukt handelt es sich um die Serie Buffy the Vampire Slayer (im Folgenden kurz: Buffy). Diese auf den ersten Blick vielleicht willkürlich erscheinende Wahl soll im Folgenden etwas ausführlicher begründet werden.
1.2Warum Buffy?
Dass zur exemplarischen Darstellung von Medienanalysen ausgerechnet die Wahl auf eine Serie fällt, findet einen ersten Grund darin, dass viele populäre Medienprodukte der Gegenwart seriellen Charakter aufweisen. Damit ist nicht nur die kaum überschaubare Zahl an derzeit produzierten und distribuierten Serien von Streaming-Diensten wie Netflix oder Amazon Prime gemeint, sondern ebenso Filme, die sich in vielen Fällen inzwischen serieller Vernetzung zu eigen machen. Zu denken ist in diesem Zusammenhang nur an die vielen Marvel-Superheldenfilme, die sich nicht nur dieselbe Erzählwelt teilen, sondern zudem aufeinander aufbauen und Bezug nehmen. Weiterhin lässt sich in diesem Kontext auf eine kaum mehr überschaubare Anzahl an Computerspielreihen, Snapshot- oder Podcast-Serien verweisen, die ältere serielle Produkte in Heftchenformaten, als Fortsetzungsromane oder Comicstrips längst, wenn schon nicht abgelöst, so doch zumindest quantitativ um ein Vielfaches überflügelt haben. Serialität scheint medienübergreifend ein, wenn nicht das zentrale Prinzip populärkultureller Erzähl- und Darstellungsweise der Gegenwart zu sein. Eben deshalb bietet sich die Untersuchung einer konkreten Serie als exemplarische Analyse eines populärkulturell relevanten, medienübergreifenden Phänomens an.
Dass es nur eine Serie sein soll, hat ein schlichtes Motiv: Durch die Beibehaltung eines Gegenstandes bei gleichzeitigem Wechsel des Analyseinstrumentariums kann übersichtlich gezeigt werden, wie ein und dasselbe Medienprodukt unter verschiedenen Fragestellungen und mit unterschiedlichen Erkenntniszielen produktiv untersucht werden kann.
Dass es gerade die US-amerikanische Serie Buffy sein soll, an der die unterschiedlichen Analyseansätze vorgestellt werden, hat mehrere Gründe: Neben praktischen und idiosynkratrischen Beweggründen, wie Besitz der DVD-Gesamtbox oder nostalgische Erinnerungen an vergangene Jugend- und Studientage,1 spielt die Abgeschlossenheit der Serie eine gewisse Rolle. Zumindest bezüglich ihres ursprünglich zentralen Erzählstrangs hat die Serie Buffy, die zunächst – wie viele anderen Serien auch – auf unbestimmte Laufzeit angelegt war, inzwischen ein Ende gefunden. Produziert und ausgestrahlt zwischen 1997 und 2003 in sieben Staffeln auf den US-amerikanischen Sendern The WB und ab der sechsten Staffel auf UPN in 144 Episoden à ca. 42 Minuten, wurde die Fernsehserie Buffy ab 2011 dann mit einer achten Staffel als Comic wiederbelebt und fortgesetzt. Ihren Abschluss fand die Serie mit der zwölften Staffel am 19.9.2018. An diesem Tag wurde das letzte Comicheft publiziert unter dem passenden Titel Finale.2
Aufgrund dieses Endes lässt sich die Serie erstens als vergleichsweise umfangreiches und doch abgeschlossenes ‚Werk‘ in Augenschein nehmen. Damit kann vom Ende her präzise die facettenreiche Seriendynamik untersucht werden, nämlich wie ein zartes, junges blondes Mädchen namens Buffy gemeinsam mit ihren Freunden und Freundinnen durch die Jahre ihrer Adoleszent hin zum Erwachsenalter mit Vampiren, Dämonen, aber auch den Widrigkeiten des alltäglichen Lebens kämpfen muss – und zwar gemäß dem seriellen Prinzip von Wiederholung und Variation. Dabei ist zu beobachten, wie in Buffy nicht etwa nur immer wieder dasselbe nur ein wenig anders erzählt wird. Vielmehr wird die tiefenstrukturelle Logik der Serie selbst im Lauf der Ausstrahlungszeit verändert: Von Episoden, die buchstäblich dem Monster-of-the-Week-Prinzip folgen, verändert sich Buffy sukzessive zu einer experimentierfreudigen Serie mit weit ausgreifenden story arcs.
Weiterhin geht mit dem Ende der Serie ein gewisser historischer Abstand einher, vom Ende der Fernsehserie aus betrachtet sind es knapp 15 Jahre. Das ist durchaus von Vorteil: In der Zwischenzeit wurden nicht nur viele Analysen in Texten, Monografien und Sammelbänden zur Serie vorgelegt, zusätzlich finden sich unzählige Homepages, Blog-Einträge und lexikalische Texte, in denen vor allem die Fernsehwelt von Buffy mit akribischem enzyklopädischem Archivierungseifer aufgearbeitet wurde. Damit ist mir einerseits dankenswerterweise einiges an Aufarbeitungsarbeit abgenommen worden. Anderseits können diese Beiträge selbst wiederum zum Bestandteil einer Medienanalyse im Umfeld der Serie gemacht werden.
Allein schon der Umstand, dass Buffy während der Entfaltung ihrer Erzählwelt die mediale Plattform wechselt, prädestiniert die Serie wiederum für eine medienübergreifende Analyse. Da sich zudem vergleichsweise früh ein Fankult um Buffy entwickelt hat, mit all seinen Konsequenzen, von Merchandisingprodukten, Erregung diskursiver Aufmerksamkeit (nicht zuletzt in akademischen Kreisen) bis hin zur Entstehung unzähliger Fan Fiction und – bereits vor der narrativen Fortsetzung der Fernsehserie im Comic ab 2011 – der Etablierung eines Buffyverse bestehend aus mehreren medialen Trägern (Romane, Comics, Spin-offs, Computerspiele), liegt umso mehr gerade für diese Serie eine Medien vergleichende, vernetzende und -übergreifende Analyse nahe. Damit ist der Gegenstand Buffy besonders geeignet, in die Medienanalyse einzuführen, eben, weil die Serie über eine mediale Plattform hinaus erzählt. Dementsprechend können Analysen zu Buffy weit mehr sein als bloße Untersuchungen zu einer Fernsehserie – die dann ein paar Jahre nach der Absetzung als Comic, vorrangig für hartgesottene Fans, fortgesetzt wurde –, nämlich tatsächlich exemplarische Medienanalysen mit Emphase auf der Pluralität medialer Formen und Träger, die dabei involviert sind.
Je länger die Serie Buffy erzählt, desto mehr denkt sie über sich selbst nach, reflektiert sie die eigenen seriellen Grundprinzipien, rekurriert auf andere Medienprodukte, zitiert sich selbst und mehr noch unzählige andere populärkulturelle Phänomen, betreibt also, wenn man so will, selbst (Medien-)Analyse. Das nimmt mir einerseits analytische Arbeit ab, weil die Serie selbst darauf hinweist, wie sie operiert. Anderseits lassen sich solche Selbst- und Medienanalysen wiederum analysieren hinsichtlich ihrer spezifischen stilistischen wie narrativen Ausgestaltungen und Funktionalisierungen.
Trotz all der angeführten Qualitäten, die Buffy zu etwas Besonderem machen, war für die Wahl dieser Serie wichtig, dass die Serie gerade nicht zu den außergewöhnlichsten, geschweige denn radikalsten oder komplexesten Serien der Welt gehört. Eine althergebrachte didaktische Maxime der Kunstwissenschaft lautet: ‚Keine Meisterwerke! Halte Dich für den Anfang vielmehr an ‚einfache‘, handwerklich solide Werke!‘ An diesen Exemplaren seien nämlich die Grundprinzipien und Regeln bildlicher Organisation sehr viel besser und klarer zu erläutern als an herausragend innovativen, subtilen oder komplexen Bildern. Auf die Gefahr hin, Buffy-Fans zu erzürnen (und/oder durch das Festhalten an einer scheinbar antiquierten und/oder normativen Kunstvorstellung Leser*innen gegen mich aufzubringen), lässt sich diese Einschätzung auf die Fernsehserie Buffy übertragen: Wenngleich die Serie durchaus viele Raffinessen hat, so ist sie auf formaler Ebene doch weit weniger innovativ und experimentierfreudig als Fernsehserien wie The Prisoner, Twin Peaks, Lost, About:Kate oder Westworld. Aber gerade die klaren Linien des seriellen Erzählens, die transparenten Entwicklungsdynamiken, die eindeutige Bildorganisation, die vergleichsweise übersichtliche Figurenkonstellation, die überschaubare Ausweitung der Erzählung auf weitere mediale Plattformen sowie die Explizitheit der verhandelten Themen machen Buffy zum nahezu idealen Einstiegsschulungsobjekt für Medienanalysen (vgl. für einen Überblick genannter Gründe Abb. 1.3).
All die ganzen Gründe zur Wahl des exemplarischen Analysegegenstandes
Selbstverständlich setzt die ausführliche analytische Beschäftigung mit einer Serie voraus, dass man sie sehr gut kennt. In meinem Studium begann ein Dozent für Literaturwissenschaft seine Veranstaltungen immer mit einem Textkenntnistest. Wer den nicht bestand, flog raus. Immer wieder betonte der Dozent, wolle man sich wirklich mit einem Roman wie Der Zauberberg analytisch beschäftigen, müsse man als Voraussetzung dafür einfach ohne nachzuschlagen wissen, welche Farbe die Schnürsenkel von Hans Castorp haben.3 Obwohl Buffy meist Schuhe trägt, die keine Schnürsenkel haben, scheint mir dieser Hinweis doch bedenkenswert. Will man es wirklich ernst nehmen mit konkreten Analysen, sollte man über seinen Forschungsgegenstand bestens Bescheid wissen. Dies impliziert in den allermeisten Fällen, dass es sich lohnt, sich mit einem Gegenstand sehr genau auseinanderzusetzen, ja, dass man von ihm fasziniert ist und ihn besser verstehen möchte. Demzufolge ist die analytische Beschäftigung mit einem Gegenstand häufig mit Sympathie für den Gegenstand verbunden (oder aber mit so abgrundtiefer Ablehnung, dass man die Kraft aufbringt, genau zu zeigen, was an diesem Gegenstand zu kritisieren ist). Jedenfalls gilt in beiden Fällen: Solche Analysen sind immer auch Werbung dafür, sich die Serie anzuschauen oder sie noch einmal genauer anzuschauen.
Indes – das sei hier ausdrücklich betont – ist es keinesfalls eine notwendige Voraussetzung, Buffy zu kennen, um der vorliegenden Medienanalysen folgen zu können (es wird also keinen Serienkenntnistest geben). Zentrales Ziel ist es, eine möglichst nachvollziehbare und systematische Veranschaulichung unterschiedlicher analytischer Zugriffsweisen am Beispiel von Buffy geben zu können. Es geht also nicht oder doch zumindest nicht zuvorderst um eine Lektüre für Fans der Serie.
1.3Spezifik und Herausforderung medienwissenschaftlicher Analysen
Medienwissenschaftliche Analysen haben diverse Eigentümlichkeiten. So wird erstens in medienwissenschaftlichen Beiträgen häufig nach der Medienspezifik gefragt.1 Beispielsweise ist dann der Unterschied zwischen mündlicher, schriftlicher und filmischer Darstellung relevant, die Abgrenzung von Fotografie und Bewegtbild oder die Differenz zwischen aktivierendem Computerspiel und vermeintlich passivem Fernsehkonsum. Unterschiedliche mediale Konstellationen ermöglichen, erfordern und limitieren bestimmte Kommunikations- und Wahrnehmungsformen – so eine zentrale medienwissenschaftliche These. Dementsprechend sensibel sollte man bei solchen Analysen für die jeweiligen medialen Spezifika sein.
Zweitens gilt: Die These von der Medienabhängigkeit des Vermittelten bedeutet für die Medienanalyse eine nicht unerhebliche Herausforderung. Soll doch vorliegende Arbeit qua Titel eine Einführung in die Medienanalyse sein und nicht eine in die Mediumanalyse, etwa in die Film- oder Fernsehanalyse. Allein schon deshalb kann es nicht nur um eine medienspezifische Analyse, etwa einer Fernsehserie, gehen. Stattdessen müssen immer auch andere Medien und deren Analysierbarkeit im Blick bleiben. Diese Anforderung wird dann besonders prekär, wenn sehr unterschiedliche Medien untersucht werden. So scheint es wenig Sinn zu machen, Twitter-Nachrichten mit einen Analysezugriff zu untersuchen, der sich um Fragen nach dem Verhältnis von Plot und Story dreht. Analysen zu Radiosendungen werden schwerlich mit Roland Barthes visueller Semiotik arbeiten können, die dieser anhand von Werbefotografien entwickelt hat, usw.
Daraus ergeben sich zwei gegenläufige Anforderungen: Soll doch einerseits – wie unter Punkt 1 vermerkt – bei medienwissenschaftlichen Analyse die Medienspezifik des Gegenstandes berücksichtig werden, gleichsam muss anderseits trotz aller Spezifik auf eine mediengrenzenüberschreitende Anwendbarkeit der analytischen Methoden geachtet werden oder zumindest eine Übertragbarkeit auf andere mediale Zusammenhänge gewährleistet sein. Genau so etwas leistet meines Erachtens die Konzentration auf eine Serie, die auf unterschiedlichen medialen Plattformen verteilt erzählt wird. Denn so sind zum einen medienübergreifende Analysen allein schon deshalb gefordert, um die Ausweitung der Erzählzone ins ‚Expanded Buffyverse‘ nachvollziehen zu können, ohne aber zum anderen deshalb gleich die Frage nach medienspezifischer Darstellung verabschieden zu müssen.
Drittens erfordert eine kulturwissenschaftlich fundierte Medienanalyse die Untersuchung des Verhältnisses von Medien zueinander, sei es in Form ästhetischer oder diskursiver Abgrenzungen, in Form von Übernahmen und Überbietungen, sei es durch Ausweitung der Erzählzone auf mehrere Medien.
Viertens: Da alles Mögliche als Medium bestimmt werden kann, wird es – trotz des Titels Medienanalyse – letztlich doch nur um eine sehr selektive Analyse bestimmter Medien mit einem bestimmten, der kulturwissenschaftlichen Tradition folgenden Zuschnitt gehen.2
Da mediale Produkte – wie etwa die Serie Buffy – mitunter die Eigenart haben, selbst über Medien nachzudenken, muss eine kulturwissenschaftlich orientierte Medienanalyse fünftens auch eine Medienanalyse zweiter Ordnung sein. Die medienwissenschaftlichen Analytiker*innen analysieren so in gewissem Sinne auch, wie die von ihnen analysierten Medien Medien analysieren.
Sechstens: Eine letzte Eigenart, die angeführt werden soll, betrifft die Geschichte medienwissenschaftlicher Analysen. Waren es in der kulturwissenschaftlichen, speziell der philologischen Tradition insbesondere ästhetische Fragen, die medienwissenschaftliche Analysen auszeichneten und noch auszeichnen, so ist dennoch im Laufe der Jahre der Fokus auf andere Phänomene und Bereiche über die Analyse einzelner Medienprodukte hinaus ausgeweitet worden. Zu nennen sind hier insbesondere Fragen nach Machtkonstellationen, an denen Medien teilhaben und/oder diese ausbilden, nach kommunikativer Vernetzung von Akteuren über unterschiedliche Medien hinweg sowie Fragen bezüglich medientechnologischer Infrastrukturen.3 Letztere ermöglichen nicht nur materiell zuallererst Vernetzungen und stabilisieren Machtkonstellationen über weite Gebiete hinweg. Sie bedingen diese zudem jenseits der Wahrnehmbarkeit einzelner Medienprodukte und zeigen Effekte, die der unmittelbaren Sichtbarkeit erst einmal entzogen sind.
Herausforderungen an medienwissenschaftliche Medienanalysen
Auch wenn – wie bereits betont – in vorliegender Arbeit der Ausgangspunkt und das Hauptaugenmerk auf dem traditionellen Gegenstand medienwissenschaftlicher Analyse liegt, eben auf Formuntersuchungen, wäre es doch schlichtweg unredlich und unzeitgemäß diese spezifischen Ausweitungen medienwissenschaftlicher Analysezonen auszublenden (vgl. zusammenfassend Abb. 1.4).
1.4 Umkreisungen der Medienanalyse
Um all die kurz skizzierten, sehr unterschiedlichen Merkmale, Eigentümlichkeiten und Herausforderungen einer medienwissenschaftlichen Medienanalyse nicht zu ignorieren und dennoch in eine einigermaßen handhabbare, anschauliche und systematische Form zu bringen, habe ich mich dafür entschieden, unterschiedliche Aspekte und Zugriffe in eine Art Zwiebelschalenmodell zu überführen, bei dem der Untersuchungsgegenstand von Kreis zu Kreis sukzessive ausgeweitet wird. So sind immer weitere Elemente und Kontexte in die Analyse miteinzubeziehen (vgl. Abb. 1.5).
Zwiebelschalenmodell der Medienanalyse
Im Zentrum dieses Modells steht die Konzentration auf die kleinteilige und im Vergleich zu allen anderen Kreisen mit Abstand ausführlichste Analyse eines Medienprodukts, nämlich die Analyse seiner medialen Formen. Das bedeutet in diesem Zusammenhang konkret: Es wird die Art und Weise untersucht, wie – also mit welchen narrativen und audiovisuellen Formen – die Serie Buffy in Erscheinung tritt. Oder um es mit einem antiquierteren Begriff auszudrücken: Die Poetik der Serie steht hier im Mittelpunkt.
Mit dem nächsten Analysekreis wird der strikte Fokus auf serieninterne Aspekte aufgegeben und auf serienexterne Themen ausgeweitet. Zur Bezeichnung dieses Verhältnisses wurde der vielleicht gewöhnungsbedürfte Begriff Code gewählt. Ein Code ist zunächst nichts anders als eine Zuordnungsregel, die das Verhältnis von zwei unterschiedlichen Einheiten organisiert. Und in diesem Fall soll damit das Verhältnis von intra- und extraseriellen Einheiten gemeint sein, deren Zuordnungsregeln analysiert werden. Somit geht es um das Verhältnis von dem, wie erzählt wird zu dem, was erzählt wird, also auf was dabei Bezug genommen wird. Damit ist die Frage danach virulent, auf was in der Serie eigentlich referiert wird. Die serielle Erzählung verweist notwendigerweise über sich selbst hinaus, etwa auf andere Serien, Erzähltraditionen oder gesellschaftliche Problemlagen, die in der Serie verhandelt werden. Einige dieser Felder sollen näher betrachtet werden.
Der nächste Kreis trägt den Titel ‚Medien‘. Wichtig ist hier der Plural: Es geht um Verhältnisse, die die Serie Buffy, ursprünglich eine Fernsehserie, mit anderen Medien im Laufe der Zeit ausbildete.
Im Analysekreis Milieu geht es schließlich um das, was als Umwelt der Medien beschrieben werden kann, also um das, was die Medienprodukte umgibt, sie kontextualisiert und/oder überhaupt erst näher bestimmt, vor und jenseits konkreter Medienangebote.1 Das betrifft sowohl diverse Produktions- und Rezeptionsaspekte einer Fernsehserie wie Buffy als auch Fragen nach gesellschaftlichen Machkonstellationen bzw. technologischen Wahrnehmungsanordnungen.
1.5Binnendifferenzierung der medienanalytischen Zwiebelschale
Die Analyseebenen werden im Laufe der Arbeit noch einmal differenziert in unterschiedliche Analysehinsichten (vgl. Abb. 1.6). Die Poetik der Serie wird bei der konkreten Analyse unterteilt in narrative Formen (Kap. 3.1) – womit die Frage relevant ist, wie in der Serie erzählt wird – und audiovisuelle Erscheinungsweisen (Kap. 3.2) – womit speziell all das ins Zentrum rückt, womit etwas hörbar und sichtbar gemacht wird.
Binnendifferenzierung der Analyseebenen und Ausweitung des Analysegegenstandes
Auf Ebene des Codes findet eine Ausweitung des Analysegegenstandes statt, steht doch in den Abschnitten zum Thema Gender (Kap. 4.1) die Frage nach gesellschaflichen Machtverhältnissen im Zentrum. Bei der Untersuchung der Gender-Darstellung in einer Serie wie Buffy geht es immer auch darum, welche Männlichkeits- oder Weiblichkeitsbilder entworfen werden, welche Stereotypen affirmiert oder problematisiert werden, kurz: welche Genderpolitik betrieben wird. Eine Fernsehserie ist so interpretiert nicht nur ein ästhetisch mehr oder minder überzeugend gestaltetes Objekt, sondern ein Vehikel zur Artikulation und Diskussion gesellschaftlicher Vorstellungen und Problemlagen, beispielsweise bezüglich des Machtverhältnisses von Geschlechtern.
Die Ausweitung der Analysezone wird noch offensichtlicher im Kapitel 4.2, das sich mit dem Themenfeld Genre beschäftigt. Hier wird nämlich gefragt, ob Buffy bestimmte Genreeigenschaften aufweist, also Eigenschaften, die aus einzelnen Medienprodukten eine gemeinsame Klasse an Medienprodukten macht, die klassifiziert werden können, etwa als Horror, Melodrama oder Liebeskomödie und von anderen Klassen medialer Produkte zu unterscheiden sind, etwa vom Western, Science-Fiction oder Thriller. Diese Klassifizierungen erfüllen wiederum die Funktion der Erwartungsabstimmung zwischen Produzent*innen und Rezipient*innen. Damit ist die Frage nach dem Genre, nicht mehr nur eine Frage nach der Ästhetik beispielsweise einer Fernsehserie, sondern genau betrachtet – ähnlich wie im Fall von Gender – immer auch schon eine Frage nach Machtverhältnissen, geht es doch dabei um Normierungsprozesse der Serie auf Ebene der Produktion, der Gestaltung, Vermarktung und Koordination zwischen Produzent*innen und Rezipient*innen.
Im nächsten Schritt sollen Medien in den Blick genommen werden, genauer Verhältnisse von Medien. Dementsprechend ist dann nicht mehr nur relevant, wie sich Buffy auf andere Medienprodukte bezieht, ob der Serie Buffy bestimmte Genremerkmale zuzuweisen sind, ob die Serie ein Weltbild formuliert oder Machtverhältnisse reflektiert. Vielmehr ist der Gegenstand hier immer schon über die Fernsehserie Buffy hinaus ausgeweitet auf andere mediale Plattformen, die mit Buffy in unterschiedlicher Weise verbunden sind. So geht es nicht mehr nur um ästhetische Fragen bezüglich eines einzelnen Medienproduktes, sondern vielmehr um Fragen kommunikativer Vernetzung mehrerer Medien. Auf dieser Ebene sollen zunächst Phänomene der Intermedialität analysiert werden. Virulent ist somit die Frage, was zwischen den Medien geschieht, welche Differenzen etwa Buffy im Computerspiel zu Buffy in der Fernsehserie und im Comic aufweist oder auch welche Bezugnahmen das Computerspiel auf die Fernsehserie ausbildet (Kap. 5.1).
Hinter der Überschrift „Transmedialität“ (Kap. 5.2) verbirgt sich ebenfalls die Frage nach Medienverhältnissen. Im Gegensatz aber zur Intermedialität wird hier weniger untersucht, was zwischen den Medien geschieht, sondern das, was medienübergreifend vor sich geht, etwa wenn Buffy, die Fernsehserie, im Comic narrativ fortgesetzt oder aber in der Fanfiction variiert wird. Die Relevanz transmedialer Ausweitung, Verknüpfung und Koordination unterschiedlicher medialer Plattformen steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der medientechnologischen Infrastruktur, die solche Operationen überhaupt erst möglich macht. Es scheint kein Zufall zu sein, dass transmediales Erzählen einen signifikanten Aufschwung vor allem mit und durch die übergreifende Digitalisierung diverser Medienprodukte und deren Zirkulationsmöglichkeiten im World Wide Web gefunden hat. Jedenfalls gilt hier für einen medienanalytischen Zugriff auf Transmedialität, den Blick nicht nur auf medienübergreifende ästhetische Formen der Vernetzung zu richten, sondern ebenso auf die diesen Formen zu Grunde liegenden medientechnologischen Infrastrukturen.
Der Weg zur Untersuchung des Milieus ist damit schon beschritten. Dort geht es um die Analyse dessen, wie Medien mit ihrer Umwelt in Beziehung stehen. Die erst zu untersuchende Milieu-Kategorie ist das Ereignis (Kap. 6.1). Wichtig wird diese Kategorie für die Analyse vor allem in Form von Festen (zu denken sei hier nur an Weihnachten oder die Olympiade) und/oder Katastrophen (wie Erdbeben oder Anschläge). Denn diese Ereignisse sind meist nicht nur auch Medienereignisse, sondern haben als solche Medienereignisse massiven Einfluss auf Form, Struktur und Organisation anderer medialer Produkte und Programme. So werden um Weihnachten herum ‚besondere‘ Filme und Serien gezeigt und dabei der wöchentliche Rhythmus des Fernsehprogramms temporär außer Kraft gesetzt. Solch ein Außerkraftsetzen des alltäglichen Programmrhythmus ist noch stärker zu beobachten nach Katastrophen. Die Fernsehberichterstattung scheint dann nur noch ein Ereignis zu kennen oder zumindest seine Programmstruktur danach auszurichten. Fest und Katastrophe werden so zu Medienereignissen, die Auswirkungen auf Ausstrahlung oder gar den Inhalt von Medienprodukten haben. Solche Medienereignisse folgen einer Struktur, die sich methodisch als Umweltfaktor analysieren lässt, der Inhalt, Form und Rezeption von Medienprodukten präformiert. Zudem können Medienprodukte selbst zu Medienereignissen bzw als solche geplant werden. Beide Aspekte, der Einfluss von Medienereignissen auf die Serie Buffy als auch die kalkulierten Maßnahmen zur Herstellung der Serie als Medienereignis, sollen in den Blick genommen werden.
Im Kapitel zum Dispositiv wird der zu analysierende Gegenstand noch einmal um ein Vielfaches ausgeweitet und mit vielen heterogenen Elementen angereichert (Kap. 6.2). Ein Dispositiv ist zunächst eine Wahrnehmungsanordnung. Die medienwissenschaftliche Grundidee zum Dispositiv lautet: Ein Wechsel der Wahrnehmungsanordnung hat Einfluss darauf, wie etwas rezipiert werden kann. So macht es einen Unterschied, ob ich eine Buffy-Episode im Rahmen einer Retrospektive in einem Kino auf Großleinwand anschaue, im Fernsehen oder auf meinem Handy, ob ich mir die Episoden datenkomprimiert online herunterlade oder die Serie in DVD-Qualität studieren kann. Es macht sogar bereits einen Unterschied, ob die Serie im 4:3-Format oder im 16:9-Format rezipiert wird. Die Relevanz dieser Unterschiede lässt sich analysieren und sie sind aus einem medienwissenschaftlichen Blickwinkel durchaus von Interesse. Dennoch soll für die hier gewählten Analysen ein Dispositiv-Begriff herangezogen werden, der weit über die Bestimmung des Dispositivs als räumlich-materielle Wahrnehmungsanordnung hinausgeht. Mit Michel Foucault lässt sich das Dispositiv nämlich als ein komplexes Geflecht aus institutionellen, ökonomischen, gesetzlichen, habituellen und technologischen Elementen beschreiben, das auf Produktion, Zirkulation und Rezeption medialer Artefakte Einfluss hat, ja dieses zuallererst ermöglicht. Obwohl die dabei wichtigen Faktoren so vielfältig und heterogen sind, dass es gerade für eine konkrete Analyse sehr mühsam ist, diese Dispositiv-Vorstellung methodisch anwendbar zu machen, so scheint mir dennoch gerade diese Ausweitung attraktiv. Denn so können größere institutionelle, soziale und technologische Zusammenhänge, in die die einzelnen Medienprodukte eingebettet sind, beobachtet werden – und damit auch Machtkonstellationen und strategische Operationen, die eben nicht unmittelbar am Medienprodukt selbst sichtbar sind, sondern in einer vergleichsweise breiten Milieuanalyse des Materials zuallererst sichtbar gemacht werden müssen.
Trotz all der formulierten Ebenendifferenzierungen soll aber am Ende dieses Einführungskapitels betont werden: Die Unterteilung von Analyseebenen scheint mir zwar von hohem heuristischem Wert. Sie kann aber nicht bedeuten, dass die Ebenen nicht ineinandergreifen, ja, in konkreten Untersuchungen ineinandergreifen müssen. Aussagen über die serielle Ästhetik zu treffen – um nur ein besonders offensichtliches Beispiel zu nennen –, ohne Milieufaktoren wie Zeitraum der Ausstrahlung, Programmstruktur oder Aspekte der Aufnahme- und Ausstrahlungstechnologie in Betracht zu ziehen, muss von vorneherein die Medienspezifik serieller Ästhetik verfehlen. Genau deshalb gilt: Die geschilderten Ebenen werden zwar sukzessive im Buch abgearbeitet; Rück- und Vorgriffe auf Aspekte, die strikt betrachtet einer anderen Ebene angehören, werden dennoch zu finden sein, da sie in der konkreten Analysearbeit schlicht unumgänglich sind.
Zur besseren Orientierung wird in den einzelnen Kapiteln und Unterkapiteln eine kleine Einführung vorangestellt, in der formuliert wird, was dort jeweils zu erwarten ist. Diese Passage trägt den Titel Spoiler-Alarm! Jedes (Unter-)Kapitel schließt mit einer knappen Zusammenfassung. Diese Rubrik trägt den Titel, den Serien wie Buffy häufig ganz am Anfang ihrer Episoden platzieren, nämlich Recap . Hier wird klargemacht, was bisher (genauer: in dem zurückliegenden Kapitel) geschah. Die Rubrik Readings You Don’t Want to Miss! markiert danach in einer Art von Abspann das endgültige Ende der einzelne (Unter-)Kapitel. Dort finden sich Hinweise auf Basisliteratur zum jeweils vorgestellten Thema und/oder Tipps zur weiterführenden Lektüre.
Nach all diesen Warnungen, Absichtserklärungen, Vorstellung von Ablaufplänen, Kapitelunterteilungen, Ebenendifferenzierungen, Relativierungen dieser Ebenendifferenzierungen sollen ab folgendem Kapitel konkrete Analysen im Zentrum stehen. Dafür scheint es mir wiederum ratsam, nicht direkt mit analytischen Untersuchungen zur Serie Buffy einzusteigen. Zuvor soll erst einmal möglichst präzise erfasst werden, was eigentlich genau getan wird, wenn man analysiert oder zumindest, was getan werden sollte.
In diesem Kapitel wurde dargelegt, was der Leser und die Leserin von vorliegendem Text erwarten können, nämlich eine Einführung in diverse Analysezugriffe einer kulturwissenschaftlich orientierten Medienwissenschaft. Konkret bedeutet das: In diesen Analysen stehen einzelne Medienangebote im Zentrum, die ausgehend von ihren ästhetischen Formen kleinteilig interpretiert werden.
Vorliegende Einführung trägt den Titel „Medienanalyse“ mit gutem Grund. Soll doch der mit der Pluralwendung ‚Medien‘ erhobene Anspruch eingelöst werden. Dieser Anspruch besteht darin, eine Einführung in die Medienanalyse zu bieten, die tatsächlich für unterschiedliche Medien verwendbar ist (etwa Film, Fernsehserie, Computerspiel), gleichsam aber auch nach der Spezifik des einzelnen Mediums im Verhältnis zu anderen Medien fragt.
Genau genommen müsste der Titel vorliegender Einführung zwei Plurale beinhalten. Denn es werden hier „Medienanalysen“ vorgestellt, die auf ein und denselben Gegenstand unterschiedliche Zugriffe anwenden (beispielsweise Narrationsanalyse, Genderuntersuchung, transmedial orientierte Interpretationen). So soll gezeigt werden, welcher analytische Zugriff überhaupt für die Beantwortung welcher Fragen zielführend sein könnte.
Das zentrale Beispiel, an dem die diversen Analysen durchgeführt werden, ist die Fernsehserie Buffy. Dass es eine Serie sein soll, die sich in sieben Staffeln um ein zierliches blondes Mädchen dreht, das mit ihren Freunden und Freundinnen Vampire und Dämonen jagt, hat mit der besonderen Eignung dieser Serie zu tun, alle die hier vorgestellten Analysezugriffe repräsentativ durchdeklinieren zu können.
Ausgehend von kleinteiligen Analysen des ‚schönen Scheins‘ medialer Oberflächen bewegt sich vorliegende Einführung sukzessiv in immer umfassendere Sphären. So wird nach einem Close Reading der Formen, der Fokus erweitert hin auf die Frage nach der Gender- und Genredarstellungen oder nach dem transmedialen Gefüge, in dem die Serie situiert ist, bis hin zu Analyseansätzen, die die Serie als Bestandteil eines übergeordneten ökonomischen Machgefüges fassen.
David Bordwell/ Kirsten Thompson: Film Art. An Introduction (Boston u.a. 82008)
Wunderbar klare und anschauliche Einführung in die Formanalyse von Filmen.
Keine übergreifenden Medienanalysen, sondern eben nur auf den (Spiel-)Film bezogen.
Lothar Mikos, Film- und Fernsehanalyse (Konstanz/München 32015)
Systematische und facettenreiche Einführung in Film- und Fernsehanalysen mit konkreten Beispielanalysen. Gut geeignet zum Einstieg.
Die mediale Spezifik televisueller Angebote und Kontexte kommen nicht ausreichend in den Blick.
Lev Manovich: Instagram und Contemporary Art [2017], Online zugänglich unter: http://manovich.net/index.php/projects/instagram-and-contemporary-image [24.09.20]
Arbeitet vor allem mit Big Data-Analysen und Software gestützter Grafikvisualisierung, um transnational und auf Grundlage riesiger Datenmengen etwas über eine der gegenwärtig zentralen digitalen Plattformen herauszufinden. Damit wird ein analytischer Zugriff auf Medienangebote vorstellig, der in vorliegender Einführung keine Rolle spielt.
Kaum Anschluss an traditionell kulturwissenschaftliche Analysemethoden.
Nur sehr bedingt auf Bewegtbild- und Erzählmedien übertragbar.
2 Analyse I Eine Analyse
In diesem Kapitel soll dargelegt werden, was die zentralen Merkmale und Komponenten eines analytischen Zugangs sind.
Anhand eines Beispiels, der sogenannten Wahrheitswertetabelle, soll der idealtypische Ablauf einer Analyse vorgestellt werden.
Daran anschließend wird der Unterschied zwischen Oberflächen- und Tiefeninterpretation eingeführt, der für die weitere Untersuchung wichtig ist.
2.1Auflösen!
Wörtlich übersetzt bedeutet analysieren schlicht auflösen.1 Eine wissenschaftliche Analyse – häufig auch als Analytik bezeichnet – meint indes nicht etwa die Auflösung eines Gegenstandes ins Nichts, sondern eine systematische, regelgeleitete Auflösung eines Gegenstandes in seine zentralen Bestandteile zum besseren Verständnis seiner Funktionsweise. Dies impliziert, dass sich eine wissenschaftliche Analyse selbst mindestens in vier zentrale Bestandteile auflösen lässt: Eine Analyse ist eine (1.) Praxis abstrahierender Zergliederung, werde doch zentrale Bestandteile eines Gegenstandes unterschieden und systematisch geordnet. Solch eine Analyse hat (2.) eine normative Gewichtung zur Folge, werden doch nur zentrale Bestandteile eines Gegenstandes unterschieden, also solche, die als besonders relevant beurteilt werden, im Gegensatz zu solchen, die vernachlässigbar erscheinen. Es findet dabei (3.) eine selektive Negation statt, denn am Gegenstand bleiben nach der Analyse letztlich nur die zentralen Bestandteile erhalten. Diese zentralen Bestandteile sind (4.) Ausgangspunkt zur Interpretation des Gegenstandes, durch die die Frage beantwortet werden soll, in welcher Relation diese Bestandteile stehen, wie sie funktionieren und was sie bedeuten könnten (vgl. Abb. 2.1).
Die allmähliche Auflösung des Gegenstandes beim Analysieren
2.2Analyse in sieben Schritten
Dass überhaupt analysiert wird, setzt ein Problembewusstsein voraus. Dementsprechend gilt nicht nur für die Psychoanalyse: Ohne Problembewusstsein keine Gang zum Analytiker oder zur Analytikerin. Ist die Analyse doch primär ein Mittel zur Auflösung eines mehr oder minder drängenden Problems oder doch zumindest einer Irritation. Am Ende der Analyse steht – im Idealfall – ein systematisch entfaltetes Erklärungsangebot, wie etwas funktioniert oder doch zumindest verstanden werden könnte bzw. eine Antwort auf die Frage, auf welche Frage Film x oder die Serie y eigentlich eine Antwort sind. Ungeklärtes, Unverstandenes, vage Vermutetes sind so in und durch eine analytische Operation aufgelöst in Verstandenes, endlich Geklärtes, Gewusstes oder doch zumindest zu einem Vorschlag gewendet, wie etwas verstanden, erklärt, gewusst werden könnte. In manchen Fällen liefert die Analyse indes eine Erklärung, warum etwas nicht verstanden oder gewusst werden kann bzw. muss. Für all die genannten Fälle gilt: Analyse ist ein systematisches Mittel, Irritationen zu beseitigen.
Als systematisches Mittel zur Irritationsbeseitigung sind die analytischen Operationen der Zergliederung, Gewichtung und Selektion regel- und zielgeleitet, mit anderen Worten methodisch.1 Das hat unter anderem zur Konsequenz, sich von den eigenen Intuitionen distanzieren zu müssen, um diese aus Perspektive einer auf Regeln basierenden Anleitung und damit auf intersubjektive Nachvollziehbarkeit zielende Verfahrensweise überprüfbar zu machen. Analysen sind so gesehen immer auch Mittel kritischer Distanzierung, methodischerVerfremdung und auf Intersubjektivität angelegte Überprüfungen intuitiver Annahmen.
Da sehr unterschiedliche Methoden zur Analyse existieren, hängen die Möglichkeiten (und Limitationen) der Deutungen und Erklärungen, die Analysen liefern, entscheidend von der Wahl der jeweiligen Methode ab. Solch eine Wahl ergibt sich wiederum daraus, welche Fragen an den Gegenstand gestellt werden, welche Thesen aufgrund der Irritation zu erstellen sind. Diese Thesen und Fragen ergeben sich ebenso wenig wie die Deutungen und Erklärungen unmittelbar aus dem Gegenstand, sondern sind selbst fundiert in mehr oder minder explizit formulierten theoretischen Vorannahmen. Dementsprechend sind theoretische Annahmen neben der Existenz eines Gegenstandes, der uns in irgendeiner Weise irritiert, notwendige Voraussetzungen für die Analyse. Benannte Abhängigkeiten und Ebenen lassen sich zu einem idealtypischen Ablaufplan einer Analyse in sieben Schritten schematisieren (vgl. Abb. 2.2).
Sieben Schritte zum analytischen Glück
2.3 Beispiel: Wege und Methode der Wahrheitswertetafel
Zur Veranschaulichung dieses Analyse-Schemas sei ein Beispiel angeführt: Es handelt sich dabei um ein Hilfsmittel philosophischer Aussagelogik, die sogenannte Wahrheitswertetafel (vgl. Abb. 2.3).1 Eine Wahrheitswertetafel verdeutlicht durch Zuordnung aller möglichen Wahrheitswerte zu den kleinstmöglichen Teilaussagen, welcher Wahrheitswert der Gesamtaussage zukommt. Durch die Angabe der Teilaussagen (hier: A und B) und deren logischen Verknüpfungsoptionen durch sogenannte Junktoren2 ist ein Instrumentarium gegeben, um aussagelogische Beweise zu führen. Damit ist zu entscheiden, ob Aussagen wahr (w) oder falsch (f) sind bzw. ein Argument gültig oder ungültig ist.
Analyse in actu: eine Wahrheitswerttabelle am Beispiel zweier Variablen
Mit einer Wahrheitstabelle wird auf das Problem oder die Irritation reagiert, dass sprachliche Aussagen und Behauptungen nicht nur in sehr unterschiedlichen Formen vorliegen, sondern darüber hinaus nicht selten auf dieselben Gegenstände mit unterschiedlichen Worten und Sätze reagiert wird bzw. widersprüchliche Aussagen über Gegenstände vorliegen. Es wird also (I.) ein Gegenstand wahrgenommen (Sprache), der in seiner Vielfältigkeit und Widersprüchlichkeit irritiert und dementsprechend als problematisch erachtet wird (II.). Zur Untersuchung und letztendlichen Beseitigung dieser Irritation wird Sprache anhand eines formallogischen Kalküls regelgeleitet, also methodisch untersucht (IV.) – und zwar aufgrund einer zentralen theoretischen Prämisse (III.): Sachverhalte, deren Vorliegen in natürlichen Sprachen behauptet wird, lassen sich in Teilaussagen ausdifferenzieren und durch Junktoren formalisieren. Dies setzt eine atomistische Sprachtheorie voraus. In der methodischen Untersuchung werden die vielfältigen Erscheinungsformen natürlicher Sprachen durch Selektion (V.[3]) radikal reduziert und also ein großer Teil sprachlicher Artikulation negiert. Diese Selektion vollzieht sich nach einer normierenden Gewichtung (V.[2]): Relevant sollen nur die grundlegenden logischen Verknüpfungen zwischen Teilaussagen sein (keine Satzzeichen, Verben, Referenzen etc.), die wiederum in diverse Junktoren zergliedert werden (V.[1]). Die Gültigkeit aller argumentativ relevanter Aussagen sowie die aller möglichen Aussagen über Sachverhalte lassen sich dann durch Relationierung (VI.) der jeweils involvierten Junktoren und Variablen klar entscheiden und deuten. So kann unter formalisierendem Rückgriff auf eine tiefenstrukturelle Ebene natürlicher Sprachen erklärt (VII.) werden, wie Aussagen über Sachverhalte und Argumente wahr oder falsch sind. Ist das erst einmal verstanden, kann die Wahrheitswertetabelle als grundlegende Methodenmatrix zur Analyse aller möglichen Aussagen verwendet werden.
Obwohl einer der maßgeblichen Wegbereiter solch einer Wahrheitswertetafel, nämlich Ludwig Wittgenstein, überzeugt davon war, dass sich das, „[w]as sich überhaupt sagen läßt, […] klar sagen“3 lasse, und gleich hinzufügte: „wovon man nicht reden kann, darüber muß man schweigen",4 so hat er doch daraus sehr viel weitreichendere Konsequenzen gezogen. Die formale Grammatik der Sprache korrespondiert bei ihm mit der ‚Grammatik‘ der Welt, was bedeutet: Die Wahrheitswertetabelle korrespondiert mit den Verhältnissen in der (Tatsachen-)Welt und bildet diese angemessen ab. Damit ist zwar der Zusammenhang von Welt und Sprache erklärt, aber doch in einer recht spekulativen und theoretisch sehr voraussetzungsreichen Weise, die über eine strikt formale Kombination von Junktoren weit hinausgeht. Noch einmal recht eindringlich ist so vorgeführt, dass sich selbst in formalen Logik-Regionen Analyst*innen eben nicht mit einer wie auch immer gearteten Zergliederung des Gegenstandes begnügen. Eine bestimmte Form der methodischen Analyse ergibt sich auch dort keinesfalls unmittelbar aus einem Gegenstand, einem Sachverhalt oder mittels Aussagen, sondern aufgrund bestimmter theoretischer Voraussetzungen und Ziele.
2.4Oberflächen- vs. Tiefeninterpretation
Wie unterschiedlich die Interpretationen sind, das hat entscheidend mit den verschiedenartigen theoretischen Prämissen zu tun, die ihnen zu Grunde liegen. Diese theoretischen Grundlagen weichen hinsichtlich ihrer Vorannahmen und Ziele zum Teil so grundsätzlich voneinander ab, dass es sinnvoll scheint, eine Unterscheidung nach Typen und Klassen vorzunehmen. In einem ersten Schritt lassen sich Oberflächen- und Tiefeninterpretationen voneinander unterscheiden (vgl. Abb. 2.4).1
Klassifikation unterschiedlicher Interpretationswelten
Die Bezeichnung ‚Oberflächeninterpretation‘ ist keineswegs abwertend gemeint. Vielmehr soll damit ausgedrückt werden, dass die maßgebliche Instanz der Interpretation die Erscheinungsform (die ‚Oberfläche‘) von Romanen, Spielfilmen oder Fernsehserien ist, also deren sinnliche Manifestation. Solche Erscheinungsformen werden auf Intentionen hin interpretiert. Gefragt wird also nach den Absichten, die den Romanen, Spielfilmen oder Fernsehserien zu Grunde liegen, diese auf ein Ziel hin ausrichten und sich dementsprechend darin manifestieren. Intentionen haben eine finale Ausrichtung: Absichten werden verfolgt, um ein Ziel zu erreichen.
Bei einer Tiefeninterpretation sind hingegen die Intentionen schlichtweg irrelevant. Statt dessen wird das jeweilige Medienprodukt als ein Symptom gedeutet.2 Wie Fieber der sinnliche Ausdruck einer nicht unmittelbar wahrnehmbaren Krankheit sein kann, so ist aus diesem Blickwinkel das manifeste Medienprodukt Ausdruck latenter Kräfte, die das Medienprodukt kausal bedingen oder doch zumindest einen Möglichkeitshorizont bereitstellten, vor dem mediale Oberflächen überhaupt erst Bedeutung erhalten. Der Einsatz eines Cliffhanger lässt sich beispielsweise in einer symbolischen Lesart als Symptom gesellschaftlicher Wahrnehmungs- und Strukturwandel hin zu Fragmentierung und Diskontinuität interpretieren. Dabei ist es schlicht irrelevant, ob die Produzent*innen die Cliffhanger ästhetisch attraktiv konzipiert haben oder diese so gestaltet sind, damit sie dem Zweck des Nicht-Umschaltens dienen. Wichtiger als die Absichten der Beteiligten sind die Ursachen bzw. Bedingungen dafür, dass solche Lösungen und Strategien überhaupt gesucht und realisiert werden. Statt der Frage nach der finalen Absicht, geht es also um die Frage nach der kausalen Verursachung der Cliffhanger, die im Verborgenen liegt, jenseits von Intentionen, Funktionalsierungen und einzelnen sinnlichen Erscheinungsformen. Die Erscheinungsform des Produkts wird also verlassen und dient als Ausdruck von etwas anderem, was den Beteiligten zumeist tief verborgen ist und das es im Analyseprozess zu entbergen gilt.
Solche Tiefeninterpretationen sind freilich hochspekulativ und – im Gegensatz zu Oberflächeninterpretationen – sehr viel weniger am Material evident zu machen, eben, weil sie auf etwas abzielen, das nur indirekt zugänglich ist, sich niemals unmittelbar zeigt und das immer schon sehr viel mehr als spezifische Medienprodukte betrifft. Dass der Cliffhanger ein Symptom für ein fragmentiertes Weltbild der modernen Welt sein soll, ist der Form und dem Inhalt des Cliffhangers nicht nur nicht unmittelbar anzusehen, sondern setzt darüber hinaus ein erhebliches Maß an Kontextwissen bzw. Vorannahmen über bestimmte soziokulturelle Konstellationen voraus.
Der Unterschied zwischen Oberflächen- und Tiefeninterpretationen soll noch durch die Unterscheidung zwischen vertikal und horizontal gefasst werden, um möglichen Missverständnissen vorzubeugen. Oberflächeninterpretationen gehen zwar, wie beschrieben, von den sinnlichen Erscheinungsformen eines bestimmten Medienproduktes aus, sind aber keinesfalls darauf beschränkt. Vielmehr sind Oberflächeninterpretationen horizontal ausgerichtet. Das heißt zuvorderst: Sie sind nicht etwa auf das sinnlich Wahrnehmbare eines bestimmen Medienprodukts begrenzt. Auch Oberflächeninterpretationen gehen immer schon über das je zu interpretierende Medienartefakt hinweg und zielen auf andere Gegenstände. Dabei – und genau hierin unterscheiden sie sich von horizontal ausgerichteten Tiefeninterpretationen – wird aber nicht die Ebene gewechselt. So können weitere, prinzipiell sinnlich wahrnehmbare Medienartefakte in die Interpretation miteinfließen, etwa zur Interpretation eines Spielfilms als Element eines Genres, dem mehrere Filme zuzuordnen sind. Dies ist ein Beispiel für horizontale Erweiterungen der Beobachtung – von einem Film zu mehreren. Bei der Tiefeninterpretation hingegen wird die Ebene gewechselt, die Erweiterung der Beobachtung erfolgt vertikal zu einer anderen Art von Phänomenen, die tiefer liegt oder doch zumindest im Verborgenen hinter der Oberfläche mediale Artefakte. Ein Genre wird dann etwa als Ausdruck gesellschaftlicher Befindlichkeit interpretiert, die sich im Genre indirekt manifestiert.
2.4.1Zur Absicht des Werkes
Bei Oberflächeninterpretationen sind, wie angeführt, Intentionen wichtig. Ein Problem dabei besteht jedoch nicht nur darin, was eigentlich Intentionen sind,1 noch problematischer ist, wie überhaupt die entscheidenden Intentionen ausfindig zu machen sein sollen. Dieses Problem beginnt bereits damit zu entscheiden, welche Absichten etwa bei einer Fernsehserie dazu geführt haben, dass sie so aussieht, wie sie aussieht. Sind die Absichten des Showrunners entscheidend, die des ausführenden Produzenten, der Drehbuchautor*innen, der Regisseur*innen, des Fernsehsenders etc.? Noch prekärer wird die Frage nach den Intentionen, da diese ja nicht direkt im Medienprodukt sichtbar sind, sondern in der Interpretation herausgearbeitet werden müssen. Naheliegend scheint eine Befragung der maßgeblichen Produzent*innen nach ihrer Wirkungsabsicht (vgl. Abb. 2.6). Die Frage nach der sogenannten intention auctoris2 ist jedoch insofern problematisch, als diese Autoritäten über das Werk tot sein könnten und somit nicht mehr zu befragen sind, diese – sollten sie noch leben und bereit für Befragungen – lügen oder ein Spiel spielen könnten, das Teil ihrer künstlerischen Arbeit ist, oder sie schlicht selbst nicht genau wissen, was sie da getan haben.
Ein Ausweg aus diesen Schwierigkeiten bietet die Verlagerung der Intention ins Medienprodukt selbst bzw. – wie es in literaturwissenschaftlicher Tradition heißt – ins Werk, auf die sogenannte intentio operis. Hier lautet dann nicht mehr die Frage, was wollte uns der Künstler oder die Künstlerin eigentlich mit ihrem Werk sagen. Stattdessen stellt sich dann die Frage: Was sagt uns das Werk?
Der entscheidende Vorteil einer solchen Sichtweise besteht darin, dass die Interpretation aus dem Werk selbst entwickelt wird, unabhängig von den Aussagen seiner Schöpfer*innen dazu und unabhängig von der – besonders bei industriell und kommerziell hergestellten Produkten wie Filmen oder Fernsehserien schwierigen – Frage nach der entscheidenden Instanz, die für das Endresultat verantwortlich ist. Keineswegs muss dabei davon ausgegangen werden, dass die Macher einfach zufällig etwas getan haben, aber eben auch nicht davon, dass es eine zentrale Instanz gab, die vollkommen bewusst, autonom, unabhängig von Raum, Zeit, strukturellen Zwängen und materiellen Bedingungen eine ganz bestimmte Idee ins Werk gesetzt hat. Vielmehr ist es mit dieser Verschiebung möglich, gerade die Aspekte, die von den Intentionen der Produzent*innen unabhängig sind und diese bedingen, am Medienprodukt selbst in den Blick zu nehmen.
Da die Absichten und Interessen der Rezipienten und Rezipientinnen, die sogenannte intentio lecoris, für die Einschätzung eines Werkes noch sehr viel problematischer sind als die Einschätzungen seiner Produzent*innen – können doch je nach Begierde, Defizit, Persönlichkeitsstruktur, Stimmung etc. – Werke nach Belieben gedeutet werden, sagen diese wenig bis nichts über die Machart, Strategien und ästhetischen Formen eines Werkes aus. Wird dann noch in Betracht gezogen, dass bei einer Medienanalyse aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive empirische Wirkungsforschung keinesfalls im Zentrum steht3, sondern eben die Struktur eines spezifischen Medienprodukts, dürfte es kaum verwundern, dass dort insbesondere die intentio operis von Belang ist. Aus genannten Gründen wird auch in den folgenden Analysen genau diese Klasse der Oberflächeninterpretation zentral sein.
2.4.2Zur Ursache des Werkes
Für den Bereich der Tiefeninterpretation lässt sich Analoges formulieren: Auch, wenn es hier nicht mehr um die Intentionen der Akteure geht, sondern um die Ursachen für die Herstellung medialer Produkte, so ist dennoch aus einer medienwissenschaftlichen Perspektive zu formulieren: Ausgangspunkt zur Erforschung des Medienprodukts als Symptom für etwas anderes ist das Medienprodukt, nicht diejenigen, die es produzieren und auch nicht die Rezipient*innen. Denn im Medienprodukt verdichtet und stabilisiert sich materiell etwas, das somit sehr viel besser zu greifen ist als die mentalen unbewussten Ursachen der Produzent*innen und Rezipient*innen. Zumindest folgt dieses Verständnis der Tradition kulturwissenschaftlicher Zugriffe auf Medien. Stehen bei solchen Zugriffen doch nicht nur Medien im Zentrum, sondern die kleinteilige Auslegung medialer Formen und Motive. Von dort aus – nicht von den mentalen Prozessen der Produzent*innen oder den Rezipient*innen – wird dann nach den medientechnologischen, ökonomischen, kulturellen oder auch sozialpsychologischen Bedingungen der Medienprodukte gefragt. Etwa ließe sich so fragen, ob ein Cliffhanger Symptom eines bestimmten Weltbildes sein könnte, wenn er vor dem Hintergrund medientechnologischer, ökonomischer, kultureller und sozialpsychologischer Entwicklungen interpretiert wird. Analog zur intention operis ist hier von einer causa operis auszugehen, also von der Werkursache, die im Zentrum der medienanalytischen Aufmerksamkeit steht.1
2.4.3Interpretation als spekulative wie vielfältige Bedingung, Teil und Erklärung der Analyse
Was die langen Ausführungen über die Interpretationstätigkeiten während der Medienanalyse zeigen sollten, ist zum einen: Interpretationen sind notwendiger Bestandteil der Analyse und können nicht erst nach einer vermeintlich neutralen Zergliederung des Materials angeschlossen werden (oder auch nicht). Zum anderen ist das Interpretationsgeschäft nicht nur ein spekulatives, sondern ein extrem vielfältiges, was Reichweite, Zielrichtung und theoretische Vorannahmen über Absichten, Bedingungen, entscheidende Akteure angeht.
Prinzipiell lässt sich unendlich viel in unendlich vielen Varianten analysieren, also Phänomene systematisch und nachvollziehbar in beliebig viele Teilelemente zergliedern, diese wiederum in beliebig viele Verhältnisse zueinander bringen und unendlich lang interpretieren und darüber spekulieren, warum die Elemente so ineinandergreifen und nicht anders. Allein schon deshalb muss für ein nun mal endliches Einführungsbuch die Maxime gelten: Selektion! D.h. unter anderem auch: Man muss sich für eine bestimmte analytische Zugriffsweise entscheiden, mit dementsprechenden theoretischen Vorannahmen und Interpretationsansätzen. Erst so wird, im besten Falle, Faszinierendes, Irritierendes oder schlicht Unverständliches systematisch und intersubjektiv erklärbar oder zumindest einigermaßen nachvollziehbar gemacht, warum etwas nicht zu verstehen ist. Ohne die Wahl einer analytischen Zugriffsweise blieben Analyseversuche schlicht diffus.
Ebenso gilt aber: Die Kenntnis unterschiedlicher Analyseverfahren ermöglicht zuallererst, unterschiedliche Fragen zielführend und präzisierend an den Gegenstand zu stellen. Damit geht zum einen eine gesteigerte Sensibilisierung für mediale Phänomene einher (und vielleicht sogar eine Steigerung der Faszination für den Gegenstand). Zum anderen ist somit aber auch eine Sensibilisierung für die Relativität und relative Nützlichkeit unterschiedlicher analytischer Zugriffe gefunden. So gesehen scheint es ratsam, sowohl ein bestimmtes Analyseverfahren genauer in Augenschein zu nehmen (um sich bewusst dafür oder dagegen entscheiden zu können) als auch möglichst viele Analyseverfahren zu kennen, um aus einer Vielzahl an Zugriffsmöglichkeiten, die jeweils zielführendsten auswählen zu können. Genau solch eine Parallelaktion soll in den folgenden Kapiteln in Angriff genommen werden: Einerseits werden vergleichsweise kleinteilig einzelne Analysezugriffe nacheinander entfaltet und anderseits vielfältige Analysezugriffe kumulativ auf ein und denselben Gegenstand, eben die Serie Buffy, angewandt.
Getreu den eingangs formulierten Prinzipien der Analyse habe ich mich ebenfalls für eine spezifischen analytische Zugriffsweise entschieden: Ausgehend von der Wahrnehmung (I) vielfältiger und widerstrebender Medienanalysen, ergab sich die Frage (II.), wie diese vielfältigen Methoden und theoretischen Zugriffe von Medienanalysen angemessen darzustellen seien. Deshalb wurde die Methode einer exemplarischen Veranschaulichung des Gegenstandes Medienanalyse anhand der Serie Buffy gewählt (IV.), worin sich zum einen bestimmte theoretische Vorannahmen manifestieren (III.), nämlich, dass Medienanalysen überhaupt exemplarisch an konkreten ästhetischen Medienprodukten veranschaulicht werden können, dass daran wiederholbare und gleichzeitig vielfältige Verfahrensregeln vorzuführen sind, die plurale Wege zu unterschiedlichem Wissen über mediale Gegenstände weisen. Zum anderen wird der Analysegegenstand damit in viele Zugriffe zergliedert (V.[1]), wobei wiederum sehr viel mehr Zugriffe einfach nicht vorkommen, also negiert sind (V.[3]). Dementsprechend ist durch jene, die behandelt werden, eine Norm gesetzt für das, was maßgebliche medienwissenschaftliche Zugriffe sind (V.[3]). Und die Deutungen derjenigen Zugriffe, die als exemplarische und gleichzeitig unterschiedliche Zugriffe vorkommen, sind wiederum nicht unmittelbar im Gegenstand der einzelnen analytischen Ansätze selbst zu finden. Sie sind eine Interpretation (VI.), die erklären soll (VII.), warum die Wahl einer bestimmten medienwissenschaftlichen Medienanalyse abhängig von der jeweiligen Frage ist, die an den Gegenstand gestellt wird, sowie von den gewählten Methoden.
Dass solche Fragen und Methoden wiederum selbst abhängig von der medialen Lage sind, in der sich derjenige befindet, der solche Fragen stellt und methodisch beantworten will, ist aus einer medienwissenschaftlichen Perspektive selbstverständlich. Dennoch ist diese Selbstverständlichkeit freilich selbst bereits Ergebnis einer hochgradig spekulativen Tiefeninterpretation.
Analyse bedeutet vom Wortstamm her auflösen. Demnach bestimmt sich eine wissenschaftliche Analyse zuvorderst durch eine abstrahierende Zergliederung des Gegenstandes.
Normative Gewichtung, selektive Negation und relationierende Interpretation sind weitere notwendige Bestandteile des Analysierens.
Auch wenn hier ein vergleichsweise schematischer, auf Wiederholbarkeit angelegter Ablauf von Analysen vorgeschlagen wird, bedeutet das mitnichten, dass die jeweiligen Analysen damit zu objektiven Ergebnissen führen. Anhand des Beispiels der sogenannten „Warheitswertetafel“ sollte deutlich geworden sein, wie hochgradig interpretativ Analysen sind, ja aus prinzipiellen Gründen sein müssen.
Unterschieden wurden zwei gegenläufig ausgerichtete Interpretationsebenen, nämlich Oberflächen- und Tiefeninterpretation. Geht erstere auf vermeintliche (Werk-)Absichten ein, die aus den Formen des jeweils analysierten Medienprodukt herauszulesen sind, so ist letztere einer symptomatischen Lesart verpflichtet.
Debatte: Methoden der Medienwissenschaft. Sammlung von Texten und Blogbeiträgen zum Thema auf der Homepage der Zeitschrift für Medienwissenschaft (ZfM),
Online zugänglich unter: https://www.zfmedienwissenschaft.de/online/debatte/methoden-der-medienwissenschaft [25.09.20]
Fachspezifische Diskussion über Sinn und Unsinn von Methoden für die Medienwissenschaft vor dem Hintergrund der Digitalisierung der (Medien-)Welt.
Blog/Texte werden permanent erweitert bzw. aktualisiert.
Mitunter sehr voraussetzungsreich und keine übergreifende Einführung in das, was Methoden der Medienwissenschaft sind, geschweige denn in das, was Medienanalyse sein soll.
Umberto Eco: Die Grenzen der Interpretation (München 1992)
Hier geht es um die Fragen, ob Interpretationen vollständig willkürlich sind und alles im Auge der Betrachter*innen liegt oder es doch irgendwie Normen gibt, die eine angemessene von einer unangemessenen Interpretation unterscheiden helfen. Dabei wird zudem die für alle Medienanalysen relevante Frage diskutiert, ob und wenn ja, wie Absichten sich im Werk finden und interpretativ explizit zu machen sein könnten.
Leider diskutiert Eco nahezu ausschließlich künstlerisch hochambitionierte literarische Texte.
3 Poetik I Mediale Formen analysieren
Ein ambitioniertes Vorhaben wird hier begründet: Will doch vorliegende Medienanalyse nicht weniger als eine Poetik audiovisueller Medien in aristotelischer Tradition sein.
Medienwissenschaftliche Analysen gehen in einer kulturwissenschaftlichen, speziell philologischen Tradition von konkreten, einzelnen Medienprodukten aus, die kleinteilig hinsichtlich ihrer ästhetischen Formen exemplarisch untersucht und interpretiert werden. Insbesondere fiktionale, narrative Medienprodukte werden dabei in den Blick genommen. Dieser Tradition will auch ich hier – wie eingangs erläutert – folgen, in dem ich mich auf eine fiktionale (Fernseh-)Serie konzentriere.1
3.1Poiesis/Poetik
Analysen zu Fernsehserien wählen so gut wie immer, mehr oder minder explizit, ihren Ausgangspunkt in ästhetischen Maximen der Antike. Genauer noch: Es wird auf Anschauungen und Kategorien zurückgegriffen, die vor knapp zweieinhalbtausend Jahren Aristoteles in seiner Poetik entfaltet hat.1 ‚Poetik‘ meint dort die Lehre von der Dichtkunst. Diese Lehre ist zum einen ein normatives Geschäft. Folglich würde man aus dieser Perspektive fragen: Wie soll eine Serie aussehen? Welche Merkmale machen eine gute Serie aus? Zum anderen – und hier wichtiger – ist die Poetik eine definitorische Angelegenheit: Die konstitutiven Elemente, Regeln und besonderen Strukturmerkmale der Dichtung bzw. ihrer Unterarten sollen möglichst präzise erfasst werden. Herausgearbeitet wird dabei, was Dichtung wesenhaft ist, also das, was Dichtung in ihren Grundstrukturen ausmacht.
Der griechische Ausruck poiesis [ποιέω] meint ganz allgemein machen bzw. herstellen. Seit der Antike (und eben auch bei Aristoteles) werden mit dem daraus abgeleiteten Begriff der Poetik vorrangig künstlerische Formungsprozesse bezeichnet. In einer Poetik, wie der des Aristoteles, geht es dementsprechend sehr viel weniger um die Frage, was in einem Kunstwerk abgebildet werden soll oder wurde, sondern sehr viel mehr darum, wie. Genauer formuliert sollen anhand exemplarischer Untersuchungen einzelner Werke die Baupläne ausfindig gemacht werden, nach denen die einzelnen Komponenten künstlerischer Artefakte in Relation zueinander stehen. Es geht also um die Formen der Darstellung.
3.2Formen und Formrelationen
Doch was sind eigentlich Formen im Kontext der aristotelischen Poetik? Im hier relevanten Sinne sind Formen Elemente, die in und durch eine literarische Gattung wie etwa dem Roman in einem System organisiert sind, das regelt, wie die einzelnen Elemente im Verhältnis zueinander stehen.1