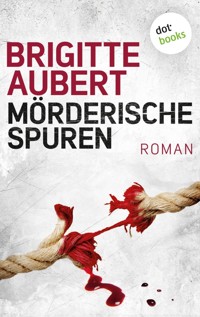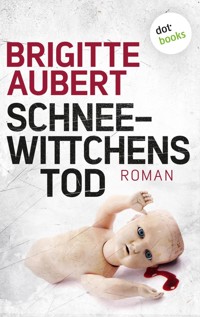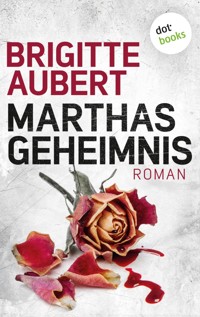
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Düstere Geheimnisse und gefährliche Doppelleben: Der Kriminalroman "Marthas Geheimnis" von Brigitte Aubert jetzt als eBook bei dotbooks. Nach außen hin führt Georges in Genf das Leben eines spießigen Langeweilers: von früh bis spät arbeiten, anschließend ruhige Abende mit seiner introvertierten Frau Martha. Doch hinter der Fassade führt er ein gefährliches Doppelleben als Bankräuber, von dem niemand erfahren darf – vor allem nicht Martha. Als er diese eines Tages kurz vor einem Coup in Brüssel sieht, droht sein Kartenhaus einzustürzen. Hat sie ihn enttarnt? Und warum ist sie mit einem anderen Mann zusammen? Georges glaubte immer, alle zu täuschen – bis er selbst nicht mehr zwischen Wahrheit und Einbildung unterscheiden kann. Jetzt als eBook kaufen und genießen: "Marthas Geheimnis" von Bestsellerautorin Brigitte Aubert. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 380
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Über dieses Buch:
Nach außen hin führt Georges in Genf das Leben eines spießigen Langeweilers: von früh bis spät arbeiten, anschließend ruhige Abende mit seiner introvertierten Frau Martha. Doch hinter der Fassade führt er ein gefährliches Doppelleben als Bankräuber, von dem niemand erfahren darf – vor allem nicht Martha. Als er diese eines Tages kurz vor einem Coup in Brüssel sieht, droht sein Kartenhaus einzustürzen. Hat sie ihn enttarnt? Und warum ist sie mit einem anderen Mann zusammen?
Georges glaubte immer, alle zu täuschen – bis er selbst nicht mehr zwischen Wahrheit und Einbildung unterscheiden kann.
Über die Autorin:
Brigitte Aubert gehört zu Frankreichs profiliertesten Spannungsautorinnen. Neben Kriminalromanen und Thrillern schreibt sie Drehbücher und war Fernsehproduzentin der erfolgreichen »Série noire«. 1996 erhielt sie den französischen Krimipreis. Heute lebt sie in Cannes und führt ein altes Kino, das sie von ihren Eltern übernommen hat.
Bei dotbooks erscheinen auch:
Die vier Söhne des Doktor March
Im Dunkel der Wälder
Tod im Schnee
Sein anderes Gesicht
Schneewittchens Tod
Der Puppendoktor
Nachtlokal
***
eBook-Neuausgabe August 2017
Copyright © der französischen Originalausgabe 1993 by Editions du Seuil, Paris
Die französische Originalausgabe erschien 1993 unter dem Titel »La Rose de Fer« bei Éditions du Seuil, Paris.
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1998 by Wilhelm Goldmann Verlag, München
Copyright © der Neuausgabe 2017 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwedung von shutterstock/Nattika (Rose), Anneka (Blut)
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (sh)
ISBN 978-3-95824-956-1
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Marthas Geheimnis an: [email protected]
Gerne informieren wir Sie über unsere aktuellen Neuerscheinungen und attraktive Preisaktionen – melden Sie sich einfach für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Brigitte Aubert
Marthas Geheimnis
Roman
Aus dem Französischen von Eliane Hagedorn und Barbara Reitz
dotbooks.
Kapitel 1 Erster Tag – Donnerstag, 8. März
Der Kaffee dampfte im grauen Morgenlicht. Ich saß mit der Tasse in der Hand in der dunklen Küche. Gleich nach dem Aufstehen das grelle elektrische Licht zu ertragen, fällt mir immer schwer, ich bewege mich lieber im Halbdunkel. Etwa dreihundert Meter entfernt, auf der anderen Straßenseite, ging in der Küche der Brundels das Licht an. In den vier Jahren, die ich hier lebte, hatte ich sicher nicht öfter als zweimal das Wort an sie gerichtet. Nicht etwa weil sie mir unsympathisch waren, sondern weil es besser war, meine Beziehung zu den Nachbarn auf ein Minimum zu beschränken.
Ich sah auf meine Uhr: 7.00 Uhr. Ich war spät dran. Wenn ich an diesem Morgen gewußt hätte, was mir bevorstand, wäre mir die Uhrzeit wahrscheinlich egal gewesen. Und vielleicht hätte ich sogar alles getan, um diesen Tag nicht erleben zu müssen. Aber leider hatte ich trotz allem, was man über die Verbreitung übernatürlicher Kräfte liest, nie die geringste Vorahnung, nicht einen Schimmer von Telepathie. Also war ich in aller Unbewußtheit bereit, meinem Schicksal zu folgen.
Martha erschien schlaftrunken in der angelehnten Tür. Eine Strähne ihres schwarzen Haars hing ihr in die dunklen Augen. Sie lächelte mir zu und zog fröstelnd den Morgenmantel aus roter Seide über ihrem weißen, nackten Körper zusammen. Ich reichte ihr eine Tasse Kaffee. Während sie ihn trank, waren ihre großen Augen nachdenklich auf mich gerichtet. Morgens nach dem Aufstehen erinnerte Martha mich an ein kleines Kätzchen, das sich räkelt. Sie unterdrückte ein Gähnen und schnippte dann, als ihr wieder einfiel, was sie mir sagen wollte, plötzlich mit den Fingern:
»Georges, du denkst doch daran, auf dem Heimweg bei der Reinigung vorbeizufahren?«
Ich nickte, leerte meine Tasse und erhob mich. Als Martha mir die Arme entgegenstreckte, beugte ich mich zu ihr herab und küßte ihren Hals an jener Stelle, an der ich ihren Geruch besonders liebte: hinter dem Ohr, dicht neben den feinen Nackenhärchen. Dann flüsterte ich:
»Bis heute abend. Sei schön brav.«
Sie seufzte:
»Du kannst ganz unbesorgt sein, ich fahre heute zu Maman.«
Marthas Mutter war behindert. Sie lebte fünfzig Kilometer von uns entfernt in einem kleinen Dorf, das sie auf keinen Fall verlassen wollte. Wenn ich nicht da war, fuhr Martha oft zu ihrer Mutter, um ihr Vorräte zu bringen und ihr Gesellschaft zu leisten. Martha war ein wenig scheu. Meines Wissens hatte sie keine Freunde. Ihre Welt, die aus Kunst, Musik, Literatur und meiner Person bestand, schien ihr zu genügen. Sie sah zu, wie ich meinen braunen Tweed-Zweireiher zuknöpfte, betrachtete mein Hemd aus bronzefarbener Seide, die Kaschmirkrawatte mit dem diskreten Muster und erlaubte sich ein kleines Lächeln:
»Betreibst du diesen Aufwand für deine Sekretärin?«
»Ich habe einen wichtigen Termin.«
»Das sieht man …«
Zweifelnd und spöttisch verzog sie das Gesicht. Ich widerstand der Versuchung, sie in die Arme zu schließen – dann hätte ich mich definitiv verspätet –, warf ihr statt dessen mit den Fingerspitzen einen Kuß zu und trat in die kalte Morgenluft hinaus.
Ich betätigte den elektrischen Türöffner der Garage und stieg eilig in den nachtblauen Lancia. Es war kalt, und ich drehte die Heizung ganz auf. Die Windschutzscheibe beschlug sofort, und die Straßengräben waren mit weißem Rauhreif überzogen.
Wir wohnten außerhalb von Genf in einem sehr vornehmen Viertel, das mitten in einem riesigen Wald lag. Die Villen waren so weit voneinander entfernt, daß sie die Illusion von Abgeschiedenheit vermittelten. Jede verfügte über ein eigenes Schwimmbad, das im Augenblick mit einer Plane abgedeckt war. Martha schwamm sehr gerne. Ansonsten verabscheute sie jegliche Art von Sport und begleitete mich nie bei einer Wanderung oder einer Kajaktour.
Die Heizung verbreitete den üblichen, unangenehmen, leicht verbrannten Geruch, der rasch verfliegen würde. Eine Elster flatterte kreischend aus dem Gestrüpp auf. Um die Scheibe einen Spaltbreit zu öffnen, drückte ich auf einen Knopf und atmete tief die feuchte Morgenluft und den Duft des Unterholzes ein.
Schnell fuhr ich auf die Autobahn. Bald darauf zeigte ein Schild die Ausfahrt 22 an. Dort befand sich der Hauptsitz der Firma SELMCO, für die ich angeblich arbeitete. Ein großes Import-Export-Unternehmen, in dem ich die Stelle eines internationalen Beraters »innehatte«. Das brachte häufige Geschäftsreisen und sehr unregelmäßige Arbeitszeiten mit sich. Dieser Meinung zumindest war Martha, ebenso wie unsere wenigen Bekannten. Ich war im Besitz eines in Plastik geschweißten Ausweises mit meinem Foto und einer fast echten Identifikationsnummer. Und Martha war im Besitz einer Telefonnummer, unter der sie mich erreichen konnte, wenn es nötig war. Dort hatte sie ein Mädchen am Apparat, das dafür bezahlt wurde, jedesmal zu antworten, ich sei abwesend oder in einer Konferenz, und mögliche Nachrichten weiterzuleiten. Nie versäumte ich es, diese bei ihr abzufragen, ehe ich mich auf den Heimweg machte.
Diesmal fuhr ich in aller Ruhe an der Ausfahrt 22 vorbei und bog fünfhundert Meter später zum Flughafen ab. 7.29 Uhr. Ich war spät dran. Ich schaltete den Blinker ein und fuhr zum Parkplatz 2, wo die Parkdauer auf höchstens vierundzwanzig Stunden beschränkt war. Schnell ergriff ich meinen Aktenkoffer und lief zum Schalter. Die Angestellte, die gerade ihrer Nachbarin von ihren Erlebnissen am Vorabend berichtete, lächelte mir mechanisch zu, überprüfte mein Ticket und reichte mir zerstreut eine Bordkarte. Fünfzehn Minuten später überflog ich Genf in Richtung Brüssel.
Das Flugzeug landete um 9.04 Uhr. Nachdem ich die auf ein Minimum reduzierten Zollformalitäten hinter mich gebracht hatte, fuhr ich mit der U-Bahn zum Brüsseler Hauptbahnhof, den ich um genau 9.55 Uhr erreichte. Ich ging zu den Toiletten. Beim Eintreten warf ich einen schnellen Blick in den Raum. Max war schon da; ich sah seine Schuhe unter der dritten Tür. Wir hatten uns um 10 Uhr verabredet. Ich schloß mich in der Kabine neben der seinen ein und schob meinen Aktenkoffer unter der Trennwand durch. Max schob mir ein Köfferchen zurück. Als ich es öffnete, um mich umzuziehen, konnte ich ein Lächeln nicht unterdrücken. Meine neue Aufmachung würde mein Äußeres radikal verändern: ein schmutziges T-Shirt, ein zerrissener Blouson, eine helle Perücke, eine Wollmütze und eine Einkaufstasche aus Plastik mit verschiedenen Lebensmitteln, unter anderem einem Liter billigen Rotwein. Ich schmierte mir Hände und Gesicht mit schmutzigem Fett ein, klebte mir einen dicken Schnauzbart unter die Nase und setzte eine Brille mit dunklen Gläsern auf. Als ich fertig war, klappte ich den weißen Stock auseinander, klopfte damit wie im Theater dreimal auf den Boden und schob Max das Köfferchen zurück. Ich hörte, wie sich die Tür öffnete, seine Schritte hallten auf dem Fliesenboden wider, und ich wartete, bis sie sich entfernt hatten, ehe auch ich meine Tür öffnete. Meine Aufmachung stank nach billigem Fusel, und ein gutgekleideter Herr wich angewidert einen Schritt zurück.
Um 10.35 Uhr erreichte ich in dieser Verkleidung die Grande Place. Sofort entdeckte ich Phils hochgewachsene, schlaksige Gestalt, die in ihren Lumpen zu schwimmen schien. Er malträtierte sein Akkordeon, um ihm eine schwungvolle Walzermelodie zu entlocken, mit der er die Ohren der Schaulustigen quälte. Mit meinem Stock bewegte ich mich mit unsicherem Schritt tastend auf ihn zu. Er sprach mich mit der jovialen Stimme eines Berufstrinkers an, und wir wechselten ein paar Worte, dann ging Phil auf seinem Instrument klimpernd davon. Er konnte sich nicht länger als eine halbe Stunde auf dem Platz aufhalten, ohne von der Polizei verjagt zu werden. Er hatte mir den Hund dagelassen. Eine Promenadenmischung, zu deren Vorfahren ein deutscher Schäferhund gehört haben mußte, mit hängenden Ohren und einem Geschirr, wie es jeder gute Blindenhund hat. Ich ließ mich an einer schmutzigen Fassade nieder, stellte ein Tellerchen neben mir auf und beobachtete im Schutz meiner dunklen Gläser das Bankgebäude.
Das europäische Bankenkonsortium glänzte in all seiner Pracht, an den schwarz verspiegelten Fenstern und Türen prangten goldene Lettern. Seit vier Tagen wurde es von uns streng überwacht. Ich würde bis vier Uhr bleiben, dann würde Benny mich ablösen, der, als Diplomat verkleidet, in einem der unzähligen Cafés, die den Platz säumten, seinen Tee trinken würde.
Ich dachte kurz an Martha, die mich in das Studium eines Aktenberges vertieft glaubte. Doch ich hatte mein Geld noch nie anders verdienen können. Seit ich die Armee verlassen hatte, hatte ich mich eigentlich nur mit einer Sache beschäftigt: mich in der schwierigen und präzisen Kunst des Einbruchs zu vervollkommnen. Ich fühlte mich wie eine Art Uhrmacher, dessen Arbeit es nicht war, die Uhrwerke zu reparieren, sondern sie zu zerstören. Dabei hatte ich keine Schuldgefühle. Immerhin waren die Banken versichert, und ich war fast der Auffassung, daß meine Tätigkeit der der Versicherungsgesellschaften nicht unähnlich war. Außerdem führten wir ein luxuriöses, angenehmes Leben, und selbst wenn ich nicht wesentlich besser verdiente, als wenn ich tatsächlich für die SELMCO gearbeitet hätte, hatte ich doch mehr Spaß.
Es war ein kalter Tag: Ein eisiger, schneidender Wind trieb dicke Wolken über den blauen Himmel. Aber zumindest regnete es nicht. Wenn alles gutging, würde ich morgen um 13.10 Uhr 250000 belgische Francs kassieren. Mein Anteil. Sorgfältig entfernte ich die Cellophanverpackung, die mein Cervelat-Sandwich umhüllte, und biß kräftig hinein. Inzwischen war ein Bulle aufgetaucht, doch er warf mir nur einen zerstreuten Blick zu. Dutzende von Touristen bevölkerten, den Blick starr auf ihren Führer oder die Videokamera gerichtet, den Platz, und der Polizist hatte vor allem ein Auge auf die Gruppen junger, fingerfertiger Jugoslawen, die in der Menge herumlungerten.
Die Zeit verging langsam. Meine Muskeln schmerzten, und ich war halb erfroren. Doch dank unseres Überwachungssystems entging uns kein Detail, und wir hätten den genauen Zeitplan eines jeden Bankangestellten und der Sicherheitskräfte wiedergeben können. Eine blonde Dame in einem Pelzmantel ließ ein Geldstück auf mein Tellerchen fallen. Ich dankte ihr mit einem kräftigen Kopfnicken. Im Schutz meiner dunklen Brille schielte ich zu der großen Rathausuhr. 15.45 Uhr, bald hatte ich es geschafft.
Ich reckte mich unauffällig und griff nach meinem Stock. Sogleich schüttelte sich Adolf und wedelte mit dem Schwanz. Ich klopfte ihm den Rücken. Er streckte sich und leckte meine Hand. Adolf war ein guter Hund. Er hatte einem humorvollen, alten blinden Österreicher gehört, der sein Land 1937 verlassen hatte und dann vierzig Jahre lang durch ganz Europa gereist war. Eines Tages war er in Brüssel gelandet, und dort hatte er Max kennengelernt, der, wie er, in verschiedene kleine Gaunereien verwickelt war. Emil – so hieß der Alte – hatte ihm den Hund überlassen, da er der Auffassung war, er habe ohnehin nicht mehr lange zu leben. Und tatsächlich wurde er zwei Tage später von einer Gruppe verrückter Skinheads, die sehr der SS ähnelten, vor der er vor so langer Zeit geflohen war, bei lebendigem Leib verbrannt. Ein eisiger Windstoß riß mich aus meinen Gedanken.
»Gedulde dich noch fünf Minuten«, flüsterte ich Adolf zu, der leise knurrte. Ich gab ihm den Rest von meinem Sandwich, den er mit einem Bissen verschlang. In diesem Augenblick verließ ein dicker Mann die Bank, der an einem Bündel Geldscheine herumnestelte und es in seinem Portemonnaie zu verstauen versuchte. Ein heftiger Windstoß entriß ihm einen der Scheine und wirbelte ihn über das Trottoir. Der Mann nahm die Verfolgung auf, und ich mußte mich beherrschen, um nicht laut loszulachen angesichts seiner ungeschickten Versuche, den Schein wieder einzufangen. Schließlich landete er genau vor meinen Füßen, doch da ich blind war, rührte ich mich nicht. Es war eine Hundert-Dollar-Note. Der Kerl, der sich gerade zu einer unfreundlichen Bemerkung anschickte, bemerkte meine dunkle Brille und meinen Stock und schwieg. In der Sekunde, als er sich bückte, trieb ein neuer Windstoß den Geldschein auf die andere Straßenseite, wo er auf einem der Tische der großen Brasserie an der Ecke liegenblieb.
Belustigt hatte ich seinen Flug aus dem Augenwinkel verfolgt. Die Banknote war sanft bei einem Paar gelandet: Die Frau konnte ich fast nur von hinten sehen, der Mann, der mir das Gesicht zuwandte, hatte kurzgeschnittenes, sorgfältig gekämmtes blondes Haar, ein rundes Schweinsgesicht mit einer kleinen, breiten Nase, blaue Augen und einen akkurat gestutzten, blonden Schnauzer. Der Prototyp eines Konsulatsangestellten, der gerne Armeegeneral geworden wäre. Von der Frau sah ich nur das rote Haar, das dunkle Kostüm und die gepflegte Hand, die die Tasse umschloß. Der Typ trank ein Bier, die Frau einen Kaffee. Beide trugen jene Art teurer Konfektionskleidung, die zur Uniform der middle class geworden ist, und mein innerer Computer katalogisierte sie sogleich: gehobene Angestellte, die ein verlängertes Wochenende in Brüssel verbringen. All diese Details hatte ich unbewußt registriert, sozusagen aus Gewohnheit. Phil hatte mir schon oft gesagt, ich hätte lieber Bulle werden sollen. Darum hatte ich vielleicht auch gleich das Gefühl, daß da etwas nicht stimmte. Keiner der beiden, weder der Mann noch die Frau, schenkte dem Geldschein die geringste Aufmerksamkeit. Dabei schienen sie wirklich nicht zu jener Art von Leuten zu gehören, die sich mit einer Hundert-Dollar-Note die Zigarette anzünden.
Als es dem Dicken endlich gelungen war, die Straße zu überqueren, stürzte er sich förmlich auf ihren Tisch, und seine dicken Wurstfinger grapschten nach dem Geldschein. Die Frau wandte sich um, schüttelte den roten Haarschopf und lächelte ihm automatisch, wenn auch völlig unpassend, zu. Mein Herzschlag setzte aus.
Es war Martha! Es war Martha, die dort zehn Meter von mir entfernt saß, Martha, die ihre Hand auf den Arm ihres Gefährten legte, ihm etwas sagte und sich erhob. Beinahe wäre ich aufgesprungen, doch gerade rechtzeitig erinnerte ich mich noch daran, daß ich eigentlich blind war und nicht aufgrund einer einfachen Ähnlichkeit zwei Monate Vorbereitungsarbeit verderben durfte. Aber es war mehr als eine Ähnlichkeit, es war Martha selbst mit ihren mandelförmigen Augen, ihrem vollen Mund, den schmalen Hüften und dem üppigen Busen, Martha in einem strengen Kostüm, das ich nicht kannte, Martha, jetzt mit leuchtendrotem Haar, die sich zu dem Unbekannten beugte und ihn auf den Mund küßte.
Erstarrt blickte ich dem Paar nach, das sich langsam entfernte. Mein Sicherheitsinstinkt erinnerte mich daran, daß ich den Kopf nicht wenden durfte, doch aus den Augenwinkeln entdeckte ich Bennys elegante Gestalt, der steif und anscheinend in die Times vertieft, vor seiner Teetasse saß. Benny! Ich mußte gehen. Ich erhob mich, von dem Schock waren meine Beine zittrig, und ich mußte mich an Adolfs Geschirr festhalten, der sogleich den Weg zum Bahnhof einschlug. Durch einen unverhofften Glücksfall ging das Paar etwa zehn Meter vor mir. Marthas Doppelgängerin blieb vor der Auslage eines Schmuckgeschäfts stehen, flüsterte dem Mann etwas ins Ohr und beide lachten. Der Mann fügte etwas mit tiefer Stimme in einer Sprache hinzu, die ich als Deutsch erkannte.
Zwei Jugendliche mit kahlgeschorenem Kopf rempelten mich unverschämt an, doch meine Rolle hinderte mich daran zu reagieren. Sie entfernten sich mit höhnischem Gelächter. »Martha« wandte sich um, und ihr Blick streifte mich, ohne daß sie die geringste Regung zeigte. Beinahe hätte ich laut losgebrüllt, doch dann fiel mir meine Verkleidung ein: Sie hatte mich einfach nicht erkannt. Sie ging jetzt wieder neben ihrem Begleiter, der sie an sich zog. Der Anblick, wie Martha sich an diesen Mann schmiegte, war mir derart unerträglich, daß mir fast übel wurde. Plötzlich wandten sie sich um und gingen in entgegengesetzter Richtung weiter. Meine Beine schlugen instinktiv denselben Weg ein, und ich mußte mich zwingen, diesem Impuls nicht nachzugeben. Ich durfte Max nicht am Bahnhof warten lassen. Und ich durfte unseren Plan nicht wegen einer Halluzination gefährden. Denn es konnte sich nur um ein Mißverständnis handeln. Um einen unglaublichen Zufall, aber dennoch um einen Zufall.
Ich erreichte den Bahnhof in abwesendem Zustand und begab mich mechanisch zu den Toiletten. Max war da. Wir wiederholten unser kleines Spielchen, und bald stand ich erneut in meinem eleganten Tweedanzug und meinen teuren Slippern da. Ich reinigte mein Gesicht und meine Hände mit ein paar feuchten Wegwerf-Tüchlein. Max schob meinen Aktenkoffer unter der Trennwand durch, ich nahm meinen Paß wieder an mich und steckte ihn in meine Innentasche. Adolf jaulte. Auch er hatte genug. Ich nahm ihm das Geschirr ab, legte ihm ein feines gelbes Lederhalsband um und verstaute das Geschirr in dem Köfferchen, das ich Max zurückgab. Ich hörte, wie er sich, gefolgt von dem Hund, entfernte. Dann zählte ich bis fünf und verließ die Toilettenkabine.
Nur ein Mann in einem blauen Regenmantel stand da, der urinierte. Er wandte sich nicht um und schien ganz in die Betrachtung der weißen Fliesen versunken. Im Spiegel über dem Waschbecken sah ich mein Bild: ein stattlicher Geschäftsmann mit vollem, kurzgeschnittenem braunem Haar, einem männlichen, von Narben gezeichnetem Gesicht (eine Erinnerung an meine Boxkämpfe), dessen tiefliegende schwarze Augen einen verblüfften Ausdruck hatten. Ich atmete tief durch, um wieder die Kontrolle über mich zu gewinnen, und ging.
Eilig begab ich mich zur Flughafenschnellbahn. Max hatte das Ticket in meinen Paß geschoben, und während ich es dem Kontrolleur vorlegte, trat mir unwillkürlich wieder dieses unglaubliche Bild vor Augen. Martha in Brüssel, am Arm eines fremden Mannes … War ich vielleicht wahnsinnig geworden?
Starker Nebel führte zu einer fünfzehnminütigen Verspätung meines Fluges. Ich sah auf die Uhr. 17.02 Uhr. Ich hatte also Zeit genug zu telefonieren. Ich mußte Gewißheit haben. Ich ging zu einer freien Kabine, atmete tief durch und wählte die Nummer von Marthas Mutter. Das Klingelzeichen. Zweimal. Dreimal. Viermal. Mein Herz klopfte zum Zerspringen. Plötzlich wurde abgehoben.
»Hallo? Hallo?«
Es war Martha. Ich war also tatsächlich wahnsinnig geworden. Wortlos hängte ich wieder ein. Meine Kehle war völlig ausgetrocknet, ich mußte etwas trinken. Ich schüttete einen großen Krug flämisches Bier hinunter. Dann zündete ich mir eine Zigarette an. Sie schmeckte strohig, und ich drückte sie in einem roten Plastikaschenbecher aus. Ich durfte mich von diesem Zufall nicht aus der Fassung bringen lassen. Morgen war der große Tag. Ich mußte ruhig, völlig ruhig sein. Um mich zu entspannen, führte ich eine Reihe von Atemübungen durch, und langsam fühlte ich mich dank der Atmung und des Biers besser.
Während des Flugs gelang es mir, ein wenig zu schlafen. Ich hatte schon immer die Gabe, schlafen zu können, wenn ich mit einem bedrückenden Problem konfrontiert war und abschalten wollte. Meistens wachte ich dann erholt und mit einer möglichen Lösung auf. Und so fühlte ich mich auch diesmal beim Erwachen besser. Ich war einfach nur von einer verblüffenden Ähnlichkeit genarrt worden. Ich mußte aufhören, all diese Thriller zu lesen, die Martha als »Bahnhofslektüre« abqualifizierte. Ein wenig Spinoza oder Kant würden mir anstelle von Der Mann ohne Gesicht oder Die blutrote Piazza guttun.
Auf dem Rückweg hielt ich im Dorf, um Marthas Mantel von der Reinigung abzuholen. Draußen herrschte eine trockene, schneidende Kälte, die einen sofort davon abhielt, die Hände aus den Taschen zu nehmen. Ich trage nicht gerne Handschuhe, und die wenigen Male, die ich wegen unserer »Operationen« gezwungen war, welche anzuziehen, hatte ich das Gefühl gehabt, Prothesen an den Armen zu haben.
Um 19.14 Uhr bog ich in unseren Weg ein, der im Frühling von einer blühenden Hecke gesäumt ist, und fuhr langsam zur Garage. Im Haus brannte kein Licht. Wieder überkam mich ein heftiges Angstgefühl, und so blieb ich eine Weile im Lancia sitzen und lauschte dem Knistern des Schnees, der von den Zweigen rieselte. Schließlich zuckte ich die Schultern. Ich wurde langsam zu alt für diesen Job. Ich ließ mich leichter beeindrucken als ein Kind.
Ich betätigte die Fernbedienung, und das Garagentor schloß sich quietschend. Ich betrachtete das dunkle stille Haus und schob dann den Schlüssel ins Schloß. Die erlesene Eichentür sprang geräuschlos auf. Alles war still. Ich ging über den Flur, ohne daß das gebohnerte Parkett knarrte, vorbei an dem kleinen, in Schwarz und Safrangelb gehaltenen Wohnraum und am Eßzimmer, dessen große Fenster auf den Wald hinausgingen. Das Haus hatte einem Modearchitekten gehört, und ich hatte nichts an seiner Ausstattung geändert, nur einzelne Möbelstücke waren ausgetauscht worden. Solange die Umgebung, in der ich lebte, mein Auge nicht beleidigte, maß ich ihr wenig Bedeutung bei.
Ich ging an der Küche vorbei, die mit den modernsten Gerätschaften ausgestattet war, warf einen Blick in das große, geflieste Badezimmer und stieg dann die Treppe hinauf in den ersten Stock. Eine dumpfe Angst bedrängte mich. Die Hand auf dem Knauf der Schlafzimmertür zögerte ich einen Augenblick, ehe ich ihn langsam herumdrehte. Die Tür öffnete sich und glitt lautlos über den dicken schwarzen Teppich. Der japanische Futon zeichnete sich vor dem hellen Rechteck des Fensters ab, gegen das jetzt große Schneeflocken flogen. Ich erkannte die große, zusammengerollte Bettdecke. Ein rauher Schrei zerriß die Dämmerung und ließ mich zusammenfahren:
»Georges! Hast du mich erschreckt!«
Im Gegenlicht sah ich, wie Martha mit wirrem Haar unter der Bettdecke hervorkam. Sie gähnte.
»Ich habe gelesen und bin darüber eingeschlafen. Wie spät ist es?«
»19.28 Uhr.«
»Georges, kannst du mir nicht einfach sagen, wie spät es ist? Du bist doch keine Stoppuhr.«
Sie lächelte, der Bademantel glitt über der nackten Brust leicht auseinander.
»Es ist heiß hier. Ich mag diese Wärme, wenn es draußen schneit, fast auf unsere Köpfe …«
Ich trat einen Schritt vor. Die Worte brannten mir auf den Lippen: ›Weißt du, heute habe ich geglaubt, dich auf der Straße zu sehen …‹ Aber sie würde mich fragen, wo. Und ich müßte lügen, denn es gab keinen Grund, warum ich mich in Brüssel aufgehalten haben könnte. Niemand, nicht einmal Martha, durfte vermuten, daß ich einen Fuß in diese Stadt gesetzt hatte. Ich dachte an den Paß in meiner Tasche, der auf den Namen Axel Bayern, Weinhändler, ausgestellt war. Aber dann dachte ich an Marthas Arme, die sich mir entgegenstreckten. Ich beugte mich über sie und dachte schließlich an gar nichts mehr.
Viel später, als ich schon glaubte, sie sei eingeschlafen, seufzte sie tief und verbarg ihr Gesicht an meiner Schulter. Ich hob ihr Kinn leicht an:
»Martha, liebst du mich?«
»Zweifelst du noch daran?«
»Martha, was auch immer geschehen mag, ich möchte, daß du weißt, daß ich dich liebe.«
»Ich dich auch, Georges, aber was soll denn schon geschehen?«
Dann brach sie in fröhliches Gelächter aus, das im krassen Gegensatz zu ihrer vorhergehenden Traurigkeit stand, und sprang mit einem Purzelbaum aus dem Bett.
»Ich habe Hunger, großer Chef. Kleine Squaw wird Happi-Happi aufwärmen.«
Singend ging sie davon. Ich streckte mich. Es war kalt. Oder besser gesagt, mir war kalt. Mein weißer, von alten Narben wie ein Zebra gestreifter Bauch hatte eine Gänsehaut. Ich beschloß, daß eine gute Flasche Bordeaux jetzt das beste wäre und erhob mich ebenfalls.
Wir aßen ruhig zu Abend. Im Kamin flackerte ein Feuer. Marthas dickes, schwarzes Haar war zu einem Knoten zusammengefaßt, ihre nackten Schultern und ihr Moirékleid schimmerten im Kerzenschein, und ich fand sie schön. Wie immer zu schön für mich. Ich hatte mich schon oft gefragt, wie ein so verführerisches Mädchen wie Martha sich mit unserem ruhigen, zurückgezogenen Leben zufriedengeben konnte. Wie sie sich hatte bereitfinden können, ihr Schicksal mit mir, Georges E Lyons, zu verbinden, der weder außergewöhnlich schön noch intelligent war. Und sie ahnte nicht einmal etwas von meinen Nebentätigkeiten und konnte darin also auch nichts Aufregendes innerhalb unseres sonst eher eintönigen Lebens sehen.
Ich hatte Martha im Jahr zuvor bei einem Vortrag über äthiopische Kunst kennengelernt. Ich interessierte mich für eine Malachit-Statue, die ich für einen südamerikanischen Sammler entwenden sollte. Martha machte sich Notizen. Sie bereitete ihren Studienabschluß in Kunstgeschichte vor. Wir saßen nebeneinander. Ihr aufregendes Gesicht hatte mich betört: die hohen Wangenknochen, der große, volle Mund, der durchdringende Blick, die dunkle Haut, die ihr das Aussehen einer orientalischen Prinzessin verlieh, das Gesicht, das an eine abessinische Katze erinnerte, und die Spur von Ironie, die etwas von Scarlett O’Hara hatte. Sogleich fing ich ein Gespräch mit ihr an. Wider alle Erwartungen antwortete sie mir. Und langsam wurden wir Freunde. Und dann, an einem regnerischen Oktoberabend, als draußen das welke Laub umherwehte und das Wasser an den Fenstern herunterrann, wurden wir schließlich ein Liebespaar, gewissermaßen unsere persönliche Oktoberrevolution.
Martha hatte ihre Prüfung bestanden und mehrere Angebote von verschiedenen Museen im Ausland bekommen. Sie hatte sich noch für keines entschieden, denn sie wollte, wie sie mit einem spöttischen Lächeln bemerkte, zunächst etwas von mir profitieren. Dagegen hatte ich nichts einzuwenden. Und wenn ich auch wußte, daß es Wahnsinn war, in einer festen Beziehung zu leben, hatte ich nicht die Kraft zu widerstehen. Ich brauchte Martha, ihr Lächeln, ihre Freude, ihre stille Schönheit.
An all das dachte ich, während ich ihr einen Bordeaux einschenkte. Der rubinrote Wein breitete sich in dem Glas aus wie ein Meer warmen Blutes. Sie lächelte mir zärtlich zu. Gern hätte ich mit meinem Finger die Konturen ihrer Lippen nachgezeichnet. Wie hatte ich nur glauben können, sie in Brüssel gesehen zu haben? Vielleicht litt ich an einem Hirntumor, der Wahnvorstellungen auslöste … Einer meiner Freunde war im Krankenhaus an so etwas gestorben. Er hatte den Pfleger für seinen Vater gehalten und ihn für einen Fehler, den er fünfunddreißig Jahre zuvor begangen hatte, um Verzeihung gebeten! Mein Gott, am nächsten Tag mußte ich in Form sein, also Schluß mit dem Trübsalblasen! Ich erhob mich, um eine Platte aufzulegen, eine alte Jazz-Platte von Cab Calloway, die mir immer meinen Seelenfrieden zurückzugeben vermochte.
Kapitel 2 Zweiter Tag – Freitag, 9. März
Der Wecker klingelte um sechs Uhr. Ich wachte mit trockenem Mund und schwerem Kopf auf. Zuviel Bordeaux. Und der darauffolgende Cognac hatte die Dinge sicherlich nicht gerade besser gemacht. Martha drehte sich im Halbschlaf um und öffnete die Augen:
»Gehst du schon?«
»Ja, schlaf weiter. Bis heute abend. Und vergiß nicht, daß ich dich zum Essen einlade. Reservier einen Tisch, wo es dir gefällt.«
Sie nickte und schloß wieder die Augen. Um einen klaren Kopf zu bekommen, stürzte ich mich unter die kalte Dusche und massierte mich widerwillig. Ich haßte kaltes Wasser. Ich haßte Duschen am frühen Morgen, wenn ich noch verschlafen war. Und ich haßte es noch mehr, an einem so wichtigen Tag einen Kater zu haben. Ich kleidete mich sorgfältig an, stürzte eine Tasse bitteren Kaffee hinunter und ergriff meinen Aktenkoffer. Die Sache war entschieden.
Auf der Autobahn herrschte dichter Nebel. Für einen Augenblick beschäftigte mich der Gedanke, das Flugzeug könnte deshalb vielleicht nicht starten. Doch es hob pünktlich ab. Ich beobachtete, wie der Morgen graute, wie die Bergwipfel im fahlen Tageslicht schimmerten, und dachte daran, daß ich vielleicht in wenigen Stunden mit einigen Kugeln im Körper tot daliegen oder für die nächsten fünfundzwanzig Jahre ins Gefängnis wandern könnte. Ich hätte die Stewardeß rufen und eine Flasche Champagner bestellen sollen, um die letzten Augenblicke der Freiheit und Schönheit, die mir sicher waren, gebührend zu feiern. Doch ich tat nichts dergleichen und kaute vielmehr fleißig meinen klebrigen Kaugummi, die Hände lagen brav auf den Knien, und da ich die Augen schließen mußte, weil mir übel war, sah ich nicht einmal, wie die Sonne aufging. Solche Umstände führen manchmal dazu, daß Menschen nicht zur Legende werden.
Max war auf seinem Platz. In zwei Minuten schlüpfte ich in meine Verkleidung. Und wie immer in dem Augenblick, wenn die Würfel gefallen sind, übermannte mich jene Welle von Angst und Erregung, die wie eine Droge auf mich wirkt.
Phil schien völlig ruhig, doch die Intensität seines metallischen Blickes widerlegte seine äußere Lässigkeit. Er übergab mir Adolf und schlenderte in seinen Beatnik-Hosen davon. Ich setzte mich. Adolf gähnte. Spürte er meine Nervosität? Mit aufgerichteten Ohren sah er mich aufmerksam an. Ich kraulte ihm den Kopf und machte es mir bequem. Jetzt begann das Warten. Der Revolver in meinem Hosenbund schnürte mir den Magen ein. Ich hoffte, ihn nicht benutzen zu müssen. Mir waren Stichwaffen lieber. Und meine allerliebste Waffe waren noch immer meine Fäuste. Damit konnte ich wirklich einigen Schaden anrichten. Als ich an Martha dachte, die mich für einen Intellektuellen hielt, dessen gewalttätigste Aktion darin bestand, einen Strafzettel zu zerreißen, mußte ich lächeln.
Die Stunden zogen sich zäh dahin. Auf meinem Tellerchen häuften sich die Geldstücke. Heute waren die Leute großzügig, vielleicht wegen der stechenden Kälte und des Nieselregens, der mich mit seinen feinen Tröpfchen bis auf die Knochen durchnäßt hatte. Die meisten Cafés, die den Platz säumten, hatten die Markisen über ihren Terrassen heruntergelassen. Ich beobachtete, wie der große Zeiger der Rathausuhr eine Minute vorsprang, auf halb zwölf. Der Klang der Glocke scheuchte einen Schwarm Spatzen auf. Benny nahm ganz in meiner Nähe an einem Tisch Platz. Er trug einen beigefarbenen Regenmantel, und ein falscher blonder Spitzbart zierte sein feines Gesicht. Eine viereckige Brille gab ihm vollends das Aussehen eines steifen, pedantischen Diplomaten, und er sah mehrmals mit einer ungeduldigen Bewegung auf seine Uhr, eine extraflache Rolex. Der Polizist auf dem Platz, ein breitschultriger, rotwangiger Kerl, würdigte ihn keines Blickes. Mich im übrigen auch nicht. Ich störte niemanden und begnügte mich damit, im Nieselregen dazusitzen und mit dem Kopf zu wackeln. Ein armseliges Wrack, das sich an seinem Hund festhielt.
Um 12.27 Uhr verließ der letzte Kunde die Bank, um Punkt 12.30 Uhr folgten die Angestellten. Nur einer von ihnen würde bis 13.30 Uhr bleiben und an seinem Computer arbeiten, während er darauf wartete, daß die Bank wieder öffnete und seine Kollegen ihn ablösten. Es war ein magerer, blasser Typ mit einem Vollbart, der einen häßlichen, braunen Anzug trug und mir ganz den Eindruck machte, als leide er an einem Magengeschwür und überraschenden Migräneanfällen. Gedankenverloren schloß er die Türen. Um 12.48 Uhr fuhr ein gepanzerter Lieferwagen auf den Platz und rumpelte in Richtung Bank über das Kopfsteinpflaster.
Zwanzig Meter vom Eingang entfernt stand eine offene beigefarbene Plastikmülltonne. Phil hatte Adolf allmorgendlich trainiert. Er gab ihm die Papiertüte, in der sein Sandwich verpackt gewesen war, und Adolf warf sie zur Freude der Schaulustigen, auf den Hinterbeinen stehend, hinein. Um 12.54 Uhr hielt ich Adolf die Papiertüte mit dem Sprengstoff hin. Er nahm sie ins Maul und lief sofort zur Mülltonne. Der gepanzerte Lieferwagen hatte inzwischen vor der Bank angehalten. Das Heck zeigte zu den Türen, und während einer der Begleitfahrer, die Hand auf dem Revolver, den Platz überwachte, lud der andere die Geldsäcke ein. Adolf legte die Papiertüte in die Mülltonne, was dem Wachmann trotz seiner Nervosität ein Lächeln entlockte, und kam zu mir zurück. Ich betete, daß sich kein Passant der Tonne nähern möge. Dieser Teil des Plans gefiel mir nicht. Es war Max’ Idee gewesen.
In dem Moment, als Adolf das Paket in die Mülltonne fallen ließ, trat Phil in einem grünen Parka mit Reißverschlüssen, die Kapuze über den Kopf gezogen, aus dem Rathaus. In der Hand trug er einen Reiseführer, um den Hals einen Fotoapparat, sein Blick wanderte nachdenklich und bewundernd über den Platz. Den Kopf in den Nacken gelegt, näherte er sich langsam dem Polizisten, der mitten auf dem Platz stand. Zur selben Zeit legte Benny die Hand auf seine granatrote Diplomatentasche und öffnete den Verschluß. Dann erhob er sich und ging langsam auf die Bank zu. Adolf legte sich neben mich.
Um 12.58 Uhr und 58 Sekunden zog Phil einen Revolver aus seiner geräumigen Parkatasche und ließ ihn auf den Kopf des dicken Polizisten sausen, der in sich zusammensackte. Um 12.59 Uhr explodierte der von Max gebaute Sprengsatz. Der Druck der Explosion ließ die Fensterscheiben und Türen der Bank zerspringen. Instinktiv warfen sich die beiden Wachmänner auf den Boden. Ich erhob mich und lief zum Wagen. Mit zwei Sätzen war Benny bei ihnen, hatte seine Maschinenpistole aus der Diplomatentasche gezogen und richtete sie auf die benommenen Begleitmänner. Da ihnen sein Blick sagte, daß es ihm bitterernst war, rührten sie sich nicht. Die Türen der Bank waren in tausend Scherben zersplittert, und der einzige Angestellte erschien verängstigt auf der Schwelle. Phil schob ihn mit vorgehaltener Waffe zurück ins Innere und drängte ihn an eine Wand. Der Fahrer war aus dem Wagen gesprungen und lief unvorsichtigerweise zum Heck. Im Handumdrehen war ich bei ihm, und in diesem Augenblick sah ich sie.
In einem eleganten roten Kostüm ging sie, anscheinend von dem Drama, das sich hier abspielte, völlig unberührt, eilig inmitten all der schreienden, fliehenden Menschen über die andere Seite des Platzes.
Den Bruchteil einer Sekunde betrachtete ich sie verblüfft.
»Achtung!« Phils Ruf schreckte mich auf, und ich duckte mich genau in dem Augenblick, als der Fahrer auf den Abzug drückte. Ich rammte ihm meinen Kopf in den Unterleib, so daß er nach hinten taumelte, und versetzte ihm im Fallen einen heftigen Handkantenschlag in den Nacken. Dann sprang ich auf den Fahrersitz. Der Schlüssel steckte im Zündschloß, und ich ließ den Motor an. Adolf bellte laut und aufgeregt. Phil ließ den blassen Angestellten, der sich mit ungläubiger Miene den Magen massierte, stehen und kam zu mir gelaufen. Ich hatte ihm die Tür geöffnet, und er setzte sich auf den Beifahrersitz. Benny sprang in den Laderaum, nicht ohne zuvor einige Schüsse in die Luft gefeuert zu haben, angesichts derer sich die beiden erschrockenen Sicherheitsleute wieder auf den Boden warfen. Die Hecktüren des Lieferwagens schlugen zu. Es war 13.04 Uhr.
»Fahr los!« brüllte Benny.
Ich fuhr mit quietschenden Rädern an.
Hinter uns erklangen Schüsse, die jedoch dem gepanzerten Wagen nichts anhaben konnten. Ich raste schon durch eine Nebenstraße. Phil schaute mich weiß vor Wut an:
»Verdammt noch mal, Georges, bist du verrückt oder was? Beinahe hättest du alles versaut. Wo hast du denn bloß hingesehen, verflucht?«
Ich konnte ihm schlecht antworten: ›Zu meiner Frau.‹ Also antwortete ich gar nicht. Verbissen konzentrierte sich Phil wieder auf die Straße. Der Lieferwagen war breit, die Straßen schmal, und so riß ich einem schlecht geparkten Mercedes den Kotflügel weg. Kein Kommentar. Es machte mich nicht eben glücklich, Phil in Wut gebracht zu haben. Ehe er sich auf Überfälle verlegte, war er ein gedungener Killer gewesen. Doch seit ihm einige Typen, bei denen er Spielschulden hatte, die Knochen beider Hände gebrochen hatten, hatte er seine Treffsicherheit verloren. So hatte er umsatteln müssen. Doch sein übler Charakter und sein Hang zum Morden waren ihm geblieben. Man könnte sagen, Phil in Zorn zu versetzen war in etwa so, als würde man einer Klapperschlange auf den Schwanz treten.
Die Ampel sprang auf Rot. Unter wildem Gehupe schoß der Wagen über die Kreuzung. Ich bog links in eine kleine gepflasterte Straße, und nachdem wir eine Weile durchgerüttelt worden waren, erreichten wir das große Tor, das zum Innenhof eines alten Patrizierhauses führte. Es stand offen. Unter den verdutzten Blicken einiger Passanten raste ich auf den Hof. In der Ferne hörte man die ersten Polizeisirenen – wie eine Rudel Wölfe, das seine Beute jagt.
Es war ein großer Hof, und da in dem Haus nur noch verstaubte Archive untergebracht waren, gab es hier, außer einem alten Angestellten in einem blauen Kittel, keine Menschenseele. Darum hatten wir es uns auch als Garage ausgesucht. Der Alte dämmerte jetzt bewußtlos neben seinem Schreibtisch. Max, der uns erwartete, schloß sofort das Tor hinter uns. Die Sirenen heulten durch die Stadt und kamen näher. Benny war schon aus dem Wagen gesprungen und warf die Säcke mit den Banknoten in einen der beiden Kombis, einen grauen Mercedes, der mit einem doppelten Boden ausgerüstet war. Phil gesellte sich zu ihm und machte sich daran, den anderen Wagen, einen blaßblauen Renault, Typ Société zu beladen, bei dem die Rückscheiben entfernt worden waren. Innerhalb von vierzig Minuten hatten wir den Gegenwert von 700.000 Dollar umgeladen. Phil warf eine Plane über den Boden des Renaults und Gipssäcke auf die Plane. Während der kurzen Fahrt im Geldtransporter hatte er seinen Parka und seine Jeans ausgezogen und stand nun in einem farbverklecksten Maleroverall da. Benny hatte seinen falschen Bart abgerissen, sich statt dessen einen wunderbaren graumelierten Schnauzbart angeklebt und die dazu passende Perücke übergestreift.
Und wieder öffnete Max das große geschnitzte Holztor, das den Innenhof abschloß, und Phil fuhr, gefolgt von Benny, hinaus. Jeder von beiden in eine andere Richtung. Ich hatte die Blindenverkleidung abgelegt und trug nun wieder meinen Weinhändler-Anzug. Nachdem er die schweren Torflügel geschlossen und zur Sicherheit einen Balken vorgelegt hatte, kam Max zu mir zurückgelaufen.
»Los, schnell«, rief er atemlos.
Während draußen aufgeregte Schreie erklangen, liefen wir über einen langen vergilbten Gang, der zu einem Durchgang im hinteren Teil des Hauses führte. Dumpfe Schläge hallten gegen das Tor. Die Meute war da … Die Tür am Ende des Ganges war gewöhnlich abgeschlossen, doch Max hatte eine halbe Stunde zuvor das Schloß aufgebrochen. Ich stieß sie mit der Schulter auf, und wir standen in einer alten gewundenen Gasse, an der Lagerräume und geschlossene Geschäfte lagen. Ein Viertel, das auf die Sanierung wartete … Mit gemäßigtem Schritt entfernten wir uns. Ich nach links, Max nach rechts. Gott weiß, wohin.
Max würde mit dem Zug nach Frankreich zurückfahren. Benny hatte ein Versteck in einer Nobelbleibe ganz in der Nähe des Europa-Parlaments gemietet. Es gab einen Aufzug, der direkt von der Tiefgarage zu den Appartements führte, und dort würde er sich mit dem Geld verstecken, bis sich die Lage wieder beruhigt hatte. Phil wohnte am Stadtrand in einem kleinen Häuschen mit Garage, wo er das Geld in einen speziell ausgestatteten Transportwagen für Rennpferde umladen würde, um dann in drei oder vier Tagen in aller Ruhe über die Grenze zu fahren. Benny würde es ihm gleichtun, und in genau sechs Tagen würden wir uns vor der Banque des Cantons Helvétiques in Genf treffen. Um dort ein wenig Geld einzuzahlen … So wie wir es seit drei Jahren regelmäßig taten.
Ich hatte zuerst mit Benny gearbeitet, den ich auf recht ungewöhnliche Weise kennengelernt hatte. Als ich eines Nachts völlig betrunken das Spielkasino verließ, sprach mich eine elegante junge Frau mit rauher Stimme an, die in einen weiten Mantel gehüllt war, dessen Kapuze ihr Gesicht im Schatten ließ. Ihr Wagen, ein roter Porsche, der ein wenig weiter entfernt geparkt war, habe eine Panne. Ob ich sie wohl nach Hause bringen könne. Eilig hatte ich mich bereit erklärt. Das wenige, was ich von ihren Zügen gesehen hatte, ließ ein klassisches, gutgeschnittenes Gesicht vermuten. Ich hatte gerade völlig legal ein hübsches Sümmchen gewonnen und Lust, mich zu amüsieren.
Nach drei Kilometern, als wir durch eine verlassene Gegend fuhren, zog die junge Frau einen beeindruckenden Revolver aus der Handtasche und befahl mir, anzuhalten. Mehr aus Neugierde als aus Angst gehorchte ich. Sie verlangte meine Brieftasche, und ich gab sie ihr, wartete aber nur auf eine Gelegenheit, das Blatt zu meinen Gunsten zu wenden. Und die gab sie mir, als sie die Tür öffnete, um zu einem Wagen zu laufen, der im Schatten der Bäume geparkt war.
Mit einem Satz war ich bei ihr und umklammerte ihr Handgelenk. Sie drückte ab, doch die Kugel schlug ins Gebüsch, und wir wälzten uns auf dem Boden. Zu meiner Überraschung hatte sie einen eisernen Griff, und plötzlich wurde ich mit einem Kinnhaken außer Gefecht gesetzt, während eine unverkennbar männliche Stimme auf englisch eine Flut von Flüchen ausstieß.
Wütend und verblüfft richtete ich mich gerade rechtzeitig auf, um zu beobachten, wie meine schöne Unbekannte mit zerrissenen Strumpfhosen, dem falschen Busen vor dem Bauch und verrutschter Perücke auf der Suche nach ihrem Revolver auf allen vieren durch das Gras kroch. Ich brach in schallendes Gelächter aus. Benny, denn um ihn handelte es sich, sah mich erstaunt an, um nach einer Weile ebenfalls loszulachen. Zwei Stunden darauf waren wir die dicksten Freunde und bereiteten unseren ersten Coup vor. Später erfuhr ich, daß er sich auf Transvestitenauftritte spezialisiert und damit die Verbrecherkartei der Polizei gehörig durcheinander gebracht hatte.
Benny hatte dann Phil kennengelernt, und dieser hatte uns wiederum im letzten Jahr Max gebracht. Ich konnte mich nicht beklagen, die Geschäfte gingen gut. Und das Gefühl, jedesmal alles auf eine Karte zu setzen, vermittelte mir ein Gefühl von Lebensintensität, das ich brauchte wie eine Droge. Ich brauchte die Gefahr, um zu spüren, daß ich existierte; das war vielleicht, wie Lanzmann behauptete, auf meine qualvolle Kindheit zurückzuführen, die mich von der Unbeständigkeit des Lebens überzeugt hatte. Ich schüttelte den Kopf, um diese Gedanken zu vertreiben und mich wieder auf die Gegenwart zu konzentrieren. Die Straße war voller unbekannter Passanten, die ihren Beschäftigungen nachgingen, die sich aber ebensogut jederzeit in eine mitleidlose Meute verwandeln konnten.
Langsam ging ich weiter und betrachtete die Auslagen der Schaufenster: Es war besser, sich unauffällig zu verhalten. Mein Flugzeug ging in eineinhalb Stunden. Das Bild der Frau in Rot, Marthas Doppelgängerin, war mir unaufhörlich vor Augen. Wieder schüttelte ich den Kopf. Einfach nur eine Ähnlichkeit, Punkt, aus! Und durch dieses kurze Abgelenktsein hätte ich beinahe alles kaputtgemacht! Ich dachte an Adolf und an seinen verwunderten Blick, als ich losgelaufen war. Der arme Hund. Sicher irrte er auf dem Platz umher und erwartete uns. Ich hoffte, daß ihn irgendein netter Mensch aufnehmen würde. Er hatte etwas Besseres verdient, als für eine Bande alter Gauner Bomben zu legen. Wenn er Glück hatte und die Polizisten ihn mochten, könnte er seine Tage als Polizeihund beenden … So weit war ich in meinen Gedanken, als ich plötzlich wieder jenes Schockgefühl empfand, ganz so, als würde ich von einer eisernen Hand geohrfeigt.
Zwanzig Meter von mir entfernt überquerte Marthas Double in dem bordeauxroten Chanelkostüm die Straße, die Füße in den schwarzen Pumps schritten elegant über das Pflaster, das lange, rote Haar wehte im Wind. Mein Herz schlug zum Zerspringen. Drei Polizeiwagen fuhren mit Sirenengeheul an uns vorbei. Gerne hätte ich »Martha!« gebrüllt, doch etwas hielt mich zurück. Sie wandte sich nach den Sirenen um, und ich erkannte deutlich ihr Gesicht. Es war Martha, sie war es! Martha hatte nie von einer Zwillingsschwester gesprochen. Plötzlich, fest entschlossen, die Wahrheit zu erfahren, ging ich zu ihr. Sie war vor einem weißen Volvo mit deutschem Kennzeichen stehengeblieben, dessen Fahrer – soweit ich das erkennen konnte, handelte es sich um einen älteren Herrn – ihr, nicht ohne sich zuvor nach allen Seiten umgesehen zu haben, die Tür öffnete. Als er mich bemerkte, blinzelte er leicht, ohne jedoch den geringsten Ausdruck zu zeigen. Martha stieg in den Wagen. Mitten durch den Verkehr lief ich auf sie zu und löste damit ein wildes Hupkonzert aus. Ich schrie:
»Martha!«
Doch meine Stimme ging in dem Autolärm unter. Als ich den Wagen erreichte, fuhr er schnell an. Er entfernte sich, und ich blieb atemlos stehen. Ein junger Polizist mit sommersprossigem Gesicht beobachtete mich. Sogleich leuchtete in meinem Gehirn ein Alarmsignal auf. Also tupfte ich mir ostentativ mit meinem Seidentaschentuch die Stirn ab und setzte die betrübte Miene eines Mannes auf, der gerade seine besten Freunde verpaßt hat. Der Polizist wandte sich um, er widmete seine Aufmerksamkeit jetzt einem Auto, das halb auf dem Gehsteig geparkt war. Meine Hände zitterten. Ich mußte etwas trinken. Schnell warf ich einen Blick auf meine Uhr. Keine Zeit. An der Straßenecke entdeckte ich eine Telefonzelle. Ich lief hin und kramte in meinen Taschen nach Kleingeld. Es wollte mir kaum gelingen, die Geldstücke in den Schlitz zu schieben, dann wählte ich die Nummer unserer Villa. Fünf lange Klingeltöne, dann ein leichtes Klicken. Ich konnte es kaum glauben, doch es war Marthas rauhe Stimme:
»Hallo?«
»Martha, alles in Ordnung?«
»Aber ja, warum? Was ist denn los, Georges, hast du ein Problem?«
»Das kann ich dir am Telefon nicht erklären, es ist unglaublich, eine solche Ähnlichkeit …«
»Georges, bist du sicher, daß es dir gutgeht? Hast du getrunken? Wo bist du?«
Das grelle Neonlicht mit der Aufschrift »Gefahr« begann wieder zu blinken, diesmal in extremis.
»In einem Pub. Ich habe eine Frau gesehen, die dir zum Verwechseln ähnlich sah, aber sie war rothaarig, verstehst du, und …«
»Georges, ich stand gerade unter der Dusche!«
»Entschuldige, also, bis heute abend.«
»Ich habe im Edelweiß einen Tisch reserviert, ist das in Ordnung?«
»Sehr gut …«
»Also, ciao Liebling.«
Martha hatte aufgelegt. Ich war im Begriff, wertvolle Zeit zu verlieren. Also machte ich mich wieder auf den Weg zum Bahnhof, ein Taxi fuhr an mir vorbei, doch es war besser, so wenig wie möglich aufzufallen. Martha konnte nicht allgegenwärtig sein, außer sie wäre ein übermenschliches Wesen. Doch das Zusammenleben mit ihr hatte mir auf angenehmste Weise bewiesen, daß sie durch und durch menschlich war. Das konnte nur bedeuten, daß ich langsam wahnsinnig wurde. Mir wurde bewußt, daß ich schweißgebadet war. Und das lag nicht nur an meinem eiligen Schritt, sondern vielmehr daran, daß mich ein Gefühl tiefer Verwirrung erfüllte. Wie ein Schlafwandler machte ich mich inmitten des entfernten Stimmengewirrs wieder auf den Weg.