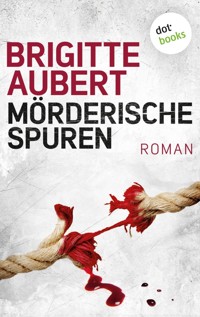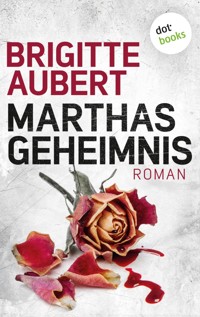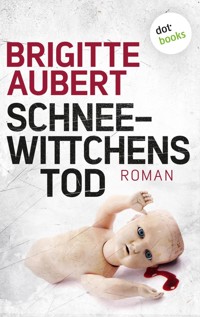
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Nichts für zarte Gemüter: Der Krimi "Schneewittchens Tod" von Brigitte Aubert jetzt als eBook bei dotbooks. Tierpräparator Léonard Moreno weiß, sein Beruf macht vielen Menschen Angst – Körper ausnehmen und konservieren, ständig mit Leichen hantieren. Sein neuester Auftrag führt jedoch sogar ihn an seine Grenzen: Er soll die Tochter seiner Auftraggeberin so präparieren, dass sie in einem Glassarg bei ihrer Familie bleiben kann. Während Léonard den kleinen Körper vorbereitet, entdeckt er merkwürdige Wunden … Ist das Mädchen vielleicht gar nicht bei einem Unfall gestorben? Als er dann auch noch erfährt, dass die Kleine nicht das erste Kind ist, das in der ach so vornehmen Familie Andrieu zu Tode kam, begibt sich Léonard auf eine schaurige Spurensuche … "Wahrlich nicht vorhersehbar und somit bis zur letzten Seite spannend!" Krimi-Couch Jetzt als eBook kaufen und genießen: "Schneewittchens Tod" von Bestsellerautorin Brigitte Aubert. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 548
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Über dieses Buch:
Tierpräparator Léonard Moreno weiß, sein Beruf macht vielen Menschen Angst – Körper ausnehmen und konservieren, ständig mit Leichen hantieren. Sein neuester Auftrag führt jedoch sogar ihn an seine Grenzen: Er soll die Tochter seiner Auftraggeberin so präparieren, dass sie in einem Glassarg bei ihrer Familie bleiben kann. Während Léonard den kleinen Körper vorbereitet, entdeckt er merkwürdige Wunden … Ist das Mädchen vielleicht gar nicht bei einem Unfall gestorben? Als er dann auch noch erfährt, dass die Kleine nicht das erste Kind ist, das in der ach so vornehmen Familie Andrieu zu Tode kam, begibt sich Léonard auf eine schaurige Spurensuche …
„Wahrlich nicht vorhersehbar und somit bis zur letzten Seite spannend!“ Krimi-Couch
Über die Autorin:
Brigitte Aubert gehört zu Frankreichs profiliertesten Spannungsautorinnen. Neben Kriminalromanen und Thrillern schreibt sie Drehbücher und war Fernsehproduzentin der erfolgreichen »Série noire«. 1996 erhielt sie den französischen Krimipreis. Heute lebt sie in Cannes und führt ein altes Kino, das sie von ihren Eltern übernommen hat.
Bei dotbooks erscheinen auch:
Die vier Söhne des Doktor March
Marthas Geheimnis
Sein anderes Gesicht
Der Puppendoktor
Nachtlokal
Im Dunkel der Wälder
Tod im Schnee
***
eBook-Neuausgabe August 2017
Copyright © der französischen Originalausgabe 2002 by Editions du Seuil, Paris
Die französischen Originalausgabe erschien 2002 unter dem Titel Funérarium bei der Editions du Seuil, Paris.
Copyright © der deutschen Ausgabe 2003 bei Wilhelm Goldmann Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Copyright © der Neuausgabe 2017 dotbooks GmbH, München
Die im Roman enthaltenen Gedichte wurden von Susanne Van Volxem übersetzt.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Jakub Krechowicz
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (sh)
ISBN 978-3-95824-994-3
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Schneewittchens Tod an: [email protected]
Gerne informieren wir Sie über unsere aktuellen Neuerscheinungen und attraktive Preisaktionen – melden Sie sich einfach für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Brigitte Aubert
Schneewittchens Tod
Roman
Aus dem Französischen von Eliane Hagedorn und Bettina Runge
dotbooks.
Unter dem flammenden Himmelein ferner Schleier, in meiner Seeleein Schleier.
Seichi
Schau, niemand ist zurückgekommen,der einmal fortgegangen ist.
Bestattungstext, Ägypten
PROLOG
Hund Hund Hundbebende Lefzenlauf lauf laufJapsen, Keuchenfeuchte ErdeHalsband, Ast, GeheulHund liebtHund trinktHund streuntHund, der du bistLiebst trinkst streunst, der du bistT.O.T.Doch kein Samen ergießt sich unter dem KörperUnd keine Alraune wächstAlraunwurzel als Hundeknochen?Sie sind auch Hundeohne Unterlass»Ah, ah! Das ist gut!«Der Hund aufgehängt wie ein NegerRotlicht FeuerkreuzWie gerne würde icheinen Menschen ans Kreuz nagelnLodernde FackelSie sie sieohne Unterlasshechelnde Zungenwilde Schreieals täte das wehSie sie siewie die HundeIch habe es auch getansie hat geweintRotlicht FeuerkreuzBeine verschränktHerz gebrochen
KAPITEL 1
Völlig nackt, Arme und Beine gespreizt, lag der alte Mann festgeschnallt auf dem weiß gekachelten, blutverschmierten Tisch. Sein schütteres Haar war sorgfältig zurückgekämmt und betonte sein ausgemergeltes Gesicht mit den kantigen Zügen. Sein überdehnter Mund ließ einen tadellosen Zahnersatz sehen.
Seine Augen – blaue klebrige Kugeln – ruhten neben ihm in einer rostfreien Metallschale.
Léonard »Chib« Moreno zog seine extra dünnen, befleckten Latexhandschuhe aus, rollte sie zu einer Kugel zusammen und warf sie in den Mülleimer, der von Wattetupfern, durchtränkt mit Sekreten, überquoll. Er streifte ein frisches Paar Handschuhe über und griff nach seinem glänzenden Chirurgenbesteck, das an der Wand befestigt war, gleich neben dem Labortisch mit den Phiolen, den versiegelten Töpfen, den Injektionsnadeln und Röhrchen. Er wählte ein Skalpell aus, wog es in seiner braunen Hand und trällerte dabei His Jelly Roll is Nice and Hot.
Ohne sein Trällern zu unterbrechen, griff er nach dem schlaffen Penis zwischen den behaarten bleichen Schenkeln des Greises und trennte ihn sauber ab. Er legte den blutigen Fleischfetzen in die dafür vorgesehene Emailleschale.
Das Geräusch der Klimaanlange erinnerte an das Summen eines Fliegenschwarms. Es musste schön draußen sein. Schön und heiß. Eine leichte Brise in den Palmen. Schaumkronen auf dem Meer, Luftmatratzen. Martinis on the rocks. Körper, die sich im Sand räkelten. Hier aber war es kalt, eine Kälte, die nach Formalin und Blut roch. Er stellte die Klimaanlage auf »Max.« und schlüpfte in seine ärmellose Goretex-Weste.
Dann füllte er einen Löffel mit heißem Teer und beugte sich erneut über den nackten Körper.
»Du wirst sehen, das wird perfekt!«, murmelte er und führte den Löffel in eines der Nasenlöcher, die noch rot waren von dem Haken, dessen er sich kurz zuvor bedient hatte.
Der Teer zischte beim Kontakt mit der Haut. Ganz vorsichtig neigte Chib den Löffel, damit nichts danebenging. Er wiederholte den Vorgang mehrere Male, gänzlich konzentriert auf seine Arbeit, wobei er jetzt On the Killing Floor summte. Der Teer musste die ganze Schädelhöhle ausfüllen.
Das Klingeln des Telefons ließ ihn zwar nicht zusammenzucken, aber er stieß einen kurzen Seufzer der Verärgerung aus, legte den dampfenden Löffel auf die behaarte Brust, um sein Handy aus der Tasche seines weißen Kittels zu angeln.
»Hi! Chib! Come va?«
»Ich bin beschäftigt, Greg.«
»Zwei Puppen, zuckersüß, zwanzig Uhr, im Navigator. Ich zähle auf dich.«
»Ich glaube nicht, dass ich kann. Ich muss hier was fertig machen.«
»He! Ich spreche nicht von Leichen, ich spreche von quicklebendigen Frauen.«
»Es geht im Leben nicht nur ums Bumsen, Greg.«
»Verdammt! Bei mir brauchst du dich nicht wie ein pädophiler Priester aufzuführen, ja? Gut, dann also bis später!«
Greg hatte schon aufgelegt. »Warum treffe ich mich immer wieder mit ihm?«, fragte sich Chib zum tausendsten Mal, während er die dampfenden Nasenlöcher mit Watte zustopfte. Diesem Typen, bei dem alle Gespräche nur um ein Wort kreisten – vögeln – und dessen Übersetzung in sechsunddreißig Sprachen. Ein geiler Bock, der ihm das Leben versaute, unter dem Vorwand, dass sie zusammen die Schulbank gedrückt hatten zu einer Zeit, als Léonard-le-Bâtard, der Bastard, heilfroh gewesen war, dass Grégory-le-Nanti, der Reiche, ihn gegen all die kräftigen Kerle der so genannten Motorrad-Gang verteidigt hatte – Idioten auf lächerlichen Mopeds, tätowiert mit Abziehbildern, die aber für ein schmächtiges Kerlchen mit Brille wie ihn Furcht erregend gewesen waren.
Muss Dankbarkeit ewig dauern, Herr? Würde er sich all diese Obszönitäten bis zum Grab anhören müssen? Nicht, dass er etwas gegen Sex und seine Freuden hätte, aber bei Greg war es kein Sex mehr, die Frauen waren beliebige »Schwanz-Passformen«, und das ödete ihn auf die Dauer an.
Er sah auf seine Armbanduhr, eine Kopie der 1938er Pilot’s Watch von Omega, eine kleine Extravaganz, die er sich unlängst geleistet hatte. 18 Uhr 4 Minuten 18 Sekunden. Er musste noch das Hirn in das Becken mit den Aromastoffen geben und alles sauber machen.
Was sollte er anziehen?
Eine Dreiviertelstunde später summte die elektronische Klingelanlage. Er steuerte auf die in die Wand eingelassene Apparatur zu und schaltete den Videobildschirm ein. Ein Frauengesicht erschien, um die siebzig, perfekt geliftet, große braune sorgfältig geschminkte Augen, leicht kollagenunterspritzte Lippen, kastanienbraunes, zu einem lockeren Knoten gebundenes Haar, eine dicke Schicht Creme-Make-up auf dem Hals, unter der man trotzdem die Altersflecken und die Falten von übermäßigem Sonnenbaden sah. Der Hals kann nur schwer lügen, dachte er bei sich, während er sie über die Sprechanlage begrüßte.
»Ich komme. Nehmen Sie schon Platz.«
Er tätschelte den Fuß der Leiche, der mit einem Etikett versehen war »Antoine di Fazio, 1914 – 2002«, zog seinen Kittel aus, stopfte ihn in die kleine Waschmaschine, erfrischte sich mit einem feuchten Waschlappen, bevor er in ein weißes Popelinhemd und eine schwarze Alpakahose schlüpfte und nach oben ging.
Gräfin di Fazio saß in dem kleinen High-Tech-Wartezimmer auf der Kante der schwarzen Ledercouch unter dem grau-blauen de Staël. Sie trug einen roten bequemen Samthosenanzug von Gucci. Zwei Goldarmreifen von Benin klirrten an ihrem linken Handgelenk. Das rechte schmückte lediglich eine Tiffany First Lady, stellte Chib fest.
Er verneigte sich kurz vor der Gräfin, die sich am Wasserspender ein Glas Wasser geholt hatte und es mit kleinen Schlucken leerte.
»Wie geht es ihm?«, fragte sie.
Eine reichlich idiotische Frage, da es sich um einen Toten handelte, aber er zeigte sich liebenswürdig:
»So gut es unter diesen Umständen möglich ist, Madame.«
»Sind Sie bald fertig?«
»In etwa achtundvierzig Stunden.«
Die Gräfin seufzte. Chib reichte ihr ein Kleenex-Tüchlein, mit dem sie sich vorsichtig die Augen abtupfte.
»Mein lieber armer Antoine!«
Ein alter Fiesling, der mit seinem Bentley ein Stoppschild überfahren und ein kleines Mädchen getötet hatte, bevor er selbst gegen einen Strommasten gerast war.
»Ich werde ihn im blauen Salon aufstellen, Lady Choupette zu seinen Füßen«, fuhr sie schniefend fort.
Chib hatte Lady Choupette im vorigen Herbst ausgestopft – ein Bulldoggenweibchen, so bissig wie sein Herrchen.
»Fürchten Sie nicht … dass Ihre Besucher …«, fragte er und warf einen verstohlenen Blick auf seine Uhr.
»Unsere Vorfahren ruhen in den Katakomben des Kapuzinerklosters in Palermo«, gab sie hochnäsig zurück. »Es ist bei uns üblich, die sterbliche Hülle unserer geliebten Verstorbenen auszustellen.«
So weit Chib informiert war, bestand die einzige bekannte Gewohnheit in der Familie der Gräfin aus durchtriebener Prostitution, dank derer sie sich den Grafen di Fazio geangelt hatte, einen steinreichen sizilianischen Reeder, zwanzig Jahre älter als sie. Doch er bewunderte es, dass die Gräfin die Familientradition ihres Gemahls fortführte. Schließlich passte der Sarkophag von Antoine di Fazio ganz gut in den mit viktorianischem Nippes und Porzellanpuppen voll gestopften blauen Salon.
»Ich verreise für etwa zehn Tage«, fuhr sie fort. »Die Hochzeit unseres Neffen in New York. Ich lasse ihn dann bei meiner Rückkehr abholen.«
»Überhaupt kein Problem.«
Sie zog ein gefaltetes Stück Papier aus ihrer Chanel-Handtasche und legte es auf das Plexiglastischchen. Daraufhin verabschiedete sie sich und entschwebte würdig in die Frische der Dämmerung.
Chib entfaltete den Scheck. Es war der vereinbarte Betrag. Ein hübsches Sümmchen. Seine Dienste hatten ihren Preis. Es gab fast niemanden mehr, der den Beruf nach den neuesten Methoden wie auch nach überlieferten auszuüben wusste.
Er schenkte sich ein Glas Wasser ein, trank die Hälfte und goss den Rest über seinen rasierten Schädel. Keine Zeit zum Duschen. Er knöpfte sein Hemd zu, band sich eine schwarze Strickkrawatte um, schlüpfte in ein schwarzes Alpakajackett, das zu seiner Hose passte, und setzte seinen kleinen schwarzen Filzhut auf. Er wollte schon gehen, als er merkte, dass er noch immer seine Plastiküberzieher über seinen schwarzen Mokassins trug. Er streifte sie ab, warf sie in einen Korb neben dem Schreibtisch aus Holz und Chrom, wo er über seine Ausgaben Buch führte, und trat in seinen Taxidermisten-Raum mit Schaufenster zur Straße.
Es war ein Zimmer mit verblichenen Tapeten, voll gestellt mit Füchsen, Wieseln, Hirschen und Wildschweinen, dazu, an den Wänden befestigt, mehrere Thun- und Schwertfische. Auf der Werkbank thronte ein kleiner Hai, gefangen von der Rule Britannia, einer Yacht, die in einem benachbarten Hafen ankerte.
Draußen schimmerte das Meer im letzten rötlichen Schein der Abenddämmerung. Seine ouabet, sein Reiner Platz, wie die Ägypter die Einrichtungen zur Bestattungspflege nannten, befand sich in einem Viertel am östlichen Stadtrand von Cannes und blickte auf den Strand. Er stieg in sein giftgrünes Floride-Kabrio, ein Peugeot-Modell von 1964, und ließ den Motor an.
Der Boulevard du Midi war schwarz vor Menschen, und er fuhr gute zehn Minuten im Kreis, bis er den Wagen unter einem Schild mit dem Abschleppzeichen geparkt hatte. Bald darauf war er am Navigator, Gregs bevorzugtem Restaurant, angelangt, einem schicken Lokal mit zuvorkommender Bedienung und einer geschmacklosen gelb- und lachsfarbenen Dekoration.
Greg stand neben seinem metallicroten Jeep. Er steckte noch in seinem königsblauen Neoprenanzug, ein braun gebranntes Muskelpaket, das blonde, von der Sonne gebleichte Haar zu einem Pferdeschwanz gebundenen, und rollte das leuchtende Segel seines Surfbretts zusammen. Zwei junge Frauen auf mindestens fünfzehn Zentimeter hohen Plateausohlen, die Arme vor ihren Siebziger-Jahre-Bustiers verschränkt, sahen ihm zu.
Chib schlenderte auf sie zu und musterte sie dabei eingehend. Die Große, um die dreißig, hatte struppiges rotes Haar und Piercings in Nase und Augenbrauen. Die Kleinere, ein Pummelchen mit großem Busen, hatte ihr platinblond gefärbtes Haar mit Plastikspangen gespickt, so dass es in Büscheln hochstand. Greg musste sie am Strand aufgegabelt haben, dachte Chib, während er ein höfliches »Salut« von sich gab.
»Ah, da bist du ja!«, rief Greg, zog seinen Anzug aus und stellte stolz seinen Waschbrettbauch und seine Gewichtheberbrust zur Schau. »Also, Mädchen, das ist Chib.«
»Chib?«, gluckste die Große. »Wie Kartoffelchip?«
»Chib, wie Chibata, meine Schöne!«, verbesserte Greg und stieg in seine Liberty Jeans.
Das Mädchen prustete erneut los, und Chib spürte, wie ihm die Röte bis an die Haarwurzeln schoss. Greg schlüpfte in seine abgetretenen Timberlands, streifte seinen senfgelben Marlboro-Pullover über, rief »Auf geht’s!« und hakte sich bei beiden Mädchen unter.
»Verdammt, willst du uns mit deiner Totengräber-Kluft den Abend verderben?«, raunte er ihm zu. »Warum ziehst du nie das Lacoste-Shirt an, das ich dir geschenkt habe?«
Ein rosafarbenes Sweatshirt? Nein, danke. Chibs heimliches Wunschbild waren die fünfziger Jahre, der Black-Jazz. Er war Lester Young, und er schlief mit Billie Holiday, während er magische Solos in verrauchten Kneipen spielte, immer in Schwarz und Weiß, so wie auf den Fotos. Kein rosafarbenes Sweatshirt für Lester Young.
Greg hatte den besten Tisch reserviert, in einer Ecke am Fenster mit Blick über die Motorhauben der am Bordstein parkenden Wagen hinweg aufs Meer – eine Palmengruppe und ein Stück vom Alten Hafen mit dem Palais des Congrès.
Die Große hieß Sophie, das Pummelchen Pam. Pam! Chib trank schweigend seinen Tomatensaft, während Greg einen seiner ewigen Witze erzählte. Chib hatte absichtlich einen Tomatensaft genommen, weil er wusste, dass es Greg ärgerte, der schon bei seinem zweiten Pastis war und die Mädchen drängte, noch etwas zu trinken, bevor die Meeresfrüchte kamen. Als wäre es heutzutage noch nötig, Frauen abzufüllen, um sie rumzukriegen. Als lebte man noch zu der Zeit, als drei schwarze Matrosen auf Sauftour die zwanzigjährige Ida Moreno vergewaltigt hatten, die sich nach ihrer Arbeit als Platzanweiserin in einem Kino hatte breitschlagen lassen, etwas mit ihnen zu trinken. Neun Monate später folgte die Geburt von Léonard Moreno, Väter unbekannt. Vorname Léonard Bernstein zu Ehren: Ida war begeisterte Musikfreundin und spielte Violine in einem kleinen lokalen Orchester. Der Name Chib entstand erst später, als er begonnen hatte, sich mit den Toten zu beschäftigen.
Ein Kellner stellte eine riesige Platte mit Meeresfrüchten auf den Tisch, mit Austern, Venus-, Mies- und Herzmuscheln, mit Krebsen, Meeresspinnen, Seeigeln und Seegurken. Greg stürzte sich auf eine Seegurke, die Chib mit ihrem unbehaarten, glänzenden Äußeren an den welken Penis des alten Antoine di Fazio erinnerte.
Pam und Sophie erzählten von ihrer Heimatstadt Metz. Sie waren im Zug hierher gekommen und wollten weiter bis nach Genua zu einer kleinen Tour an der Riviera. Greg spulte seine endlose Liste guter Adressen und guter Vorschläge herunter und zerteilte dabei seine Seegurke, die kleine Bläschen von sich gab wie ein Ertrinkender.
Chib wählte ein paar nicht zu fette Austern, eine Krebsschere, drei Seeigel und beträufelte alles reichlich mit Zitronensaft. Er durfte sich nicht länger von Greg tyrannisieren lassen. Er durfte nicht länger seine Abende damit verbringen, mit Gregs flüchtigen Eroberungen höfliche Konversation zu machen. Er war nicht Greg, er hatte nicht das vulgäre Charisma von Greg, er würde nie groß, blond, schön und blöd sein. Er war zu klein – ein Meter fünfundsechzig – zu dünn – nicht mal fünfundfünfzig Kilo – zu dunkel – wenn auch nicht richtig schwarz –, mit großen Husky-Augen, einem störenden Hellblau in seinem goldbraunen Gesicht. Die Augen von Ida. Einer seiner Vergewaltiger-Väter musste einen blauen Gameten gehabt haben. Ida hatte Anzeige erstatten wollen, die USS Constellation aber war schon wieder in See gestochen. Ein alter Polizist mit gelben Zähnen hatte ihr geraten, einen Schlussstrich zu ziehen. Sie sei noch jung, sie würde sich schon wieder fassen.
Jung, ohne Familie, mit einem farbigen Bastard. Im Cannes der späten fünfziger Jahre war das nicht gerade ein idealer Ausgangspunkt für die soziale Integration. Ida hatte eine Bleibe gefunden – am Fuß der Altstadt, im Suquet, einem Altbau, dessen beide untere Stockwerke von Madame Hortense, der Mutter von Greg, bewohnt wurden. Sie war die Wirtin der berühmtesten »amerikanischen Bar« der Stadt, einem Club mit Hostessen, auf Wunsch auch mehr, dessen Schild stolz am Eingang zum Hafen prangte. Im dritten Stock logierte Monsieur El Ayache, der ein Zimmer seiner Wohnung als Werkstatt nutzte, in dem er dem Beruf eines Tierausstopfers nachging, wie man damals noch sagte.
»Rot oder weiß?«
»Hm?«
Greg deutete auf zwei Flaschen Sancerre. In seine Erinnerungen vertieft, entschied sich Chib aufs Geratewohl für den Roten. Sophie aß ihre Austern mit einem begeisterten Schlürfen, Pam schlug sich mit ihrer Meeresspinne herum. Greg reihte eine Anekdote an die andere, brachte die Mädchen zum Lachen, wie immer mit ungeheurer Lässigkeit, so, als steckte seine Platin-Kreditkarte zwischen seinen Zähnen und garantierte ihm ein ewiges Lächeln.
Es dauerte nicht lange, und der kleine Léonard verbrachte seine Abende bei dem alten Ägypter, der ihn in seine Kunst einweihte. Er war begabt, er lernte schnell, und ihm gefiel diese Tätigkeit. Als er zwölf Jahre war, hatte El Ayache ihm ein sehr altes, ledergebundenes und handgenähtes Buch anvertraut, das voller unverständlicher Zeichen war. Farid El Ayache gehöre der Bruderschaft der Mysterien an und sei einer der letzten Nachfahren der Einbalsamier-Priester, hatte er dem verdutzten Jungen noch mitgeteilt. Er hatte Krebs, er würde sterben und wollte Léonard seine Geheimnisse anvertrauen, damit dieser die tausendjährige Fackel übernahm.
Es war wie ein Märchen, ein Fantasy-Roman, dessen Held plötzlich Léonard war. Er hatte das Angebot natürlich angenommen und absolute Verschwiegenheit gelobt, indem er die Haut seines Bauches durch zwölf Schnitte mit dem Silexmesser opferte. Dann hatte er den Sud aus Kräutern und Lurchblut getrunken, sich mit Myrrhe und Essenzen salben lassen und war zwei Jahre später, nach dem Tod von Monsieur Al Ayache, offiziell – und insgeheim – großer Einbalsamier-Priester, Meister der Mysterien und Vertreter des Amon-Re-Ordens für die ganze Côte d’Azur geworden.
Mit vierzehn fand er das gar nicht übel, leider aber reichte es nicht aus, um sich die dreckigen Rassistenschweine in der Schule vom Hals zu halten. Greg konnte das sehr viel wirkungsvoller, und er musste als Gegenleistung nur seine Hausaufgaben machen.
»Können Sie mir das aufmachen?«
»Hm?«
Pam hielt ihm ein widerspenstiges, spitzes Bein hin. Chib steckte es in die Metallzange, ließ es krachen und legte das weiße saftige Fleisch frei.
»Was machen Sie beruflich?«, Pam biss in ihre Spinne.
»Ich habe einen kleinen Taxidermie-Laden«, antwortete Chib und schenkte ihr Weißwein ein.
»Er beschäftigt sich mit Tieren«, fiel ihm Greg ins Wort. »Er ist Präparator.«
»Ah!«, rief Pam aus. »Ich liebe Tiere!«
»Er auch … was, Chib? Er hat ein Herz für Tiere.«
Chib kam sich lächerlich vor. Pam fing an, von Greenpeace zu reden, dann vom Tankerunglück vor den Küsten der Bretagne, vom Teer im Gefieder der Vögel. Chib dachte an den Teer in Antoine di Fazios Körper. Die Gräfin hatte einen Sarkophag mit Feingoldüberzug für seine sterbliche Hülle anfertigen lassen.
»Gehen wir tanzen?«, schlug Greg vor und bat um die Rechnung. »Ich kenne einen echt coolen Klub. Der Besitzer ist ein guter Freund. Beim Festival gehen dort alle Stars hin.«
Sophie und Pam tauschten einen vielsagenden Blick, »So, so«, während Greg den Beleg unterschrieb. Chib war müde, er wollte nach Hause und schlafen. Doch er hörte schon Gregs Proteste.
Draußen ließen ein paar Typen ihre schweren Maschinen aufheulen. Ein lauer Wind trug das Rauschen der Wellen vom Meer her, die weiter unten über den einsamen Strand rollten, bis zu ihnen. Vor der Terrasse der benachbarten Pizzeria spielte ein junger Kerl auf seiner elektrischen Gitarre McLaughlin, gar nicht übel …
Chib versuchte, sich zu verdrücken, doch wie er’s geahnt hatte, protestierte Greg lautstark. Er ließ sich breitschlagen, mit ihnen ins Sofa, Gregs Nachthöhle, zu gehen. Im Rover kicherten die Mädchen unentwegt, gaben ihre Kommentare ab zu den Passanten, die über den Kai flanierten, und staunten lauthals über die schicken, blank polierten Luxusyachten. Als sie am Kasino vorbeifuhren, stießen sie kleine aufgeregte Schreie aus, und Greg, der große Prinz, wendete und hielt mit quietschenden Reifen vor dem parking valet.
Zack, die Schlüssel fliegen dem Typen in blau-goldener Uniform entgegen, »Hier, mein Guter«, und hopp, man hilft den jungen Damen aus dem Wagen »Nun mach schon, Chib«, und man tritt gelassen und siegessicher ein, als wäre man zu Hause.
Sanfte, leicht jazzige Musik, Art-déco-Ambiente, ein riesiges Aquarium mit exotischen Fischen und der Raum mit den Automaten, vibrierend von Klirren und Summen, von klingelnden Lichtern, von Spots und von Rufen. Ein Höllenlärm, der in Spiralen bis zu der hohen Decke aufstieg. Greg zog ein dickes Bündel mit zerknitterten Hundert-Euro-Scheinen aus der Tasche. Er reichte jedem Mädchen einen. »Amüsiert euch ein bisschen, meine Schönen.« Erneutes Glucksen. Empfehlungen von Greg-dem-Strategen, welches die guten und die schlechten Automaten sind: »Hopp, es geht direkt zu den Zwei-Euro-Automaten, man spielt schließlich nicht mit den Hinterwäldlern, aber warte, ich würde gern eine kleine Tour zu den Zehn-Euro-Monstern machen, was meinst du, Chib?«
Chib nickte. Wie du willst, Greg, also los, Greg, hauen wir dein Geld auf den Kopf.
Mit einer Schachtel voller großer Jetons unterm Arm, eine Monte Cristo im Mundwinkel, prüfte Greg den Automaten mit zusammengekniffenen Augen, als dächte er: Wirst schon sehen, du Schlampe, mit mir ist nicht zu spaßen, während Pam und Sophie den vom Haus spendierten Champagner schlürften.
Chib dachte unterdessen an Antoine di Fazio. Hatte er genug Sägespäne? Er hatte vergessen, in der Vorratskammer nachzusehen.
Bei jeder Runde gab die Geldmaschine ein Ritornell, bei jedem Gewinn triumphierende Klänge von sich. Greg gewann, versteht sich. Die wenigen Male, die Chib gespielt hatte, hatte er verloren. Haushoch verloren. Greg dagegen gewann immer. Greg war das lebende Beispiel für die Ungerechtigkeit der menschlichen Existenz. Er hatte nie einen Finger gekrümmt, um Erfolg zu haben, er dachte nur daran, sich zu amüsieren, seine Umgebung war ihm völlig egal, und alles gelang ihm.
»Materieller Erfolg ist nichts als ein Irrlicht, eine Hand voll Sand, der im Wind der Ewigkeit zerstäubt«, flüsterte Monsieur El Ayache Chib ins Ohr. Ja, mag sein. Er gähnte verstohlen. Keine Lust, mit einer begeisterten Pam im Bett zu landen, die nach Meerspinne stank, oder mit einer nörgelnden Sophie, die seine Wohnung kritisierte. Nur Lust, sich allein in die Falle zu hauen, den letzten Hit vom No Smoking Orchestra, den er eben gekauft hatte, anzuhören und dabei ein eisgekühltes Bud trinken.
Er nutzte den Augenblick, als Greg, gefolgt von den begeisterten Mädchen, seinen riesigen Berg Jetons eintauschte, um sich aus dem Staub zu machen.
Zurück zu seinem Floride, o Wunder: Er stand noch da. Er zog seinen Mini-CD-Player aus der Hemdtasche, schob ihn ins Armaturenbrett. Tom Waits, Lowside an the Road.
Vor seinem Haus angekommen, stellte er den Motor ab und blieb ein Weilchen sitzen, um dem Meer und den Möwen zu lauschen. Er war müde. Er wünschte, dass etwas passieren würde.
In seiner Wohnung strich er automatisch über den Kopf von Foxy, dem Fuchs, seinem allerersten Werk. Ein armer alter zahnloser Fuchs, dem büschelweise das Fell ausfiel.
Er ging ins Zwischengeschoss, ließ sich auf den Futon fallen, der direkt auf den glasierten Terrakottafliesen lag. Das rote Lämpchen des Anrufbeantworters blinkte. Piep.
»Guten Abend«, sagte eine tiefe Frauenstimme. »Bitte rufen Sie mich zurück unter der Nummer null sechs, null sieben, zwölf, einunddreißig, vierzehn.«
Chib runzelte die Stirn: kein Name. Sicher Arbeit. Wie spät war es? Dreiundzwanzig Uhr. Er wählte die Nummer. Dreimal klingeln. Dann die Frau, ihre sehr ernste Stimme.
»Ja?«
»Hier ist Léonard Moreno, Sie haben mir auf Band gesprochen.«
»Ah, Monsieur Moreno, danke, dass Sie mich gleich zurückrufen. Man hat mir geraten, mich an Sie zu wenden; es geht um einen etwas sonderbaren Auftrag.«
»Ich höre«, antwortete Chib, sanft wie ein Priester, der sein Gegenüber zur Beichte ermuntert.
»Wir haben soeben unseren geliebten kleinen Engel verloren«, fuhr die Stimme mit einem leichten Beben fort, »unsere liebe kleine Elilou.«
»Tut mir Leid«, murmelte Chib, der sich fragte, ob es um eine Hündin ging.
»Aber nicht so wie uns«, entgegnete die Frau. »Das arme kleine Herzchen war eben erst acht Jahre alt.«
Schniefen. Verdammt, es ging doch wohl nicht um ein kleines Mädchen?
»Diese verdammte Treppe … entschuldigen Sie …«
Sie weinte jetzt leise, nicht zu unterdrückende Schluchzer. Chib, der auf seinem Futon hockte, kratzte sich unbehaglich das Schienbein.
»Wir müssten uns treffen«, fuhr die Frau fort, nachdem sie sich geschnäuzt hatte …
»Meine Adresse ist Boulevard Gazagnaire, Nummer hundertachtundzwanzig«, sagte er. »Sie können vorbeikommen, wann immer Sie wollen.«
»Mir wäre es lieber, wir würden uns in der Bar des Majestic treffen, wenn Ihnen das keine Umstände macht, morgen früh um zehn Uhr.«
Sie legte auf, ohne seine Antwort abzuwarten. Eine verzweifelte Frau, reich und daran gewöhnt, dass man ihr gehorcht, ohne zu diskutieren. Eine Kundin, die bereit ist, ein Maximum hinzublättern. Um ihre kleine Tochter einbalsamieren zu lassen.
KAPITEL 2
Wind war aufgekommen, ein kalter, schneidender Mistral, der das Meer mit weißen Schaumkronen versah. Chib schlug den Kragen seiner Jacke hoch und vergrub die Hände tief in den Taschen. In der glitzernden Sonne wirkte die Stadt, als hätte man sie mit Chlorwasser gescheuert – die Farben waren belebt, die Konturen sauber, wie gestochen.
Es war niemand auf der Terrasse des Majestic. Er trat in die Bar und suchte das Halbdunkel nach seiner zukünftigen Klientin ab. Sie musste um die fünfzig sein, eher von der noblen Sorte, sagte er sich. Drei Viertel seiner Kundschaft mit »sonderbaren« Aufträgen, rekrutierte sich aus dieser Kategorie. Leute in einem gewissen Alter, die über die entsprechenden Mittel verfügten und einen Hang zum Romantisch-Morbiden hatten.
Zwei kleine alte Damen, Croissantkrümel in den Mundwinkeln, plauderten munter und tranken dabei genussvoll ihren Tee. Ein Geschäftsmann im marineblauen Anzug, den Stöpsel seines Handys im linken Ohr, den »Organizer« in der rechten Hand, las Le Monde. Eine junge blonde Frau mit Rock und flaschengrüner Strickjacke schimpfte leise mit ihrer kleinen Tochter, die sich weigerte, ihre kalte Milch zu trinken und trotzig den Kopf schüttelte. Ein Touristenpärchen, ausstaffiert mit Karten und Fotoapparaten, stritt, über einen Führer gebeugt, miteinander.
Gut, sagte sich Chib, sie ist noch nicht da. Er bestellte einen starken Espresso und knackte mit den Fingergelenken. Er war nervös.
Der Kaffee war gut. Er trank ihn langsam und beobachtete den Raum dabei im Spiegel über dem Tresen. 10 Uhr 10. Würde sie kommen? Jemand berührte ihn an der Schulter; er fuhr herum und verschüttete dabei etwas Kaffee.
Die junge Frau in Grün musterte ihn mit ihren großen grauen mandelförmigen Augen. Etwa seine Größe, von aristokratischer Schlankheit, leicht gebeugt, Mitte dreißig. Feines, schmales Gesicht, hohe Wangenknochen, wohlgeformte Lippen. Sie hatte was von Vivian Leigh, dachte er bei sich.
»Monsieur Moreno?«, fragte sie mit dieser unglaublich tiefen Stimme, die überraschte bei einem so zierlichen Körper.
Chib murmelte »ähm … ja« und kletterte von seinem Barhocker.
Das kleine Mädchen, fünf oder sechs, saß in dem viel zu großen Ledersessel und spielte mit einem elektronischen Gameboy, den sie in alle Richtungen schüttelte. Die junge Frau machte Chib ein Zeichen, ihr zu folgen.
Sie nahmen Platz. Sie trank einen Schluck Perrier, bevor sie sprach.
»Ich bin Blanche Andrieu«, sagte sie. »Das ist Annabelle. Sag guten Tag, Anna.«
»Nein!«, knurrte Annabelle und kauerte sich noch tiefer in ihren Sessel. »Papa will nicht, dass wir mit den Goulou-Goulou sprechen.«
»Goulou-Goulou«, so wurden die Afrikaner genannt, die Glasschmuck am Strand verkauften. Léonard rieb sich vorsichtig den Nasenrücken. Und Madame hieß zu allem Überfluss Blanche …
»Anna!«, schimpfte die Frau.
Dann wandte sie sich wieder ihm zu und sagte:
»Entschuldigen Sie die Kleine, aber sie ist im Augenblick völlig durcheinander.«
»Klatsch, voll auf die Nase!«, brüllte Annabelle und drückte hektisch auf die Knöpfe ihres Gameboy, auf dem sich zwei Karatekämpfer krümmten.
»Wir sind Freunde der Gräfin di Fazio«, fuhr Blanche fort.
»Jean-Hugues, mein Mann, spielt – das heißt spielte – Golf mit Antoine.«
»Ist Ihr Mann auch Reeder?«, fragte Chib.
»Nein, er ist im Finanzgeschäft.«
Geld, ein Haufen Geld in Aussicht.
»Womit kann ich Ihnen dienen?«
»Wumm, jetzt bist du tot!«, triumphierte Annabelle.
»Leise, Cherie. Möchten Sie noch einen Kaffee?«
»Gerne, danke.«
Der Kellner stand schon neben ihr, bevor Chib geantwortet hatte. Sie bestellte zwei Kaffee und richtete ihre Aufmerksamkeit auf ihr leeres Glas Perrier.
»Wir sind seit fünfzehn Jahren verheiratet. Wir hatten sechs Kinder. Wir sind katholisch«, fügte sie hinzu, als wäre das eine Rechtfertigung.
Wie alt mochte sie sein? Schwer zu sagen bei diesen so sehr gepflegten Frauen. Auf alle Fälle noch keine vierzig. Er konnte sie sich eigentlich nicht mit sechs Bälgern am Rockzipfel vorstellen. Sie wühlte in ihrer Hermès-Tasche und zog ein Foto hervor.
»Hier«, sagte sie.
Vor blühenden, sauber gestutzten Rhododendronsträuchern stand die Familie Andrieu aufgereiht.
»Das ist Jean-Hugues«, sagte sie.
Der Vater, groß, schlank, hellblondes, kurz geschnittenes Haar, eckiges Kinn, blaue Augen mit stechendem Blick, in einem weißen Jogginganzug, der so sauber war, dass man davon geblendet war, an den Füßen Air Max Sphere. Er hielt ein etwa zweijähriges Mädchen auf dem Arm.
»Eunice, unsere Jüngste«, erklärte sie.
Neben dem Vater vier weitere Kinder, alle strohblond. Er erkannte Annabelle, die ans Hosenbein ihres Vaters geklammert war und Grimassen in Richtung Objektiv schnitt.
»Und das ist Charles, unser Ältester«, fuhr die Madame Andrieu fort und deutete auf einen Heranwachsenden mit Bürstenschnitt.
Auch er im Jogginganzug – dem gleichen wie Papa, dessen Doppelgänger er zu sein schien. Groß und stark, sehr blass, mit schmalen roten Lippen und traurigem Gesichtsausdruck.
»Louis-Marie.« Sie zeigte auf einen anderen Jungen, sehr viel schmächtiger, marineblauer Blazer, das glatte Haar zurückgekämmt, verächtlich verzogener Mund, zwei Finger über dem Kopf eines kleinen Mädchens mit strahlendem Lächeln zum Victory-Zeichen geformt … »Und das, das ist sie, unsere kleine Elilou«, murmelte sie und wurde blass, »unsere Elisabeth-Louise.«
Chib vertiefte sich in die Betrachtung des Fotos, um ihr Zeit zu geben, sich wieder zu fassen.
Elisabeth-Louise. Die Kleine zeigte ein strahlendes Lächeln, das die Zahnspange zur Schau stellte, ihr langes blondes Haar wehte im Wind, ihr Gesicht war von Sommersprossen übersät … das Foto war eine perfekte Reklame für die vorbildliche Familie.
»Mein Gott, wenn wir das geahnt hätten …«, fügte Blanche Andrieu seufzend hinzu.
Sie hustete und fuhr fort:
»Ich habe das Foto letzten Monat gemacht. Am siebzehnten März. Es war der Geburtstag von Louis-Marie.«
Das war der Eingebildete im Blazer. Chib wollte ihr das Foto schon zurückgeben, als er bemerkte, dass der Älteste, Charles, selbst ein Foto in Richtung Kamera hielt, das einen kleinen Jungen in Windelhosen zeigte, blond gelockt, Grübchen. Sie fing seinen Blick auf.
»Léon, unser Dritter. Er ist zweiundneunzig im Swimmingpool ertrunken, er war achtzehn Monate alt«, erklärte sie ruhig.
Chib verschlug es fast den Atem, und er räusperte sich, bevor er fragte:
»Was kann ich für Sie tun?«
Sie sah ihm in die Augen.
»Ich will Elilou bei uns behalten, Monsieur Moreno. Es kommt nicht in Frage, dass wir sie allein unter der Erde lassen wie ihren armen Bruder.«
Der Kellner stellte zwei Tassen Espresso auf ihren Tisch und verschwand.
»Wie denkt Ihr Mann darüber?«, fragte Chib und trank einen Schluck viel zu heißen Espresso.
»Jean-Hugues ist natürlich einverstanden. Ich hätte einen solchen Schritt nie ohne sein Einverständnis unternommen. Ich bin es nicht gewöhnt, etwas ohne das Wissen meines Mannes zu tun.«
Er beobachtete sie, während sie Zucker in ihren Espresso gab.
Kleines goldenes Kreuz am Hals, sonst kein Schmuck außer dem Ehering, sehr wenig Make-up, katholisch bis in die Fingerspitzen, die Fingernägel nicht zu lang, sorgfältig perlmuttfarben lackiert. Die Art von verklemmter Noblesse, die ihn auf die Palme brachte. Bis hin zu ihrem Herms-Täschchen, auf das er am liebsten geschossen hätte. Ein sehr schlichtes Modell, Marke »Kolleg-Mappe«, das weit über zweitausend Euro gekostet haben dürfte.
Und die Vorstellung, am Körper eines Kindes zu arbeiten, war ihm zuwider. Er würde einfach ablehnen.
»Wo ist … Elilou zurzeit?«, hörte er sich trotzdem fragen.
»Neben dem Landhaus gibt es eine kleine Kapelle«, erklärte sie. »Sie … sie hat uns vorgestern verlassen. Unser Hausarzt ist gekommen, er hat den … Tod … festgestellt …«
»Fick dich ins Knie!«, rief die Kleine.
»Annabelle! Dass ich so was nie mehr aus deinem Mund höre! Du bekommst Fernseh-Verbot für die ganze Woche.«
Annabelle fing an zu heulen und hämmerte mit ihren kleinen Fäusten wütend auf die Armlehnen.
»Entschuldigen Sie ihr Verhalten. Sie steht unter Schock, wie wir alle«, sagte Blanche, und ihre Lippen zitterten.
Hübsche Lippen, fest und voll.
Und die Leiche eines kleinen Mädchens in einer Kapelle. Ihm Blut und Eingeweide entnehmen. Diese tadellos gepflegte Frau, die ihren Kummer so kühl zum Ausdruck brachte.
»Man braucht eine Genehmigung …«
»Mein Mann hat sich darum gekümmert. Wir haben einen privaten Friedhof auf dem Anwesen«, erklärte sie, die Augen noch immer auf eine schmollende Annabelle geheftet, die aufgesprungen war.
»Es ist ein kostspieliger Eingriff«, fügte Chib mit getragener Stimme hinzu.
»Das spielt überhaupt keine Rolle. Ich will, dass unser Engel bei uns bleibt, ich will ihr kleines Gesicht sehen, ihre kleinen Hände berühren können …«
Ihren kleinen kalten und steifen Körper. Der niemals wachsen wird. Der mit der Zeit weniger einem schlafenden Kind als der staubigen Hülle einer verschrumpelten Zwergin gleichen wird.
»Dann also das Formalin-Verfahren?«, fragte Chib noch immer mit leiser Stimme, während Annabelle auf der Terrasse hinter einer Taube herlief. »Chemische Konservierung?«
Blanche schien plötzliche Übelkeit zu unterdrücken, dann stimmte sie zu.
»Etwas, das sie so lange wie möglich … lebendig bleiben lässt.«
Ihre Stimme zitterte bei dem Wort »lebendig«. Chib nickte schweigend, dann meinte er:
»Hören Sie, ich rate Ihnen, sich das noch einmal zu überlegen. Bis heute Abend. Und rufen Sie mich dann an.«
»Ich bin nicht hier, um Ihren Rat einzuholen, Monsieur Moreno«, entgegnete sie und betonte jede Silbe einzeln, »sondern um Sie zu bitten, das zu tun, wofür man Sie gewöhnlich bezahlt, und zwar gut, wenn ich recht informiert bin.«
Wie konnte sie es wagen, in diesem Ton mit ihm zu sprechen? Sollte sie ihre Tochter doch einäschern lassen! Er erhob sich mit der Absicht, ihr ein »Ich bin nicht ihr Diener« an den Kopf zu knallen, doch es kam nur ein äußerst höfliches »Ich bin nicht sicher, Ihren Auftrag annehmen zu können« aus seinem heuchlerischen Munde.
Sie tauchte ihre großen grauen Augen in die seinen, er sah die kleinen Fältchen, die dunklen Ringe unter der leichten Tönungscreme, das kaum merkliche Zittern ihrer Lippen, die Ader, die an ihrer Schläfe pochte.
»Bitte«, sagte sie. »Bitte.«
Er seufzte, den Blick auf den Oleander geheftet, dessen Blüten in der Sonne leuchteten.
»Wann kann ich bei Ihnen vorbeikommen?«
»Kommen Sie um zwei Uhr. Wir erwarten Sie.«
Die Straße schlängelte sich den Hang hinauf – Düfte von Harz, Lavendel und wildem Jasmin.
Zweimal musste er seine Notizen zu Rate ziehen: nach dem Transformatorenhaus rechts abbiegen, dann die Erste links. Okay. Er schaltete in den zweiten Gang herunter, und die Reifen knirschten auf dem Kies. Er hatte das Verdeck geöffnet und bot sein Gesicht dem Wind und der Aprilsonne dar.
Die Straße jetzt an einer alten efeubewachsenen Steinmauer entlang. Ein verrostetes Tor kam in Sicht, daneben ein brandneuer Briefkasten aus Edelstahl und ein automatisches Codeschloss.
Er bremste, beugte sich heraus, um zu lesen. Auf dem Briefkasten ein einfaches Plastikschild: »Andrieu de Glatigny«. Hm, hm. Adlige. Wenig geneigt, ihre Herkunft zur Schau zu stellen. Er schaltete den Motor ab, stieg aus und streckte sich seufzend. Und weil es sein musste, drückte er auf den kupfernen Klingelknopf.
Er wartete. Blätterrauschen. Der Wind war frischer geworden. In der Ferne war der dumpfe Rhythmus eines Baggers zu hören. Er sah auf die Uhr: 13 Uhr 57.
Quietschend öffnete sich das Tor, und vor ihm stand eine junge Araberin, das lange schwarze Haar zu einem Knoten gebunden. Sie trug ein geblümtes ärmelloses Kleid, darüber eine blaue Schürze.
»Monsieur Moreno?«, fragte sie und kniff die Augen zusammen.
»Ja. Ich habe einen Termin mit Madame Andrieu de Glatigny«, sagte Chib.
»Lassen Sie das Glatigny weg, sie legen keinen Wert drauf.«
Das Mädchen trat zur Seite, um ihn hereinzulassen.
»Sie werden im Wintergarten erwartet«, erklärte sie. »Wenn Sie bitte mitkommen wollen.«
»Wohnen Sie hier?«, fragte Chib und folgte ihr den von blühendem Hibiskus gesäumten Weg.
»Ich gehöre nicht zur Familie, wenn es das ist, was Sie wissen wollen«, entgegnete sie. »Ich heiße Aïcha, ich bin das Dienstmädchen.«
Eine ungestüme junge Stute, würde Greg sagen.
»Sind sie sympathisch?«, fragte er und wäre beinahe über eine Wurzel gestolpert.
»Schon okay. Sind Sie Arzt?«
»Nein, warum?«
»Oh! Ich dachte, Sie kämen ihretwegen, es geht ihr so schlecht!«
»Wem?«
»Madame Andrieu! Sie ist völlig kopflos und stopft sich mit Beruhigungsmitteln voll. Es ist schrecklich, das mit der Kleinen …«
Ihre Stimme versagte.
»Sie haben sie gern gehabt?«, wollte Chib wissen.
Sie schnellte so heftig herum, dass er sie fast angerempelt hätte.
»Ich weiß nicht, ob ich sie gern hatte oder nicht, darum geht es auch gar nicht, aber sie war noch so klein, ich hätte nicht gedacht, dass ein Kind so sterben kann …«
»Sie hatten wohl auch einen Schock …«
Aïcha knackte mit den Fingergelenken.
»Ich habe sie gefunden. Am Fuß der Treppe. Ich dachte, sie wäre ohnmächtig, ich wollte sie hochheben, aber ihr Kopf …
ihr Kopf … er hat sich gedreht, so, von vorne nach hinten …
ach, verdammt!«
Ihr wurde übel, sie beugte sich vor und übergab sich. Chib hätte am liebsten die Flucht ergriffen.
Er blickte auf und sah das Haus. Ein Landhaus aus dem achtzehnten Jahrhundert, aus dem weißen Stein von Les Beaux errichtet.
An den rechten Gebäudeflügel grenzte ein Garten im italienischen Stil. Hinter einem uralten Eukalyptus sah man das Hellblau des Swimmingpools durchschimmern.
Schmiedeeiserne Gartenmöbel vor den großen Terrassentüren. Ein Kinderfahrrad auf den Terracottafliesen. Ein Schaukelgerüst im Schatten einer Pinie. Im Hof, der mit Kies bedeckt war, zwei nebeneinander geparkte Wagen, ein bordeaufarbenes Chrysler-Sebring-Cabrio und der neue Jaguar Typ X, metallic-grau. Er strich bewundernd über die Karosserie. Aïcha hatte sich wieder gefasst und führte ihn zu einem achteckigen Pavillon neben dem linken Gebäudeflügel.
Sie stieß die Tür auf und verkündete:
»Monsieur Moreno.«
Vor einem Vorhang aus Riesenbambus saß Blanche Andrieu de Glatigny auf einem wassergrünen japanischen Stuhl; gegenüber zwei weitere Stühle und ein runder Tisch, darauf ein Teeservice aus dunklem Ton mit drei winzigen, dazu passenden Tassen. Ringsum standen Riesenkakteen und die verschiedensten tropischen Pflanzen. Eine Fülle von Farben und Düften, die, verstärkt durch eine Wand, über die Wasser rieselte, den Eindruck eines Miniaturdschungels vermittelten.
Aïcha verschwand, noch bevor die Herrin des Hauses ein Wort gesagt hatte. Die Hände in den Taschen vergraben, blieb Chib stehen.
»Setzen Sie sich«, sagte sie unvermittelt mit ihrer außergewöhnlichen Stimme. »Mein Mann wird gleich da sein.«
Er nahm auf dem Stuhl Platz, den sie ihm gewiesen hatte, und strich über seine glatte gebogene Armlehne.
»Grüner Tee«, kündigte sie an und füllte seine Puppentasse. Ihre Augen waren grau und ebenso undurchsichtig wie ein gefrorener See.
Er nickte schweigend. Es roch nach nasser Erde, an den Fenstern blühten Azaleen in flammenden Farben.
Das Geräusch von gedämpften Schritten. Chib wandte sich ein Stück um. Jean-Hugues stand neben ihm. Ein Meter fünfundachtzig, flacher Bauch, breite Schultern, blondes, gut geschnittenes Haar, marineblauer Anzug von Daniel Cremieux, hellgraues Hemd, Krawatte aus geflochtener Seide von Vuitton, schwarze glänzend geputzte Berluti, glatt rasiertes, klassisch schönes Gesicht. Kein Schmuck außer dem Ehering und der Moon Watch von Omega am linken Handgelenk. Chib trug seine Reverso Gran’ Sport am rechten Handgelenk. Eine Gewohnheit aus seiner Kindheit.
Er stand auf, schüttelte die ihm entgegengestreckte Hand. Eine kräftige Hand, frisch manikürt.
»Meine Frau hat mir von Ihrer Begegnung berichtet.« Elegante Stimme. Leichter Bariton.
»Ich denke, Sie haben Ihren Preis schon festgelegt«, fügte er wie selbstverständlich hinzu.
Leicht aus der Fassung gebracht, nannte Chib die übliche Summe.
»Gräfin di Fazio hat uns viel Gutes von Ihrer Arbeit erzählt«, fuhr Andrieu fort, als ginge es um die Einrichtung einer neuen Küche. »Ich lege großen Wert auf Qualität.«
Ja, und du hast mit Sicherheit auch viel Erfahrung im Einbalsamieren kleiner Mädchen, dachte Chib und riss sich zusammen, um keine Grimasse zu schneiden. Andrieu gefiel ihm nicht. Zu sauber. Zu gut gekleidet. Eine zu normale Stimme, männlich, ohne vulgär zu sein, distinguiert, ohne schwul zu wirken. Ein perfekter Typ. Passend zu seiner makellosen Frau. Ein perfektes Sitcom-Paar.
»Wenn Sie mir bitte folgen möchten«, sagte Andrieu. »Wir gehen in die Kapelle. Madame wartet hier auf uns.«
Madame gab keinen Ton von sich und trank ihren Tee in Schlucken so winzig wie ihre Tasse.
Sie traten in den Garten, der in strahlendes Licht getaucht war, gingen unter einer blühenden Glyzinie und gelangten zu einer kleinen, im romanischen Stil erbauten Steinkapelle mit einer Tür aus gehämmertem Metall, die Mister Perfect aufstieß. Die Tür quietschte nicht. Nicht eine Fledermaus flatterte auf.
Im Innern der Kapelle war es dunkel und kühl. Tonnengewölbe, das einzige Schiff mit bunten Glasfenstern versehen, die auf naive Art Christi Leidensweg darstellten, ein paar Bankreihen aus unlängst gewachstem Nussbaumholz, ein Altar, beherrscht von einem lebensgroßen Kruzifix, an dem ein schöner Christus aus Olivenholz Tränen vergoss, Chorgestühl entlang der Seitenwände, ein Heiliger Franz von Assisi aus bunt bemaltem Holz, mehrere leere Nischen, die kleine Standbilder oder Kultgegenstände beherbergt haben mussten, an den Wänden alte Standarten mit Wappen und goldenen Aufschriften in lateinischer Sprache. Die unebenen, teils gesprungenen Terrakottafliesen zeugten vom Alter des Bauwerks. Vor dem Altar war das Gerüst aufgebaut. Und auf dem Gerüst ruhte eine kleine Gestalt, bedeckt mit einem weißen Tuch.
Chib holte tief Luft, als Jean-Hugues Andrieu, die Züge angespannt, das Tuch mit einer brüsken Bewegung zurückschlug. »Meine Tochter Elilou«, sagte er und wandte sich ab.
Die Kleine wirkte nicht wie schlafend. Sie sah tot aus. Die Haut bläulich marmoriert, Wangen und Nasenflügel eingefallen. Ihr langes Haar, derselbe Blondton wie der ihres Vaters, war sorgfältig gebürstet und mit einem roten Samtband versehen. Er sah die kleinen über der Brust gefalteten Hände, die bläulichen Nägel. Sie trug ein weißes Organdykleid und schwarze Lackschuhe mit Riemen.
Chib war beklommen zumute. Er liebte die Toten, liebte seine Arbeit an ihnen. Aber dies hier war einfach zu traurig.
Doch es war unmöglich, einen Rückzieher zu machen, unmöglich, diese Menschen noch mehr zu quälen, indem er ablehnte.
»Sie muss in mein Atelier gebracht werden«, sagte er schließlich.
»Atelier«, ein neutrales Wort, um an eine neutrale Tätigkeit denken zu lassen.
»Wann?«, fragte Andrieu.
»Möglichst heute noch. Die Zeit ist wichtig.«
»Ich weiß«, fiel ihm Andrieu ins Wort. »Und noch etwas: Ich will nichts von dem hören, was Sie tun, die Einzelheiten sind mir völlig gleichgültig, ich lehne es strikt ab, von Ihnen Details zu erfahren, ist das klar?«
»Absolut klar. Können Sie veranlassen, dass sie am späten Nachmittag bei mir abgeliefert wird? Hier ist die Nummer eines Transportspezialisten.«
Andrieu nahm die Karte entgegen, die er ihm hinhielt, als handelte es sich um die Nummer für Telefonsex.
»Sehr gut. Ich kümmere mich sofort darum.«
Er steuerte auf die Tür zu, und Chib folgte ihm, den Blick auf die alten Terrakottafliesen gerichtet.
Als sie draußen waren, schlug Andrieu ihm nicht vor, sich von seiner Frau zu verabschieden. Er nahm das Walkie-Talkie, das er am Kroko-Gürtel trug, und rief:
»Aïcha, können Sie bitte Monsieur Moreno begleiten?« Aïcha tauchte augenblicklich auf und strich ihr Kleid glatt. »Meine Frau wird Sie morgen anrufen«, sagte Andrieu und drückte Chib die Hand. »Danke, dass Sie gekommen sind.« Sprach’s und verschwand im Kakteen-Pavillon.
Chib folgte Aïcha zum Tor. Sie war gut gebaut, knackiger Hintern, herausfordernder Busen. Ob sie der brave Familienvater aufs Kreuz legte?, fragte er sich flüchtig. Als hätte sie seine Gedanken erraten, drehte sie sich um:
»Monsieur macht sich große Sorgen um Madame. Er fürchtet einen Rückfall …«
»Was für einen Rückfall?«
»Nach dem Tod ihres ersten Kindes wurde sie schwer depressiv. Wissen Sie, der Kleine, der im Pool ertrunken ist. Sie war mehrere Monate lang in Behandlung.«
»Sie scheinen sehr aneinander zu hängen«, sagte Chib ins Blaue hinein.
»Ja, sie streiten sich nie. Ich persönlich würde das langweilig finden, aber gut, jeder nach seiner Façon …«
»Er gefällt sicher den Frauen, groß, blond und kräftig gebaut, wie er ist …«
Wie Greg. Sie lachte, ein kleines perlendes Lachen.
»Sind Sie neidisch? Also mich machen blonde Männer nicht an. Ich hab eine Schwäche für die großen brünetten Behaarten, die gefährlich aussehen«, fügte sie hinzu, als sie das Tor öffnete.
Er setzte eine düstere Miene auf und ließ seine Bizepse spielen.
»Tut mir Leid, aber Sie sind einfach nicht aggressiv genug«
»Ach, ja? Wie schätzen Sie mich denn ein? Keine Angst, sagen Sie’s nur, ich lache gern.«
»Na ja, Sie sind eher von der Sorte klein und süß …«
»Halt, hören Sie auf!«, protestierte er und stieg in seinen Floride. »Sie werden meinen Selbstmord zu verantworten haben«, rief er noch, als schon der Motor lief und sie lachend das Tor schloss.
Und dann schämte er sich, blöde Witze gemacht zu haben, während in der Nähe ein totes Mädchen lag, und hätte um Haaresbreite die Abzweigung verpasst.
»Klein und süß!« Ein hübscher kleiner schwarzer GI, Miniaturausgabe seiner Papas. Ein kleiner schwarzer GI für Blanche. Mist, warum hatte er das gedacht? Sie gefiel ihm nicht einmal. Aïcha war hundertmal attraktiver.
Zurück in seinem Atelier, bereitete er sein Material vor und schob Signor di Fazio in ein Kühlfach. Auf seinem Anrufbeantworter war eine Nachricht von Greg, der ihm mitteilte, dass er Pam und Sophie flachgelegt hätte. »Super, muy caliente, du hättest bleiben sollen.« Und dass sie nach Monaco fahren würden, um im Hotel de Paris zu frühstücken.
Er löschte die Nachricht und fragte sich, was Greg wohl zu Blanche Andrieu sagen würde. »Dringend auftauen!«, wäre wohl die harmloseste Variante. Nur dass eine Frau, die trauert – die schlimmste Trauer, die um ihr eigenes Kind –, gewiss nicht wie sonst handeln würde.
Gut, genug von Blanche Andrieu. In wenigen Stunden würde ihre kleine Tochter hier liegen und sein Messer in ihr bleiches Fleisch eindringen. Er holte tief Luft und nahm die Meditationshaltung ein. Ein wenig innere Leere wäre gut.
Doch an die Stelle der Leere traten plötzlich Schreie. Der Schrei der kleinen Elilou, die über die Rampe fällt. Der Schrei von Aïcha, als sie den leblosen Körper entdeckt. »Madame, Madame, kommen Sie schnell, es ist schrecklich!« Die Schreie von Blanche Andrieu, rau, fast wie das Brüllen eines Tiers, und das blasse Gesicht von Jean-Hugues Andrieu, versteinert, ein Glas frisch gepressten Orangensaft in der Hand. Das Hämmern der Absätze auf den Fliesen, die Sirene in der Ferne, das Jammern der anderen Kinder, die in ihr Zimmer gebracht werden, schnell. »Aïcha, helfen Sie mir.«
Er befahl den Andrieus, aus seinem Kopf zu verschwinden mit ihren Dramen, ihrem Kummer, ihren Schreien. Doch sie weigerten sich, setzten sich fest, pressten sich stöhnend an die Decke seines Schädels, und er musste lange eiskalt duschen, um sie zu vertreiben.
Als die Türglocke ertönte, war er bereit. Die Instrumente waren aufgereiht. Die Stereoanlage war eingeschaltet, der CD-Player angestellt, Tom Waits bereit zu singen Cold was the night, hard was the ground. Lucas und Michel traten ein und ärgerten einander mal wieder. Die beiden Männer erinnerten ihn immer an Laurel und Hardy. Lucas, ein glatzköpfiger Koloss, stand kurz vor der Pensionierung. Michel, ein kleiner kesser Rotschopf wog kaum mehr als sechzig Kilo. Um ihr Gehalt ein bisschen aufzubessern, machten sie Überstunden und liehen sich den Leichenwagen ihres Chefs. Lucas hatte ständig Rückenschmerzen, und Michel trank zu viel, sein Arzt hatte ihn schon gewarnt.
»Sollen wir ihn wie immer abstellen?«, erkundigte sich Lucas, der den kleinen plombierten Sarg unter seinen gewaltigen Arm geklemmt hatte wie einen großen Koffer.
»Hier die kleine Rechnung!«, rief Michel und nahm seine Schirmmütze ab. »Haben Sie was zu trinken? Ich krepiere vor Durst!«
Er bot ihnen zwei gut gekühlte Bier an, zahlte sie in bar aus und schloss erleichtert die Tür, denn er hatte es plötzlich eilig, sich an die Arbeit zu machen. Erneutes Klingeln an der Tür. Es war Pageot, der Beamte von der Bestattungspolizei, ein blonder Lulatsch. Kraft Artikel R 363.1 ff./soundso der Kommunalverfassung war er angewiesen, bei jedem Eingriff zugegen zu sein. Chib stellte fest, dass er noch erschöpfter wirkte als gewöhnlich. Pageot verbrachte all seine freien Stunden und Nächte damit, ein Segelboot zu bauen, sein Segelboot, mit dem er auf Weltreise gehen wollte, weit weg von Toten und Formalingeruch. Chib reichte ihm ein Muster von der Mischung, die er verwenden würde, und einen Umschlag mit dem vereinbarten Betrag. Pageot grauste es davor, Chibs Arbeit beizuwohnen. Er hob zwei Finger an seine blonden Haare, dankte ihm und nutzte seine drei Stunden der verheimlichten Freiheit, um an seinem geliebten Boot zu arbeiten.
Beim Anblick des kleinen wächsernen Gesichts empfand er, wie schon in der Kapelle, ein Gefühl des Widerwillens. Man hätte meinen können, da läge ein kleiner schlafender Vampir, die Wangen eingefallen, das Haar sorgsam gekämmt, die kleinen Wimpern gesenkt, die Hände, vor allem die Hände, diese kleinen, über der mageren Brust gefalteten Hände und die winzigen Nägel mit dem transparenten Lack.
Sie fing schon an zu riechen. Nur ein wenig, aber unverkennbar, dieser so typische Geruch der Toten.
Er hob den Kopf, sprühte sich eine aromatische Mischung auf der Basis von Kiefernnadeln und Lavendel in die Nase, seufzte. El Ayache wäre nicht zufrieden mit ihm gewesen.
Gut, er musste erst den Körper entkleiden. Er nahm die Hände, kalt und trocken, auseinander und begann, das weiße Kleidchen aufzuknöpfen, das unter seinen Fingern raschelte. Ein Knopf gab nach und blieb in seiner Hand liegen. Er legte ihn neben das Spülbecken, zog die Kleine ganz aus, griff dann nach der großen Sonde, die er ihr in den Magen legen würde, um Wasser und die verschiedenen Körperflüssigkeiten abzuleiten.
Eine große Narbe verlief von der Hüfte bis zum linken Knie. Er tastete sie mit den Fingerkuppen ab. Eine frühere Fraktur. An der rechten Fessel eine weitere Narbe.
Irritiert drehte er das Mädchen auf den Bauch. Bläulichrote Flecken, die auf die Lage beim Tod zurückzuführen waren, daneben Hämatome, die zweifellos von dem Sturz herrührten. Noch eine Narbe an der linken Schulter. Er hob das lange Haar hoch und entdeckte das gebrochene Genick: keine äußeren Zeichen. Er drehte das Kind wieder auf den Rücken.
Eine ausgeprägte Neigung zu Unfällen, wie sie bei einem kleinen Mädchen selten vorkommt. War sie gestorben, weil ihre Spiele wieder einmal zu halsbrecherisch gewesen waren, diesmal leider im wahrsten Sinne des Wortes?
Die ersten Klänge von Take the A Train von seinem Handy ließen ihn fast zusammenzucken. Er legte die Sonde beiseite und hob nervös ab.
»Hallo, bin ich mit dem König der Schornsteinfeger verbunden?«
Greg.
»Was willst du? Ich bin bei der Arbeit.«
»Hör auf, du bringst mich noch zum Heulen! Was hältst du von einem kleinen Abendessen beim Inder?«
»Mit wem?«
»Ein Tête-à-tête, nur du und ich, ha, ha, ha.«
»Ich dachte, du wärst in Monaco mit …«
»Vergiss es, die beiden Landpomeranzen sind mit zwei italienischen Motorradfahrern auf und davon.«
»Um ehrlich zu sein, ich bin ziemlich kaputt.«
»Scheiße, Mensch, du bist immer kaputt. Scheint eine Berufskrankheit zu sein …«
»Gut, okay, also gegen acht Uhr.«
»Im Taj. Und bitte komm nicht wieder als Totengräber verkleidet. Im Taj gibt es immer ein paar hübsche Drachenköpfe …«
Und schon wieder saß er in der Falle. Du hast keine Selbstachtung. Du nimmst immer die Opferrolle ein. Wehre dich endlich. Such dir ein Mädchen, führ ein normales Leben, weit weg von Gregs vulgärer Welt.
Ein normales Leben, höhnte er, und stieß die feine Stahlspitze in den Bauch, was sollte das bitte sein, ein normales Leben? Kann einer, der den ganzen Tag mit Leichen arbeitet, ein normales Leben führen? Die Gesellschaft der Lebenden ist mir zu laut, das ist das Problem. Ein Aspekt des Problems.
Gut. Und jetzt die Großreinigung. Da das Kind durch den Sturz sicher eine Schädelverletzung erlitten hatte, klammerte er vorsichtig die linke Halsschlagader ab, um über die rechte injizieren zu können. Anschließend würde er über dieselbe rechte Ader das Formaldehyd einspritzen, um die linke Kopfhälfte zu behandeln und damit das hässliche Anschwellen des Gewebes um die Augen zu vermeiden. Dann machte er einen Schnitt in die Drosselvene, über die die Organflüssigkeiten abfließen würden. Das war der Augenblick, in dem der Austausch stattfand. Blut gegen Formalin. Neue Sonde; diesmal führte die durch einen langen Gummischlauch mit der Balsamierungsflüssigkeit in einem Spezialbehältnis verbundene Sonde in die Halsschlagader. Der unsinnige Eindruck entstand, ein eigentümliches Fahrzeug vollzutanken. Chib legte den Zeigefinger auf den Startknopf des Kompressors, hielt jedoch plötzlich inne. Er hatte den unangenehmen Eindruck gehabt, dass die Kleine die Lider bewegt hatte. Lächerlich. Das arme Mädchen war nichts weiter als ein Haufen kaltes, starres Fleisch. Er drückte auf den Knopf. Der Apparat sprang mit dem vertrauten Vibrieren an und trieb die Balsamierungsflüssigkeit in die Halsschlagader, damit sie sich im Kreislaufsystem verbreiten und das Blut verdrängen konnte, das aus der geöffneten Vene in den für diese Zwecke angebrachten Drain zu tropfen begann. Gut. Er setzte das Skalpell an, klappte vorsichtig die Ränder des etwa zehn Zentimeter langen Schnittes auf, durch den er Leber, Lunge, Magen und Gedärme entfernen, sie dann waschen und in die Kanopen, die geweihten Krüge, geben würde. Obwohl es bei der Injektion von Formaldehyd eigentlich überflüssig war, zog er es vor, nach der herkömmlichen Methode vorzugehen, Ritual und Moderne zu vermischen …
Er arbeitete noch eine halbe Stunde und legte dann die Instrumente beiseite. Er war nicht richtig konzentriert, ihm fehlte das entsprechende Feeling. Er holte tief Luft, atmete kräftig aus, machte ein paar Dehnübungen. Die Nervosität lief durch seine Finger wie ein elektrischer Schauer. Kein guter Zustand für die Arbeit. Was brachte ihn so aus dem Gleichgewicht?
Er nahm die Anubis-Stellung ein und begann die zweiundsiebzig Strophen der Wächter der Geheimnisse, murmelte sie im Gleichklang mit seiner bewusst verlangsamten Atmung.
Telefon.
Mist!
»Hier ist Blanche Andrieu.«
»Ja bitte?«
»Ich wollte nur wissen, ob … ob alles gut verläuft …«
Super gut, Madame, der Sarotti-Mohr hat alles zerlegt, no problem!
»Ich habe eben erst angefangen, aber ich sehe keine Schwierigkeiten. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen.«
»Ich mache mir keine Sorgen, aber es ist einfach so, dass … Ich wollte sagen …«
»Blanche? Bist du da, Chérie?«
»Entschuldigen Sie, ich werde gerufen.«
Klack. Entlassen, der Mohr hat seine Schuldigkeit getan. Er knallte den Hörer etwas zu heftig auf die Gabel. Er hätte den Auftrag nicht annehmen dürfen. Wie bei Greg. Wie jeden Tag in seinem Leben.
Er öffnete die Tür seines Mini-Eisschranks und nahm einen kräftigen Schluck aus dem Krug mit Pfefferminztee und wandte sich erneut Elilou zu. Sie sah erbärmlich aus, nackt, die Rippen vorstehend, mit dieser riesigen Nadel im Hals. Ein albtraumhaftes Bild, das nichts mit der üblichen Erhabenheit der Verstorbenen zu tun hatte.
Plötzlich bemerkte er, dass ein Formular auf den Boden gefallen war. Er hob es auf. Es war der Totenschein. Unterzeichnet von Dr. Gérard Cordier. »Fraktur der Halswirbel als Folge eines Sturzes auf der Treppe des elterlichen Hauses.« Drei kleine Knochen. Deren Bruch tödlich war … Ja, wirklich halsbrecherisch, die kleine Elilou, wiederholte er bitter.
Zwei Minuten später überraschte er sich dabei, wie er die Nummer von Dr. Cordier wählte. Seine Finger in dem schmutzigen Latexhandschuh drückten kräftig auf die Tasten.
Mit bewegter Stimme teilte ihm dessen Sekretärin mit, dass, oh, was habe er für ein Glück, soeben ein Patient abgesagt habe und der Doktor – verzückte, zitternde Stimme – ihn in einer Stunde empfangen könne. Chib bedankte sich herzlich und machte sich, sonderbar erleichtert, wieder an die Arbeit.
Er verbrachte eine halbe Stunde in dem weiß und grau gehaltenen Wartezimmer des Arztes zwischen einem Koloss, der sich alle zwei Minuten schnäuzte, und einer Frau im Trainingsanzug mit abgespanntem Gesicht. Er blätterte verschiedene Zeitschriften durch, die auf dem niedrigen Glastisch lagen. Le Revenu, Valeurs Actuelles/Capital, La Croix, Maisons et Jardins … Er war eben dabei, sich zu fragen, ob er seinen Loft orangerot streichen sollte, als die Tür aufging und ein bärtiger Fünfzigjähriger in weißem Kittel auf der Schwelle erschien und ihn bat einzutreten.
Das Sprechzimmer war genauso nüchtern eingerichtet wie das Wartezimmer. Zwei Reproduktionen von Kandinsky an der linken Wand, eine von Chagall an der rechten, ein Schreibtisch aus Glas und Chrom, darauf nur ein Notizblock und ein Mont-Blanc-Kugelschreiber.
»Setzen Sie sich. Was führt Sie her?«
»Schmerzen in der rechten Hand, sie wird leicht steif. Madame Andrieu hat mir Ihre Adresse gegeben«, fügte er hinzu und gab vor, den Chagall zu bewundern, obwohl ihm die Malkunst völlig gleichgültig war.
»Blanche?«, sagte Dr. Cordier und zog eine graue Braue hoch. »Sie kennen die Andrieus?«, fuhr er fort, griff nach Chibs Handgelenk und ließ es vorsichtig kreisen.
»Ich hatte unlängst Gelegenheit, ihre Bekanntschaft zu machen. Mit diesem Drama …«
»Ach, Sie wissen davon. Schrecklich, nicht wahr, wie das Schicksal einem doch übel mitspielen kann! Heben Sie den Arm, so … Tut das weh?«
»Ein bisschen. Wissen Sie, ich bin Präparator, ich werde die Konservierung vornehmen. Ich brauche übrigens Ihre Unterschrift unter das gerichtsmedizinische Gutachten.«
»Kein Problem. Ich möchte nicht mit Ihnen tauschen. Mein Job ist schon nicht besonders lustig, aber Ihrer … Tief einatmen, bitte.«
»Ja, grausam, solche Sachen. Und die Eltern werfen sich bestimmt jeden Tag vor, nicht genug aufgepasst zu haben.«
»Hm. Ein Sturz auf der Treppe … ich wüsste nicht, wie sie das hätten verhindern können, außer ihr zu verbieten zu leben!«
»Bei besonders wilden Kindern muss man immer auf der Hut sein, das ist anstrengend.«
»Nun, Elilou war nicht besonders wild. Das war nicht ihr Tag, das ist alles. Gut, wir werden eine Röntgenaufnahme machen, für alle Fälle.«
»Ich bin letztes Jahr beim Skifahren gestürzt, ich hatte zwei Wochen Schmerzen. Meinen Sie, es könnte sich um einen Bruch handeln, den man nicht erkannt hat?«
»Wohl kaum. Einen Bruch hätten Sie bemerkt. Eher eine Verrenkung.«
Kurz darauf verließ er die Praxis mit dem gegengezeichneten Zertifikat, das bestätigte, dass Elilou keine schwere ansteckende Krankheit gehabt hatte, die ein Verbot seiner Arbeit an der Toten bedeutet hätte. Sein Besuch war also nicht völlig sinnlos gewesen.
Die Terrasse des Taj war überfüllt. Greg, der natürlich am besten Tisch saß, nippte an seinem Whisky und lächelte in die Runde. Er winkte den eintretenden Chib herbei, als bestünde die Gefahr, dass er anderswo Platz nähme.
Kaum saß er, drückte Greg ihm schon die Menükarte in die Hand, »Ich sterbe vor Hunger«, kritisierte sein graues Hemd: »Sieht aus, als käme es von Woolworth«, und meckerte, dass er keinen Aperitif nehmen wollte. Chib überhörte das alles und vertiefte sich in die Karte, während Greg sich ausgiebig über ihre Nachbarinnen ausließ.
»Ich nehme das Prawn Tadori«, beschloss Chib.
Er hatte eine Vorliebe für kräftig gewürzte Garnelen. Greg entschied sich für ein Biryani »da hat man wenigstens was auf dem Teller«, bestellte eine Flasche Châteauneuf-du-Pape und verlangte nach Chips und Oliven. Der Kellner nickte höflich, den Blick auf einen Punkt in der Ferne gerichtet.
Peinlich berührt, wie jedes Mal, wenn Greg seine Nummer abzog, schaute Chib auf den Spiegel in der Ecke. Ein schwarzer Haarschopf in einer benachbarten Nische lenkte seinen Blick auf sich. Eine braune, feingliedrige Hand mit einem blauen Halbedelstein am Finger, ein Adlerprofil, ein Lachen, Aïcha!
Von ihrem Begleiter, der ihr gegenüber saß, sah er nur einen grauen Haarkranz und die Schultern, die in einem Jeanshemd steckten. Ihr Vater?
»Sag mal, träumst du oder was?«
»Entschuldige.«
»Hier, probier mal den Châteauneuf, der schmeckt prima.«
»Köstlich.«
»Du bringst mich echt auf die Palme, Chib! Man könnte dich für einen Pfarrerssohn halten! Hm … ich wollte sagen … Willst du nichts von dem Naan? Iss, du bist viel zu dünn!«
Chib kaute auf seinem Naan herum und versuchte dabei, einen Blick auf das Gesicht des Mannes zu erhaschen, der an Aïchas Tisch aß. Sie schien sich nicht sonderlich zu amüsieren, nickte häufig, schaute nach rechts und nach links, trank Rose in kleinen Schlucken, lächelte bisweilen höflich.
Ein Langweiler – sie bereute längst, seine Einladung angenommen zu haben, sagte sich Chib und nahm seine Tandoori-Garnelen in Angriff, während Greg ihm lang und breit den letzten Klatsch der Stadt erzählte. Wusste er schon, dass Laeticia, die junge Frau von Notar Seems, ihren Mann mit Joël, dem Heilpraktiker, betrog?
»Hm.«