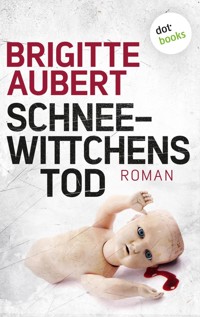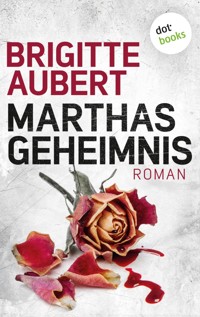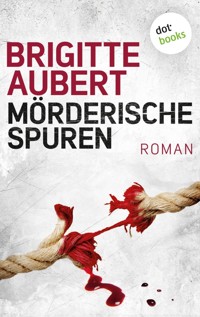
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Detektiv, der für seine Klientin durch die Hölle geht: Der fesselnde Thriller "Mörderische Spuren" von Brigitte Aubert als eBook bei dotbooks. Privatdetektiv Dag Leroy erhält einen neuen Auftrag: Die schöne Charlotte will, dass er ihren Vater findet, der noch vor ihrer Geburt von der Bildfläche verschwand. Auch ihre Mutter Lorraine ist tot – sie erhängte sich, als Charlotte noch ein kleines Mädchen war. Dag steht vor scheinbar unüberwindlichen Hürden: Nicht mal der Name des Mannes ist bekannt. Während er beginnt, das Rätsel um Charlottes Herkunft zu lösen, mehren sich die Hinweise, dass Lorraine nicht freiwillig aus dem Leben schied. Doch wer hätte ein Interesse daran haben können, die unschuldige junge Mutter zu ermorden? Dag kommt einem Komplott aus Macht und Gier auf die Spur, das sogar dem hart gesottenen Detektiv den Atem raubt … Jetzt als eBook kaufen und genießen: "Mörderische Spuren" von Brigitte Aubert. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 500
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Über dieses Buch:
Privatdetektiv Dag Leroy erhält einen neuen Auftrag: Die schöne Charlotte will, dass er ihren Vater findet, der noch vor ihrer Geburt von der Bildfläche verschwand. Auch ihre Mutter Lorraine ist tot – sie erhängte sich, als Charlotte noch ein kleines Mädchen war. Dag steht vor scheinbar unüberwindlichen Hürden: Nicht mal der Name des Mannes ist bekannt. Während er beginnt, das Rätsel um Charlottes Herkunft zu lösen, mehren sich die Hinweise, dass Lorraine nicht freiwillig aus dem Leben schied. Doch wer hätte ein Interesse daran haben können, die unschuldige junge Mutter zu ermorden? Dag kommt einem Komplott aus Macht und Gier auf die Spur, das sogar dem hart gesottenen Detektiv den Atem raubt …
Über die Autorin:
Brigitte Aubert gehört zu Frankreichs profiliertesten Spannungsautorinnen. Neben Kriminalromanen und Thrillern schreibt sie Drehbücher und war Fernsehproduzentin der erfolgreichen »Série noire«. 1996 erhielt sie den französischen Krimipreis. Heute lebt sie in Cannes und führt ein altes Kino, das sie von ihren Eltern übernommen hat.
Bei dotbooks erscheinen auch:
Die vier Söhne des Doktor March
Marthas Geheimnis
Sein anderes Gesicht
Schneewittchens Tod
Der Puppendoktor
Nachtlokal
Im Dunkel der Wälder
Tod im Schnee
***
eBook-Neuausgabe Mai 2018
Dieses Buch erschien bereits 1999 unter dem Titel Karibisches Requiem im Wilhelm Goldmann Verlag.
Copyright © der französischen Originalausgabe 1997 by Éditions du Seuil
Die französische Originalausgabe erschien 1997 unter dem Titel Requiem Caraïbe bei Edition du Seuil, Paris.
Copyright © der deutschen Ausgabe 1999 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Bertelsmann GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2018 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Pics five
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (sh)
ISBN 978-3-96148-249-8
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Mörderische Spuren an: [email protected]
Gerne informieren wir Sie über unsere aktuellen Neuerscheinungen und attraktive Preisaktionen – melden Sie sich einfach für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Brigitte Aubert
Mörderische Spuren
Roman
Aus dem Französischen von Gabrielle und Georges Hausemer
dotbooks.
Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Stöhnend klage ich, aber Hilfe bleibt fern.
»Mein Gott«, ruf ich bei Tag, doch du antwortest nicht,
auch in der Nacht,
und finde keine Ruhe.
Psalm 21
1. KAPITEL
Die junge Frau, die Dag gegenübersaß, trug ein eng anliegendes, wassergrünes Kleid, das die Farbe ihrer Augen hatte. Ihre grellrot lackierten Fingernägel hingegen hoben sich scharf von ihrer dunklen Haut ab. Mit verächtlichem Blick schaute sie sich um. Dag folgte ihrem Blick und stellte wieder einmal fest, daß die blaßgrünen Wände dringend einen neuen Anstrich benötigten und der klapprige Metallschrank demnächst seinen Dienst versagen würde. Die Klimaanlage hinter ihm rang surrend nach Luft. Dag beugte sich vor, um eine mit Wasser gefüllte Schüssel aus dem Fenster zu leeren. Dann stellte er sie erneut unter die undichte Stelle. Als er das angeekelte Naserümpfen der jungen Frau bemerkte, fühlte er sich zu einer Entschuldigung verpflichtet:
»Diese Klimaanlage ist fast so alt wie ich …«
»Und hat bereits ein Leck?«
Dag zwang sich zu einem Lächeln. Was bildete sich dieses wichtigtuerische Ding eigentlich ein? Glaubte sie etwa, er würde ihretwegen den Fußboden sauberlecken, nur weil sie wie ein Topmodel aussah? Er schaute ihr in die Augen: schöne grüne Augen, schmal wie die einer Katze.
»Ich nehme an, Sie sind nicht hergekommen, um sich mit mir über meine Klimaanlage zu unterhalten.«
»Ihr Scharfsinn ist wirklich umwerfend«, erwiderte sie und betrachtete ihre Fingernägel.
Dann fuhr sie ungeduldig fort:
»Ich bin zu Ihnen gekommen, weil ich jemanden wiederfinden möchte.«
»Um wen handelt es sich?« wollte Dag wissen und sann gleichzeitig darüber nach, ob die Wellen am späten Nachmittag wohl zum Surfen geeignet wären.
»Um meinen Vater«, antwortete die junge Frau mit ernster Miene.
Damit hatte Dag gerechnet. Nahezu dreißig Prozent der Fälle, um die er sich kümmerte, hatten mit Männern zu tun, die ihre Familien im Stich gelassen hatten. Leider blieben die meisten Nachforschungen ohne Erfolg. Diese Leute verstanden es großartig, auf Nimmerwiedersehen zu verschwinden.
»Haben Sie eine Ahnung, wo er sich aufhalten könnte?« fragte Dag ohne große Begeisterung.
»Nein, nicht die geringste. Ich weiß weder, wie er heißt, noch, wie er aussieht. Nachdem meine Mutter schwanger geworden war, ließ er nie wieder von sich hören.«
Das fing ja gut an. Dag vergegenwärtigte sich noch einmal die paar Informationen, die sie ihm gegeben hatte: sie hieß Charlotte Dumas und wohnte in Marigot, im französischen Teil der Insel Saint-Martin. Das Detektivbüro McGregor befand sich in Philipsburg, im holländischen Teil. Als die junge Frau das Büro betreten hatte, hatte Dag sie auf niederländisch gefragt, ob sie es vorziehen würde, das Gespräch auf englisch zu führen, und sie hatte auf englisch geantwortet, daß sie sich ebenso gerne auf französisch mit ihm unterhalten würde. »Falls Ihnen das nichts ausmacht«, hatte sie hinzugefügt und ihr Kleid zurechtgezupft. Nein, das war für Dag überhaupt kein Problem. Sein Vater, ein Cajun aus New Orleans, hatte eine karibische Schwarze aus Saint-Vincent geheiratet, und zusammen hatten sie sich auf der Insel La Désirade, auf französischem Territorium, niedergelassen.
»Nun, obwohl ich einen amerikanischen Paß besitze, war ich vor meinem achtzehnten Geburtstag nie in den USA«, hatte er ihr erklärt.
Sie hatte höflich gelächelt und gesagt:
»Wie aufregend …«
Dag war sich wie ein Idiot vorgekommen.
Er nahm ein weißes Platt Papier, seinen Lieblingsfüller – einen Parker mit breiter Feder – und schrieb: »Montag, 26. Juli«, während Charlotte ihn vorwurfsvoll anstarrte. War es eine gute Idee gewesen, hierherzukommen? Zwar genoß das Ermittlungsbüro McGregor einen ausgezeichneten Ruf, doch dieser Kerl entsprach kaum ihren Vorstellungen von einem Privatdetektiv: Er trug ein weites T-Shirt mit dem bunten Aufdruck Quick Silver, eine zerknitterte Leinenhose und dreckige Ranger-Schuhe. Zudem ließen seine vom Nacken bis zu den Schläfen geschorenen Haare und die auffälligen Tätowierungen an seinen kräftigen Vorderarmen ihn eher wie einen Ganoven aus der Bronx aussehen als einen zuverlässigen Detektiv.
Dag hob die Feder und fragte sich, warum sie ihn derart fixierte. Ohne übertriebene Freundlichkeit sah er sie an.
»Und wenn wir mit dem Anfang beginnen würden?«
Der Anfang, das war fünfundzwanzig Jahre vorher auf Sainte-Marie gewesen.
Dag seufzte innerlich. Wie viele Jahre waren seit seinem letzten Aufenthalt auf Sainte-Marie vergangen? Zwanzig? Fünfundzwanzig? Dennoch hätte er das Faltblatt des Tourismusbüros auswendig zitieren können. »… Eine gebirgige Insel mit paradiesischen Stränden, ein grün-weißer Diamant im karibischen Meer, etwa 50 Kilometer nordwestlich von Guadeloupe gelegen, 15 000 Einwohner auf 140 Quadratkilometern.« Sainte-Marie repräsentierte genau das, was in den Reiseführern als »karibische Vielfalt« bezeichnet wird. Er hörte, wie er sagte:
»Die Schwester meiner Mutter besaß einen Souvenirladen in Vieux-Fort. Als Kind verbrachte ich dort regelmäßig die Ferien.«
»Ich wurde dort geboren.«
Dag war auf La Désirade zur Welt gekommen, vor fünfundvierzig Jahren. Fünfundvierzig Jahre? Unmöglich, sein Ausweis mußte lügen. Er fühlte sich wie neugeboren.
»Ein eher unbedeutendes Kaff, dieses Vieux-Fort«, fügte Charlotte hinzu und verzog verächtlich den Mund.
Nun, Dag konnte sich nicht erinnern, in seiner Kindheit einen schöneren Ort gekannt zu haben als dieses kleine, verschlafene Dorf. Doch warum war er eigentlich nie wieder dorthin zurückgekehrt? Mit einem Mal erinnerte er sich an den aufsässigen Jugendlichen, der er gewesen war, und an die Verachtung, die er dann für dieses »Rattenloch« empfunden hatte. Nach dem Tod seines Vaters war er zum letzten Mal dort gewesen, um seine Tante zu besuchen. Sie war ihm als einzige Familienangehörige geblieben und hatte ihm weiterhin Briefe geschickt, die nach Veilchen dufteten und sorgfältig in Schönschrift auf kariertem Papier geschrieben waren. Zwei Jahre später hatte auch sie sich in eine bessere Welt verabschiedet. Man fand sie zusammengekrümmt hinter der Registrierkasse ihres Ladens, wo sie sich mit einer Hand an einem ausgestopften Leguan festhielt. Als Dag merkte, daß er gerade runde, starre Leguanaugen auf sein Papier kritzelte, tat er so, als würde er das Geschriebene unterstreichen.
»So, jetzt stehe ich voll und ganz zu Ihrer Verfügung«, sagte er munter.
Sie musterte ihn, als hätte er ihr etwas Unanständiges vorgeschlagen, und fuhr mit ihrer Erzählung fort:
Ihre Mutter Lorraine, eine Französin, hatte einen hohen Beamten aus Sainte-Marie geheiratet, einen pensionierten Postangestellten. Er war viel älter als sie, doch sehr reich, und sie lebten in einer prachtvollen Villa. Fast wie im Märchen. In jenem Jahr, 1970, herrschte zur Fastenzeit, von Dezember bis April, drückende Hitze auf der Insel. Lorraine verbrachte ihre Nachmittage allein am Strand und langweilte sich entsetzlich. Schließlich machte sie die Bekanntschaft eines Einheimischen. Die Kokospalmen von Folle Anse, die kleinen Buchten und der weiße Strand boten auf zehn Kilometern Länge etliche ruhige Plätzchen. Das Resultat: neun Monate und fünfzehn Tage später kam Charlotte zur Welt. Nachdem Lorraine ihr hübsches braunhäutiges Baby geboren hatte, wurde sie von ihrem Mann kurzerhand vor die Tür gesetzt. Da sie über kein persönliches Vermögen verfügte, mietete sie eine Baracke in der Nähe der Kleinstadt Vieux-Fort, wo sie fortan mehr schlecht als recht von dem wenigen Geld lebte, das sie gespart hatte. Sie begann unvernünftig viel zu trinken und erhängte sich schließlich auf ihrer Veranda. Das war im Herbst 1976, während der Regenzeit. Ende des Märchens.
Die kleine Charlotte, die damals fünf Jahr alt war – und von der der alte Pensionär nichts wissen wollte –, wurde in ein Nonnenheim gesteckt. Nun, zwanzig Jahre später, machte sie sich auf die Suche nach ihrem leiblichen Vater. Alles, was Charlotte wußte, hatte sie von ihrer Mutter erfahren, die stundenlang Selbstgespräche geführt und dabei ihre billigen Ti’-Punch-Cocktails geschlürft hatte.
Während Dag sich Notizen machte, dachte er, daß Miss Dumas nicht ahnen konnte, welch empfindliche Stellen sie mit ihrer Geschichte in ihm berührte. Er war ungefähr im gleichen Alter gewesen wie sie, als seine Mutter, eine von den amerikanischen Jungferninseln stammende schwarze Karibin, an Brustkrebs gestorben war. Geschwister hatte er keine. Sein Vater, ein »kleiner Weißer«, der das Elend seiner Heimat Louisiana gegen die scheinbare Paradieswelt der Inseln eingetauscht hatte, ein zwergenhafter, spindeldürrer Mann mit blauen, entzündeten Augen, bärtigen Wangen und einem eisigen Humor, hatte nie viel Liebe für seinen Sohn gezeigt. Als Kind fühlte Dag sich eingeschüchtert von diesem Vater, dem er so überhaupt nicht ähnelte und der ihn stets ansah, als würde er ihm diese mangelnde Ähnlichkeit zum Vorwurf machen – zumal Dag hier in der Karibik, wo jeder feine Unterschied in der Hautfarbe von großer Bedeutung ist, zu jenen zählte, die man »Kongoneger« nannte und deren Teint am dunkelsten war. Wie Charlotte hatte auch er unter der Farbe seiner Haut gelitten und nie verstanden, warum sie bei den Beziehungen zu seinen Mitmenschen ein Hindernis darstellen konnte. Erst nach dem Tod seines Vaters hatte er begriffen, daß dieser ihm nicht seinen dunklen Teint zum Vorwurf gemacht hatte, sondern seine Existenz.
Ein schrilles Hupkonzert auf der Straße ließ Dag auffahren. Wieso erinnerte er sich nun an all das? Ein Anfall verfrühter Alterssentimentalität?
Als er sich der Stille im Raum bewußt wurde, sah er Charlotte an. Sie lächelte spöttisch.
»Ich dachte schon, Sie seien eingeschlafen …«
Diese kleine Giftkröte war wahrlich nicht auf den Mund gefallen. Dag schüttelte seinen Füller.
»Entschuldigung, ein kleines Problem mit der Tinte.«
Sie seufzte geräuschvoll, als würde sie sich fragen: »Mein Gott, was habe ich hier bloß verloren?« Doch selbst wenn die Agentur in der Tat nicht besonders vertrauenerweckend aussah, waren Lester und Dag die besten ihres Fachs, und das hatte sich überall herumgesprochen. Wie ein Schauspieler in einem Film zeigte er nun mit dem Füller auf die junge Frau.
»Falls ich Ihren Vater wiederfinde, was gedenken Sie dann zu tun?«
»Ich werde ihm die Eier abreißen.«
»Reizender Plan«, erwiderte Dag und preßte unwillkürlich die Oberschenkel zusammen. »Ich dachte eher an etwas Nettes.«
»Ein anonymer Samenspritzer ist auch nicht gerade nett.« Das reichte Dag. Er brachte das Gespräch auf ein neutraleres Thema zurück.
»Haben Sie bereits Kontakt zum Ehemann Ihrer Mutter aufgenommen?«
»Der ist vor acht Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Ich bin ihm nie begegnet.«
»Wieso glauben Sie, daß Ihr Vater nach wie vor hier in der Karibik lebt?«
»Keine Ahnung. Aber irgendwo muß man schließlich anfangen.«
»Warum haben Sie sich nicht an eine Agentur vor Ort gewandt?«
»Man sagte mir, Ihr Büro sei das beste. Ich möchte Resultate sehen und habe keine Lust, mein Geld zum Fenster rauszuschmeißen«, erwiderte Miss Dumas.
Dag warf einen kurzen Blick auf seine Notizen. Was dort geschrieben stand, ließ sich in einem einzigen Wort zusammenfassen: nichts. Diese junge, wenig liebenswürdige Person war in der Tat auf dem besten Weg, ihr Geld zum Fenster hinauszuwerfen.
»Wenn ich Sie richtig verstehe, wissen Sie über den Mann, der Sie gezeugt hat, nur, daß er sich zur Fastenzeit des Jahres 1970 auf Saint-Marie aufhielt und schwarz ist, wie übrigens neunzig Prozent der dort lebenden Bevölkerung … Was noch? Hätte er beispielsweise vier Arme, so würde uns das die Sache erheblich erleichtern …«
»Was soll das? Sparen Sie sich die Mühe, sich über mich lustig zu machen. Wenn Sie nicht an dem Fall interessiert sind, suche ich mir jemand anderen.«
»Wie Sie wollen.«
Allmählich ging Miss Dumas Dag gehörig auf die Nerven. In seinem Alter hatte er es schließlich nicht nötig, sich von einer ungezogenen Göre anöden zu lassen.
»Wenn Sie alle Ihre Geschäfte auf diese Art und Weise abzuwickeln pflegen …«, sagte sie mit verärgerter Miene.
»Ich weiß nicht, wovon Sie reden.«
Sie warf ihm einen wütenden Blick zu.
»Ach nein? Und das da, das gehört wohl zur Dekoration?« zischte sie und zeigte auf die Kupferplatte an der offenstehenden Tür: »McGregor, Ermittlungen aller Art«.
»Das ist das Schild einer Privatdetektei«, erwiderte Dag einfältig lächelnd.
»Und?«
»Nun, wenn ich Privatdetektiv wäre, würde ich mich natürlich angesprochen fühlen, aber da ich lediglich hier bin, um die Kaffeemaschine zu reparieren …«
»Sie sind wohl völlig übergeschnappt, oder was?«
Sie hatte sich erhoben und in ihrer Wut kräftig mit der Handtasche auf den Schreibtisch geschlagen.
»Sie kamen mir so hilflos vor, und da dachte ich, ich könnte Sie in Ihrer Verzweiflung unmöglich allein lassen …«, fuhr Dag mit sanfter Stimme fort.
»Das gibt’s doch nicht! Dieser Kerl ist völlig verrückt! Ich werde …«
»Was ist denn hier los?« fragte Lester plötzlich auf englisch und mit rauher Stimme, während er, über seinen roten Schnurrbart streichend, seine hundertzehn Kilo Muskeln an den Türrahmen lehnte.
»Madame möchte mit dir sprechen«, ließ Dag ihn freundlich wissen. »Sie kommt aus Marigot«, fügte er hinzu, als sei das eine Entschuldigung.
Mit der Schnelligkeit einer gereizten Viper drehte Charlotte ihren hübschen Kopf Lester zu.
»Und wer sind Sie? Die Putzfrau?«
»Lester McGregor …«, erwiderte Lester mit seiner wundervollen Baßstimme.
Dann fuhr er in schwerfälligem Französisch fort.
»Womit kann ich Ihnen behilflich sein, Mademoiselle …«
»Dumas. Charlotte Dumas. Sind Sie tatsächlich Lester McGregor?«
»Wie er leibt und lebt.«
»Und der Kerl da, wird der von Ihnen dafür bezahlt, die Kundschaft zu amüsieren?«
»Das ist mein Partner«, antwortete Lester und klopfte Dag auf die Schulter. »Unser kleiner Spaßvogel.«
Zufrieden lächelte Dag Charlotte an. Eine junge Frau, die ihrem Vater die Eier abreißen wollte, verdiente durchaus eine etwas gröbere Behandlung.
Im Moment hatte sie jedoch nur Augen für Lester, so wie das bei den meisten Frauen der Fall war. Dag seufzte. Er hatte noch nie begriffen, was an diesem blassen Fleischberg mit den roten Haaren und Sommersprossen derart bewundernswert war. Lag es doch an seinem Schnurrbart? Lester fuhr fort:
»Sie haben einen Superdetektiv vor sich, der die Karibik kennt wie seine Westentasche. Sie können sich auf ihn verlassen. Ich muß jetzt gehen. Ich habe noch eine Verabredung. Würde mich freuen, Sie wiederzusehen, Mademoiselle.«
Es fehlte nicht viel, und er hätte Miss Dumas die Hand geküßt, bevor er das Zimmer unter ihrem aufmerksamen Blick verließ. Mit argwöhnischen Augen wandte er sich erneut Dag zu.
»Ein Superdetektiv … Na hoffentlich!«
»Zufrieden oder Geld zurück, so lautet die Devise unseres Hauses.«
»Und wie lautet Ihr Name, Herr Superdetektiv?« fragte Charlotte resigniert.
»Leroy, Dag.«
»Dag?«
»Dagobert.«
Sie sah ihn entgeistert an.
»Sie heißen tatsächlich Dagobert?«
»Dagobert Leroy. Zu Ihren Diensten.«
»Noch einer Ihrer blöden Witze?«
»Nein, in diesem Fall ist mein Vater der Schuldige. Er hatte einen sehr eigenen Sinn für Humor.«
»Ich gebe einem Kerl, der Leroy Dagobert heißt, einen Auftrag, der mich sehr viel Geld kosten wird.«
»Dagobert war ein sehr guter König.«
»Das ist mir scheißegal! Gut, hören Sie zu, wir machen einen Versuch, Superdetektiv Dagobert, aber ich warne Sie: Tun Sie Ihre Arbeit gewissenhaft.«
Ein reizendes Mädchen. Dag setzte sein verführerischstes Lächeln auf, doch sie schien diese Taktik zu kennen, denn sie wirkte keineswegs besänftigt. Also beschloß er, sich unverzüglich an die Arbeit zu machen.
Und das war ein Fehler.
Gemeinsam verließen Sie das Büro. Es war Zeit, zum Mittagessen zu gehen. Dag lud sie nicht ein. Sie hätte die Einladung abgelehnt, und er wollte ohnehin allein sein. Die Sonne schien. Es war warm, zu warm, wie gewohnt. Mit prüfendem Blick sah Charlotte sich auf der Straße um. Die Ringroad war menschenleer. Lagerhallen und Tanksäulen glitzerten unter dem blauen Himmel. In den Ruinen eines Gebäudes, das der Orkan Louis zum Einsturz gebracht hatte, räkelten sich Katzen.
»Kein verfluchtes Taxi weit und breit! Scheiße. Wie kann man sich bloß in einem derart miesen Viertel niederlassen?«
»Es ist ruhig hier«, erwiderte Dag und streckte sich ausgiebigst. »Entschuldigen Sie die Frage, aber haben Sie Ihre Ausdrucksweise bei den Nonnen gelernt?«
»Und Sie, arbeiten Sie für den Tugendwächterverband? Nein, Vasco Paquirri hat sie mir beigebracht, falls es Sie interessiert.«
Das interessierte ihn durchaus. Nachdem Vasco Paquirri aus Venezuela, wo ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt war, verschwunden war, hatte er sich zu einem der Bosse des Rauschgifthandels in der Karibik hochgearbeitet. Eine Kapazität auf seinem Gebiet. Sein griechisch-römischer Athletenkörper und seine schwarze, oft zu einem Zopf geflochtene Mähne, die ihm bis auf die Hüften reichte, verliehen ihm den Ruf, ein unwiderstehlicher Frauenheld zu sein. Vor allem aber war er steinreich. Das Geld rieselte ihm förmlich aus der Nase, genau wie das Kokainpulver.
»Sie kennen Vasco gut?« erkundigte sich Dag, während Charlotte weiterhin die verlassene Straße anstarrte, als würde im nächsten Augenblick ein Taxi auftauchen, hier, mitten im armseligsten Viertel von Philipsburg, um die Mittagszeit und bei dreißig Grad im Schatten, nur um ihr eine Freude zu bereiten.
»Wir treffen uns ab und zu. Er ist ein Freund von Joe, dem Fotografen der Agentur, für die ich arbeite.«
Aha, also doch ein Model, hatte er es sich doch gleich gedacht. Kokospalmen, weißer Sand, blaue Lagune und ein hübscher runder, karamellfarbener Po. Mit ihren sorgsam gepflegten Fingernägeln klopfte sie auf Dags Handgelenk:
»Und Sie, haben Sie sich im Priesterseminar tätowieren lassen? Was ist das überhaupt?«
Sie deutete auf den maskierten Surfer auf seinem linken Unterarm.
»Der Silbersurfer«, antwortete Dag. »Der Held eines Comicstrips aus den fünfziger Jahren, ein intergalaktischer Wellenreiter. Ein kosmischer Kämpfer für die Gerechtigkeit.«
»Sie zählen wohl eher zur Kategorie der komischen Gerechtigkeitskämpfer«, prustete sie, um gleich wieder mit ernster Stimme zu fragen:
»Surfen Sie?«
»Ein bißchen. Aber ich komme ganz ordentlich zurecht«, murmelte Dag gekränkt.
»In Puerto Rico habe ich einmal Fotos von Surfern gemacht. Großartige Kerle. Man hatte Vasco das Autoradio gestohlen, er war so wütend … Und das da«, fuhr sie fort, »dieser Dolch mit der Schlange? Ist das ein Voodoo-Zeichen? Die Große Schlange des Universums?«
Sie machte sich eindeutig über Dag lustig. Um sie zu provozieren, erwiderte er: »Nein, das hat mit der SS zu tun.«
Ungläubig richteten sich ihre smaragdgrünen Augen auf Dags halbrasierten Schädel.
»Sie waren bei der SS?«
Er spürte, wie es ihn reizte, sie zu provozieren. In dem Moment, in dem er ihr eine entsprechende Antwort geben wollte, erblickte er ein Taxi – schäbig und völlig verschrammt, aber unzweifelhaft ein Taxi. Charlotte mußte über Zauberkräfte verfügen. Seit Monaten hatte er kein Taxi in dieser Gegend gesehen. Sie stieg ein wie Dornröschen in ihre Goldkarosse. Dann rief sie ihm ein »ciao« zu, das so herzlich klang wie die Fünfundzwanzig-Cents-Münze, die man einem Bettler hinwirft.
Dag sah dem Wagen hinterher. Paquirri … Der Dealer wohnte auf seiner Yacht Maximo, einem prachtvollen Trawler, der in Barbuda vor Anker lag, eine Insel, die zu Antigua gehörte und wo es wunderschöne, einsame Strände gab. Und die – wie Antigua – zu einer Drehscheibe des Drogenhandels geworden war. Er betrachtete seine Notizen und zerknüllte das Papier zwischen seinen feuchten Fingern. Die Telefonnummer, die ihm die bezaubernde Charlotte gegeben hatte, begann mit der Vorwahl von Barbuda. Der schöne Vasco, nur ein guter Freund? Dag zuckte mit den Schultern und beschloß, zu T’iou ins Restaurant zu gehen. Mit ein wenig Glück würde der spanische Pfeffer ihn ins Schwitzen bringen und der Schweiß ihm Kühlung verschaffen.
Er ging gerne dorthin, weil T’iou ein schweigsamer Mann war. Er brachte das Essen und kehrte unverzüglich an sein Radio zurück. Mit seinem Radio verbrachte er vierundzwanzig Stunden am Tag. Es war zu einem Bestandteil seines Körpers geworden, vergleichbar mit einer künstlichen Niere, die ihm Nachrichten aus aller Welt übermittelte. Nachdem Dag seine Bestellung aufgegeben hatte, wählte er auf seinem Mobiltelefon die Nummer der Detektei.
»Ermittlungsbüro McGregor, zu Ihren Diensten«, meldete sich die samtige Stimme der treuen Sekretärin Zoé, die ihrem imposanten Chef mit Leib und Seele ergeben war.
»Verbinde mich mit Lester«, sagte Dag, während er den Blick über den Horizont schweifen ließ. Zoé ging ihm mit ihrem Getue einer beleidigten James-Bond-Sekretärin gehörig auf die Nerven.
»Verbinde mich bitte mit Lester«, flüsterte sie.
»Bitte. Danke.«
»Etwas bessere Manieren würden dir nicht schaden, Dagobert.«
Zoé, ein Produkt der heimlichen Beziehung zwischen dem Pfarrer von San Felipe und seiner Köchin, war sehr auf gute Umgangsformen bedacht.
»Yeah?« fragte Lester ungeduldig.
»Ich muß nach Sainte-Marie. Wird ’ne teure Angelegenheit werden.«
»Kann sie zahlen?«
»Ja. Sie hat mir als Vorschuß einen Scheck über fünfhundert US-Dollar in die Tasche gesteckt. Bitte Zoé, bei der Bank zu prüfen, ob das Konto in Ordnung ist.«
»Okay.«
Dag wartete einige Minuten, dann meldete sich wieder Lesters Stimme:
»Kein Problem. Übrigens … eine Luftveränderung wird dir guttun. Es heißt, Frankie sei hinter dir her.«
»Du hast seit jeher ein ausgesprochenes Talent, einem stets im falschen Moment die guten Nachrichten zu verkünden. Gut, ich halte dich auf dem laufenden.«
Nachdenklich legte Dag auf. Frankie Voort war ein festangestellter Auftragskiller von Don Philip Moraes und hatte ihn also immer noch nicht vergessen. Er war ein sehr cleverer Gangster, den er sechs Jahre zuvor ins Gefängnis gebracht hatte, ohne es eigentlich gewollt zu haben. Damals arbeitete Dag im Auftrag eines gehörnten Ehemannes. Nach tagelanger Beschattung war es ihm gelungen, das Stundenhotel ausfindig zu machen, in dem die untreue Gattin ihren Geliebten empfing. Eine billige Absteige im chinesischen Viertel. Nach stundenlangem Warten hatte er es endlich geschafft, das unschuldige Objekt der Begierde von Madame zu fotografieren: einen kleinen, dicken, pausbäckigen Kerl mit Schnurrbart und Stupsnase.
Ohne es zu wissen, hatte Dag Frankie Voort aufgespürt, der wegen eines Mordes und organisierter Erpressung gesucht wurde. Ein mißlungener Vergeltungsanschlag gegen die Hindus aus der Frontstreet, ein wahres Massaker. Voort gehörte zur Kategorie jener todessüchtigen Ganoven, die allzeit bereit sind, abzudrücken. Dag hatte keinerlei Skrupel gehabt, ihn der niederländischen Polizei auszuliefern. Kein Wunder, daß Voort ihn nicht in sein Herz geschlossen hatte. Aber darum ging es jetzt nicht. Im Moment ging es um Miss Charlotte Dumas. Es war besser, sich ganz auf sie zu konzentrieren.
Dag konzentrierte sich, indem er das Meer betrachtete. Die Wellen trugen weiße Schaumkronen und rollten regelmäßig an den Strand, wie in einem Werbespot. Genau der richtige Tag, um nicht ins Büro zurückzukehren, sondern surfen zu gehen. Mit einem Schluck Bier verjagte Dag diesen verführerischen Gedanken.
So mußte er sich also wegen der schönen Lorraine Dumas, die sich fünfundzwanzig Jahre zuvor in einen schwarzen Charmeur verliebt hatte, ein Ticket nach Sainte-Marie kaufen, wo er seit seinem Militärdienst nicht mehr gewesen war. Die Wahrscheinlichkeit, Charlottes Vater wiederzufinden, lag bei eins zu einer Million. Kein Name, keine Personenbeschreibung, lediglich ein Phantom, das in den USA, in Frankreich, in Großbritannien oder sonstwo leben konnte … Und wozu das Ganze? Der Kerl wußte nicht einmal, daß er eine Tochter hatte. Doch wie pflegte dieser Puritaner von Lester zu sagen: »Wenn man für eine Arbeit bezahlt wird, so tut man diese Arbeit auch, und zwar mit allem Engagement.« Also beendete Dag schwitzend seine Mahlzeit und kaufte sich ein Ticket nach Sainte-Marie.
Dags Vater war 1969 gestorben; im selben Jahr hatte ein Wirbelsturm die Insel verwüstet. Damals wohnte Dag bereits nicht mehr auf La Désirade. Er hielt es nie lange irgendwo aus. Folglich war es für ihn nie in Frage gekommen, bis zu seinem Tod im Lebensmittelgeschäft der Familie auszuharren, zwischen Dosen mit Tomatensauce, deren Verfallsdatum abgelaufen war, und Kartons mit lauwarmer Cola. Als Kind wollte er Seemann werden, am Ruder stehen, sich vom Sprühwasser bespritzen lassen und in die Ferne blicken. Doch alles war ganz anders gekommen. Nachdem er sich an verschiedenen Surfertreffs herumgetrieben hatte, meldete er sich freiwillig zu den Marines. Hätte man ihn gefragt, was ihn mitten in der Hippie-Zeit zu dieser Entscheidung veranlaßt hatte, er wäre zu keiner Antwort fähig gewesen. Der Wunsch, sich einer Elitetruppe anzuschließen? Teil einer Gemeinschaft zu sein? Seinem Vater zu beweisen, daß er ein Mann war? Jedenfalls war er viel herumgereist. Zehn Jahre lang, von der Küste Miamis bis zu den Falkland-Inseln. Bis er eines Tages beschloß, den Dienst zu quittieren.
Nach einem tagelangen Besäufnis fand er sich eines Morgens in Philipsburg wieder, mit seinem Matrosensack auf dem Rücken und den Tressen eines Oberfeldmarschalls, die lose an seinem besudelten Hemd baumelten. Er fand Arbeit im Hafen, auf der Schiffswerft. Und dort blieb er. So lernte er Lester kennen – als er dessen Segelboot aufpolierte. Eine zehn Meter lange Ketsch-Yacht namens Kamikaze, eine Rarität, die im gesamten Golf von Mexiko herumgekommen war. Lester, ein ehemaliger Polizist, hatte gerade die Agentur McGregor gegründet, doch er versuchte sich ebenfalls als Schmuggler und benötigte einen verschwiegenen Seemann. Dag war sofort einverstanden gewesen. Nach und nach hatte Lester aber dann mit den illegalen Transporten und den nächtlichen Ausfahrten aufgehört, Dag jedoch in seiner Firma behalten.
Während er seinen alten Erinnerungen weiter nachhing, bahnte er sich einen Weg durch das übliche Gedränge in der Frontstreet. Mit gierigen Blicken betrachteten Touristen die Schaufenster der Tax-free-Läden. Dag ging an der Spielhalle Rouge et Noir vorbei, wo sich Trauben von Leuten um die Glücksautomaten drängten, und gelangte schließlich zu dem Haus, in dem er wohnte, ein Gebäude aus den siebziger Jahren. Im Erdgeschoß befanden sich ein italienisches Restaurant und ein indisches Lebensmittelgeschäft, im ersten Stock war eine Peepshow.
Mit einem lauten Krächzen hielt der asthmatische Aufzug auf der dritten Etage. Dag öffnete die braune Tür, die lediglich seine Initialen trug, und seufzte. Es war höchste Zeit, ein wenig sauberzumachen: Das Bett war zerwühlt, überall lagen Klamotten herum, der Tisch war unter Papierbergen begraben, in der winzigen Badewanne ruhte Dags Surfbrett. Selbst die Plakate von Boxkämpfen an den Wänden sahen verdreckt aus. Zuerst staubte er »Muhammed Ali gegen Joe Frazier« ab, dann entfernte er rasch die beiden leeren Gläser vom Fernseher, die Kaffeetassen von der Klospülung, den vollen Aschenbecher vom Kopfkissen seines Bettes. Der Anrufbeantworter blinkte. Während Dag die Mitteilungen abhörte, stopfte er ein paar saubere Kleidungsstücke in seine Reisetasche. Ein Anruf seines Freundes Max, der ihn auf eine Partie Poker einlud, ein Geschirrspülmaschinenvertreter, der Aufschrei des kleinen Jed, der ihm mitteilte, daß ihm endlich ein spin air geglückt war, und jemand, der gleich wieder aufgelegt hatte. Keine Nachricht von Helen.
Er ließ seinen Blick durch die unordentliche Wohnung schweifen und sagte sich, daß Helen wohl nie wieder anrufen würde. Sie konnte Durcheinander nicht ausstehen. Poker übrigens auch nicht. Von Glücksautomaten, Sportzeitungen, Tätowierungen und fluoreszierenden Präservativen ganz zu schweigen. Helen hatte an allem etwas auszusetzen. Aber ficken, das konnte sie, wie Dag sich eingestehen mußte, als er nach seiner automatischen Waffe griff, einer Cougar 8000. Obwohl Dag kein Waffennarr war, zwang er sich, in einem Klub in der Nähe des Surferstrands Oyster Pond regelmäßig zu üben. Waffenschein, Reisepaß; er schloß seine Tasche, warf einen letzten Blick in das halbdunkle Zimmer, und nachdem er sich vergewissert hatte, daß der Gashahn richtig zugedreht war, verließ er die Wohnung.
Die Motoren dröhnten, als die Maschine vom Flughafen von Espérance-Grand Case abhob und über das glitzernde, türkisfarbene offene Meer schwebte. Dag blickte durch das kleine runde Fenster, ohne etwas zu sehen. Erinnerungen an Sainte-Marie gingen ihm durch den Kopf. Als Kind hatte er dort fast jedes Jahr die Ferien bei seiner Tante verbracht. Ihm war, als könnte er ihr nach Vanille duftendes Parfüm riechen und das Rascheln ihrer Samtkleider hören. Auf seiner Zunge lag der Geschmack der weißen Kokosnußbällchen, die sie ihm jeden Sonntag nach der Messe kaufte. Die mehrheitlich schwarze Bevölkerung der Insel war zu neunzig Prozent katholisch. Die indischen Geschäftsleute, die »Kulis«, besaßen ihre eigenen Kultstätten und hatten sich nicht wirklich in die Bevölkerung integriert. Nachdem die Insel nacheinander den Spaniern, den Franzosen, den Engländern, den Dänen und dann erneut den Franzosen gehört hatte, wurde sie anschließend Mitglied der französischen Union und später der Europäischen Gemeinschaft. 1966 war die Insel unabhängig und zum Ziel zahlreicher Einwanderer aus Kuba und Haiti geworden. Mehrere Traditionen prallten aufeinander, ohne ihre Eigenheiten aufgeben zu müssen. Das Gerichts- und Strafwesen richtete sich nach dem französischen Modell, aber man fuhr auf der linken Straßenseite. Neben der offiziellen französischen Sprache wurde häufig auch spanisch und englisch gesprochen. Da die Sitten und Bräuche von den Kleinen Antillen hier ebenfalls fest verwurzelt waren, sprach die Mehrheit der Bevölkerung weiterhin kreolisch. Dag lächelte, als er an seine Tante dachte, die gegen Französisch stets eine heftige Abneigung gehegt hatte. Schließlich gab er sich einen Ruck und zog die Unterlagen aus einer Mappe. Das kleine Flugzeug schwankte im stürmischen Wind hin und her, Dags Sitznachbarin roch nach Zitronenkraut, alles war in bester Ordnung. Er war beruflich unterwegs.
2. KAPITEL
Sanft setzte das Flugzeug auf der Piste des Inselflughafens von Grand-Bourg auf Sainte-Marie auf. Dag wartete geduldig, bis seine Nachbarin ihre neunzig Kilo in Bewegung gesetzt hatte, um seinerseits festen Boden unter die Füße zu bekommen. Man hätte glauben können, das Flugzeug hätte sich nie von der Stelle bewegt: die gleiche Hitze, die gleichen Bäume, der gleiche Himmel, die gleichen Baracken. Nur die im Wind knatternde Landesflagge – gelber Stern auf azurblauem Hintergrund – und der Zöllner, der gelangweilt einen Stempel in Dags Reisepaß drückte, verrieten, daß man in einem anderen Staat angekommen war.
Draußen, im Schatten der Palmen, wartete eine Kolonne verbeulter Taxis. Der geliebte Präsident Macario, dessen Sohn der einzige Autohändler mit behördlicher Genehmigung auf der Insel war, hatte mit ausländischen Herstellern eine Vereinbarung getroffen, die ihm zu äußerst günstigen Preisen die Lieferung fabrikneuer Fahrzeuge mit kleinen Konstruktionsfehlern sicherte. So wurde der Fahrzeugpark mit den jeweiligen Restposten erweitert, und diesmal stieg Dag in einen R9, der offensichtlich zu einer der ersten Lieferungen gehört hatte. Er nannte dem Fahrer die Adresse des Waisenhauses, in dem Charlotte aufgewachsen war.
Zum Glück war die Rue du Petit-Bourg nur wenig befahren, denn allem Anschein nach hatte der Fahrer einen Kompromiß geschlossen zwischen seinem Lenkrad, das zum Rechtsfahren bestimmt war, und dem Gesetz, das ihn zum Linksfahren verpflichtete: er fuhr konsequent in der Straßenmitte. Zu Dags großer Erleichterung begegneten sie lediglich einem wohlweislich auf dem Seitenstreifen dahinrollenden Ochsengespann. Im Gegensatz zu einigen Nachbarinseln, die fieberhaft nach Modernisierung strebten, lebte Sainte-Marie hauptsächlich vom Zuckerrohranbau sowie vom Bananen- und Rumexport. Man begegnete hier immer noch mit Zuckerrohr beladenen Karren, und bei einem Besuch der Brennerei glaubte man sich um hundert Jahre zurückversetzt.
Die Landschaft zog vorbei, und Dag spürte ein leichtes Kribbeln im Bauch, als er die Straßenschilder wiedererkannte. »Morne Saint-Jean«, die Bohnenfelder, »Anse Marigot«, wo er Krabben gefischt hatte … Allein der Geruch der Insel, der herbe durchdringliche Duft von Blumen und Jod, rief in ihm eine Flut von Erinnerungen wach: das wütende Brodeln des Wassers am Fuße der Steilküste, der dunkle, kühle Laden seiner Tante, wo die Fliegenfänger in langen, bunten Spiralen von der Decke hingen, der Geschmack der Bélélé-Suppe, die sie für ihn zubereitet hatte – eine Suppe aus Krabbenfleisch, Erbsen, Brotfrucht und Bananen –, das Gackern der Hühner im kleinen Hühnerstall. Indem Charlotte ihn auf die Suche nach ihrem Vater geschickt hatte, hatte sie ihn unwissentlich auf die Spuren seiner eigenen Vergangenheit angesetzt.
»Wir sind da, Chef!«
Dag bat den Fahrer, auf ihn zu warten, und ging auf das Waisenhaus zu. Ein großes, weißes Gebäude, das vor kurzem neu gekalkt worden war. Nüchtern und stattlich. Während Dag vor dem Portal darauf wartete, daß jemand ihm öffnete, betrachtete er den gepflegten Garten.
Schließlich kam eine kurzbeinige Nonne auf ihn zugetrippelt und fragte aufgeregt: »Ka sa yé?« Er gab ihr sein mit der Devise »vitum impendere vero« (sein Leben der Wahrheit widmen) versehenes Ausweiskärtchen und erklärte ihr, daß er die Oberin zu sprechen wünsche. Sie musterte kritisch seine Kleidung, bevor sie sich entfernte. Dabei wiegte sie ihren Kopf hin und her und streckte seinen Ausweis wie ein loderndes Zündholz weit von sich.
Erneutes Warten am Portal. Um sich die Zeit zu vertreiben, versuchte Dag, die Pflanzen und Sträucher in dem Garten zu benennen. Keine besonders amüsante Beschäftigung, und außerdem verspürte er allmählich heftigen Durst. Endlich kam die Pförtnernonne, völlig außer Atem, zurück und teilte ihm mit daß – »pani problem« – Mutter Marie-Dominique ihn erwarten würde. Er folgte ihr durch kühle Flure mit rotem Fliesenboden und träumte von Getränkeautomaten. Eine Lehrerin hielt irgendwo ihren Unterricht, und schrille Stimmchen antworteten ihr in singendem Ton.
Die Oberin saß an ihrem Schreibtisch, einem ausgeblichenen Möbelstück aus Rosenholz mit kunstvoll gearbeiteten Schubladen. Sie war eine schöne, etwa sechzigjährige Frau mit rötlichbraunem Teint und dunklen, kalten Augen, die ohne Umschweife zu sagen schienen: »Beeil dich, mein Sohn, ich habe noch eine Menge zu tun!« Dag wartete, bis sie ihm bedeutete, Platz zu nehmen. Dann sagte er:
»Es tut mir leid, daß ich Sie störe, aber ich habe einen Auftrag von einer Ihrer früheren Schülerinnen, Charlotte Dumas …«
»Dumas … Ja, ich kann mich erinnern«, unterbrach ihn die Ordensschwester und gab ihm seinen Detektivausweis zurück.
Mit dem Gefühl, in das Innere eines Kühlschranks zu schauen, betrachtete Dag ihre vollen Lippen und die tadellos weißen Zähne. Mühsam fuhr er fort:
»Mademoiselle Dumas hat mich beauftragt, ihren Vater wiederzufinden, das heißt … ihren richtigen Vater.«
»Was hat das mit uns zu tun?« fragte die Oberin und kreuzte in aller Ruhe die Hände.
Dag deutete ein Lächeln an.
»Nun, da sie hier bei Ihnen aufwuchs, dachte ich, Sie könnten mir möglicherweise einige Auskünfte erteilen …«
»Ehrlich gesagt, Monsieur …«
»Leroy.«
»Monsieur Leroy. Bevor Charlotte uns verließ, bat sie mich, ihr ihre Akte auszuhändigen. Ich bin seit jeher der Ansicht, daß jedes Kind das Recht hat, die Wahrheit zu erfahren. Ich habe ihr also alles erzählt, was ich wußte. Hier bitte – Dumas, Charlotte.«
Sie reichte ihm eine Karteikarte.
»Ich wußte, daß Sie kommen würden. Charlotte hat mir Bescheid gesagt. Eine ganz ausgezeichnete Schülerin war sie, aber starrköpfig, ein schlechter Charakter. Aufsässig und rachsüchtig. Das führt zu nichts Gutem.«
Dag nahm die Karte und las sie rasch durch:
DUMAS Charlotte:
– geboren am 3. Januar 1971 in Vieux-Fort, Sainte-Marie
– Vater: unbekannt
– Mutter: Lorraine Malevoy, Mädchenname Dumas, geboren am 8. Februar 1943 in Pau, Gironde; gestorben am 4. Oktober 1976 in Vieux-Fort, Sainte-Marie.
Vieux-Fort. Die schwarzen, an Kokospalmen angebundenen Schweine. Der Duft der wilden Flamingoblumen, welche die Fassade des Ladens von Tante Amélie schmückten …
– Eintritt ins Foyer der Heiligen Familie: November 1976
– Austritt: Januar 1989.
Das war alles. Ratlos starrte Dag Mutter Marie-Dominique an.
Dann räusperte er sich:
»Das alles wußte ich bereits. Von Mademoiselle Dumas. Ich hoffte, auf wesentlichere Angaben zu stoßen.«
»Zum Beispiel?«
»Zum Beispiel auf die genauen Todesumstände ihrer Mutter. Oder auf das, was damals über den vermeintlichen Vater erzählt wurde. In solchen Fällen gibt es doch meistens irgendwelches Geschwätz. Ich weiß nicht, in welcher Funktion Sie damals hier tätig waren …«
Sie lächelte gutmütig.
»Klatsch und Tratsch sollten Sie nicht von mir erwarten. Ich höre mir solche Geschichten nicht an. Nie. Was den Selbstmord der Mutter betrifft, so weiß ich lediglich das, was die damalige Sozialarbeiterin mir erzählte, eine gewisse Madame Martinet, wenn ich mich nicht irre. Ich habe keine Ahnung, ob sie noch lebt.«
»Zwanzig Jahre sind seither vergangen, und Sie erinnern sich immer noch an den Namen dieser Frau? Wieso?«
»Vielleicht weil ich ganz einfach ein gutes Namensgedächtnis habe, Monsieur. Oder weil sie ein unvergeßliches Gesicht hatte. Oder aber weil es in meinen Augen auf der Welt nichts Traurigeres gibt als ein kleines Mädchen, das seine Mutter an einem regnerischen Tag an einem Balken unter der Veranda hängen sieht und so lange zu ihren Füßen hocken bleibt, bis jemand vorbeikommt und sie entdeckt. Falls Sie weitere Einzelheiten erfahren möchten, setzen Sie sich mit Madame Martinet in Verbindung. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Sie arbeitete im Amt für Sozialfürsorge.«
»Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe«, sagte Dag und erhob sich, um sich zu verabschieden.
Mit einem ironischen Blick sah sie ihn an.
»Sie sind nicht zufrieden, nicht wahr? Sie hatten gehofft, ich würde sein Foto aus meiner Tasche zaubern? Leider ist Charlottes Vater kein Kaninchen, das man einfach aus einem Hut ziehen kann. Nein, Monsieur, ich fürchte, es erwarten Sie noch etliche Anstrengungen. Oder wie es bei uns heißt: ›Si ou haï moin, ou ka ba moin pagnien pou poté dleau‹.«
Man geht nicht mit einem Strohkorb zum Brunnen, ich weiß, dachte Dag.
»Vielen Dank für Ihre Ermutigung. Nein, bemühen Sie sich nicht, ich kenne den Weg.«
Dags Hand lag bereits auf dem Türknauf, als sie hinzufügte:
»Man nannte ihn Jimi. Charlotte hat es mir gesagt. Ihre Mutter sprach immer von Jimi. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise.«
»Und ich Ihnen einen schönen Tag«, antwortete Dag, der kindischen Freude wegen, ihr keine Antwort schuldig zu bleiben.
Kopfschüttelnd schloß er hinter sich die Tür. Alle Achtung. Er brauchte nur noch Madame Martinet aufzutreiben, die 1976 als Sozialarbeiterin tätig gewesen war. Also auf zum Amt für Sozialfürsorge und all den behördlichen Schikanen ins Auge geblickt, die den größten Teil seiner Arbeit ausmachten.
Jimi … Jimi. Zu jener Zeit gab eine Menge Jimis … und ebenso viele Bobs. Erstere hatten Afromähnen von einem Meter Durchmesser und eine Gitarre um den Hals, letztere trugen Rastazöpfe von einen Meter Länge und hatten ebenfalls eine Gitarre um den Hals. Alle nannten sich Bob oder Jimi. Das war besser als Toussaint, Rodriguez oder Dagobert, damals, als alle Mädchen in Ekstase gerieten, wenn sie das Album von Woodstock anhörten. Wie sollte er also jemals diesen einen Jimi wiederfinden?
Eine gute Viertelstunde lang schwitzte Dag im Taxi, bevor er an seinem Ziel ankam. Auf einem Schild waren die Öffnungszeiten zu lesen. Es reichte für zwei Bier, ein Sandwich und drei Zigaretten, die er während des Wartens im Schatten eines zerzausten Sonnenschirms genoß. Der Inhaber des kleinen Lokals hörte Zouk-Musik und summte die Melodie mit. Das einheimische Bier mit dem vielversprechenden Namen Diablesse schmeckte bitter; Dag trank es in kleinen Schlucken, während er noch einmal an die bewegte Zeit der Jimis und Bobs zurückdachte, an die mehrtägigen Trips und an die Mädchen, die einem das Gefühl gaben, der bedeutendste Mann im ganzen Universum zu sein, in Wirklichkeit aber nur ein wenig Haschisch ergattern wollten.
Auch Dag hatte an den riesigen Stränden von Sainte-Marie eine – wie die Franzosen sagen – »Metro« kennengelernt, eine junge Frau aus dem europäischen Mutterland. Doch sie war weder reich noch verheiratet. Sie war ein Mädchen für alles und hieß Franwise. Er wollte ihr nicht gestehen, daß er sich gerade freiwillig zur Marine gemeldet hatte, das kam damals nicht so gut an. Statt dessen hatte er behauptet, einfach nur unterwegs zu sein. Françoise … Er spürte das aufkommende Bedauern über die allzu schnell vergehende Zeit und schaute auf seine Uhr. Der Gongschlag rettete ihn: es war soweit. Er machte sich auf zu den klimatisierten Büroräumen.
Allzu klimatisiert, wie er feststellte. Man hätte am Eingang Parkas verteilen sollen. Ihm war, als würde allmählich eine Eisschicht seinen Körper überziehen. Die junge Frau am Empfang, eine Weiße mit krebsrotem Teint, starrte ihn mit ihren grauen, gleichgültigen Augen an und tat so, als würde sie ihm zuhören. Er beugte sich zu ihr.
»Hören Sie, würden Sie bitte so nett sein und den Abteilungsleiter rufen? Das würde uns eine Menge Zeit ersparen, bevor ich mich in einen Eisberg verwandle.«
»Monsieur Baker ist beschäftigt.«
»Ach so! Und Sie können ihm nicht Bescheid geben?« Verlegen rutschte sie auf ihrem Stuhl hin und her.
»Er darf nicht gestört werden.«
Gut, er trank Kaffee. Oder saß auf dem Klo. Oder war gerade dabei, sich mit seiner Sekretärin zu amüsieren.
»Wann könnte ich denn mit ihm sprechen?«
»Sie müssen sich einen Termin geben lassen.«
In diesem Moment betrat ein Dicker mit nervösen Schritten die Halle. Das Hemd, das sich um seinen Oberkörper spannte, war genauso weiß wie seine Hängebacken.
»Monsieur Baker!« rief das Mädchen erleichtert.
»Was ist? Bin in Eile!« stieß der Dickwanst hervor und wischte sich die Stirn ab.
»Dieser Herr hier möchte gerne einen Termin mit Ihnen vereinbaren.«
Baker versuchte, Dag einen scharfen Blick zuzuwerfen, doch in Wirklichkeit verrieten seine Augen allzu eifrigen Alkoholkonsum.
»Was wollen Sie denn von mir?« brummte er.
»Ermittlungsbüro McGregor«, erwiderte Dag und zeigte ungefragt seinen Ausweis. »Ich benötige einige Auskünfte über eine Ihrer Angestellten.«
»Jetzt gleich?«
»Das wäre schön. Es dauert nur ein paar Minuten.«
Diese Erklärung schien Baker sichtlich zu erleichtern. Er deutete Dag an, ihm zu folgen, und schwankte zu seinem Büro. »Treten Sie ein, McGregor.«
Dag unterließ es, ihn über seinen Irrtum aufzuklären, es wäre zu aufwendig gewesen. Baker ließ sich schwerfällig in einen Sessel fallen und schaute Dag starr in die Augen, bevor er sich nach vorne beugte und murmelte:
»Finden Sie nicht auch, daß diese Klimaanlage ziemlich schwach ist?«
»Fürs Einfrieren vielleicht, aber für ein einfaches Tiefkühlen scheint sie mir genau richtig.«
Einen Moment lang kaute Baker an dieser Bemerkung, doch dann stimmte er vorsichtshalber mit einem Nicken zu.
»Ja, ja … Und? In welcher Angelegenheit ermitteln Sie?«
»Ich suche eine Dame namens Martinet, die 1976 hier gearbeitet hat.«
»Ach! Ja, ja. Wir prüfen das in der Kartei.«
Er drückte auf einen Knopf seines Telefons Modell Obere Chefetage und gab, fast ohne zu stottern, eine Reihe Befehle durch.
Voller Bewunderung betrachtete Dag die vielen Hängemappen und die metallenen Aktenschränke.
»Viel Arbeit, das alles hier.«
»Ja, ja.«
Baker warf sich in die Brust.
»Sie können sich das gar nicht vorstellen! Wir kümmern uns um mehr als zweitausend Akten, und das nur im Bezirk von Grand-Bourg, wohlverstanden. Vieux-Fort, das ist wieder was ganz anderes.«
»Tatsächlich?«
»Ja, ja, das ist nicht dasselbe. Hier ist Grand-Bourg. Und drüben ist Vieux-Fort, ja, ja.«
Erschreckend. Dag wußte nicht mehr, wie er seinen Lippen ein Lächeln für diesen betrunkenen Fleischberg abringen sollte, als die Sekretärin eintrat. Eine große Mulattin mit kurzen braunen Haaren. Es tat gut, einen nüchternen Menschen vor sich zu haben.
»Guten Tag. Hier ist die Karteikarte von Madame Martinet.«
»Danke, Betty, vielen Dank. Ja, ja … Aber, hören Sie, haben Sie überhaupt eine offizielle Vollmacht?«
»Nein, ich brauche bloß eine Auskunft, nichts Offizielles.«
»Ach, ja, ja, allerdings bin ich mir nicht sicher, ob ich Ihnen ohne offizielle Vollmacht nähere Angaben über eine unserer Angestellten erteilen kann. Das sind immerhin persönliche Daten, Monsieur.«
Dag nickte.
»Ich soll mich wegen einer Familienangelegenheit mit Madame Martinet in Verbindung setzen. Eine Neffe von ihr, der in den USA lebt, würde sie gerne besuchen, aber er hat ihre Adresse verloren.«
Das war ihm einfach so in den Sinn gekommen: er hatte ein Talent für Lügen aus dem Stegreif.
»Ach, ja, ja … Was meinen Sie, Betty?« fragte der Dicke und schüttelte seine Hängebacken.
Offensichtlich meinte Betty, daß sie nun schon lange genug gewartet hatte und ihre Füße in den fünfzehn Zentimeter hohen Stöckelschuhen allmählich zu schmerzen begannen.
»Ich glaube nicht, daß Madame Martinet uns böse sein wird, weil wir ihrem Neffen geholfen haben, sie ausfindig zu machen.«
»Ja, ja … Hören Sie, Monsieur McGregor, Sie klären die Sache am besten mit Betty. Ich habe eine Verabredung, ich muß jetzt gehen.«
Eine Verabredung mit seiner ruinierten Prostata, diagnostizierte Dag, während Baker davonstampfte. Lächelnd wandte er sich an Betty.
»Gut, kann ich jetzt diese Karteikarte sehen?«
»Sind Sie von der Polizei?«
»Ermittlungsbüro McGregor«, seufzte Dag und zog erneut seinen Ausweis hervor.
»Ein Bluff, nicht wahr? Und was wollen Sie tatsächlich von der armen Martinet?«
»Das habe ich Ihnen doch schon gesagt.«
Sie grinste ungläubig und sah Dag mit ihren hübschen nußbraunen Augen an.
»Gut, einverstanden. Eloise Martinet, ledig, geboren 1915 auf der Insel Dominica. Seit 1985 im Ruhestand. Wohnt auf der Insel Saintes, in Terre-de-Haut. 115, Avenue de Caye Plate. Ich hoffe, Sie sind nicht jemand, der alte Damen vergewaltigt.«
»Sehe ich danach aus?«
Sie lächelte:
»Ehrlich gesagt, weiß ich nicht so recht, wonach Sie aussehen.«
Dag dachte noch eine Weile über diesen Satz nach, als er die Treppe hinunterging, die nach draußen in die Hitze führte. Auf der Straße angekommen, stellte er sich in den Passatwind, um auf ein Taxi zu warten und weiter nachzudenken. Bisher hatte er stets von sich geglaubt, er sei ein gut gebauter Vierziger ohne ein einziges graues Haar und mit einem Gesicht, das an den Kaiser von Äthiopien erinnerte – und nun stellte dieses unschuldige Geschöpf das alles plötzlich in Frage. Entsprach das Bild, das er von sich selbst hatte, eigentlich der Wirklichkeit? Auf diese beunruhigende Frage hin beschloß er, den Weg zum Hauptplatz, wo er vielleicht ein Taxi erwischen könnte, zu Fuß zurückzulegen.
Die Tasche schlug gegen seinen Rücken, genau wie damals zur schönen Zeit der Jimis. Da er das Gefühl hatte, verfolgt zu werden, drehte er sich mehrmals um, doch er stellte nichts Ungewöhnliches fest. Berufsparanoia, schlußfolgerte er und beschleunigte seine Schritte.
Schon wieder ein hin und her rüttelnder Rumpf, schon wieder diese knallroten, schwitzenden Touristen, schon wieder ein kleiner Flughafen, in dem es so heiß war wie in einem Backofen. Die Inselgruppe Saintes. Ein winziges Archipel, 240 Kilometer von Saint-Martin entfernt. Terre-de-Haut, sechs Kilometer lang und drei Kilometer breit, eine einzige befahrbare Straße, fast keine Autos.
Wie alle anderen auch ging Dag als erstes zu dem Vermieter von Motorrollern. Eine Viertelstunde später bremste er vor einem kleinen, massiv gebauten Haus ab. Es war von Hibiskus umgeben, rosa und blau gestrichen – blaue Wände, rosarote Fensterläden. Am Straßenrand parkte ein alter, schäbiger Peugeot 404. Eloise Martinet schien keine besonders leidenschaftliche Auto-Journal-Leserin zu sein. Dag stellte den Motorroller unter eine Palme und klingelte an der Tür, von der die Farbe abblätterte.
Keine Antwort. Er ging um das Haus herum, die Vorhänge waren zugezogen. Erneutes Klingeln. Eloise Martinet war achtzig Jahre alt. Es war fast neunzehn Uhr, es wurde allmählich dunkel, und Eloise konnte sich nicht allzu weit entfernt haben, da ihr Wagen vor dem Haus parkte. Dag schaute sich um: In zweihundert Metern Entfernung, auf der rechten Seite, befand sich eine wurmstichige mit Bougainvillea bewachsene Hütte, vor der sich die ganze Familie zum Kartenspiel versammelt hatte; linker Hand ein Holzhaus mit geschlossenen Fensterläden, das fast vollständig von der Vegetation überwuchert war. Dag blieb nichts anderes übrig, als zu warten. Er lehnte sich an die Tür und wäre um ein Haar der Länge nach hingefallen, als sie unter seinem Gewicht nachgab und sich weit öffnete.
Doch es war nicht Eloise Martinet, die ihm aufgemacht hatte. Niemand war zu sehen. Dag tastete nach dem Lichtschalter. Es wurde hell, und er sah ein großes Zimmer voller Korbmöbel: ein geblümtes Sofa, mit Nippsachen überhäufte Regale, ein niedriges Tischchen, eine Vase mit einem leuchtendgelben Hibiskusstrauß, an den Wänden gerahmte Fotos, ein Reklameplakat für Zahncreme, auf dem ein braungebrannter, Wasserski fahrender Schönling abgebildet war. Von Eloise Martinet weit und breit keine Spur.
Aber dann plötzlich entdeckte er sie. Sie lag hinter dem Sofa und klopfte mit ihren in weißen Sandalen steckenden Füßen krampfartig auf den Fußboden. Er eilte zu ihr hin. Eine kleine, zierliche Frau mit grauen Haaren. Mit bereits glasigen Augen starrte sie ihn an und murmelte:
»… Pillen …«
Er folgte der Richtung ihres Blickes, griff nach dem Pillenfläschchen auf einem der Regale und öffnete es hastig. Seine Hände schwitzten, die alte Dame zitterte wie Espenlaub. Es gelang ihm, zwei Pillen aus dem Fläschchen zu fischen und sie der Frau in den Mund zu stecken. Sie blinzelte, als wollte sie sich bedanken, doch dann erstarrte sie. Ihre blauen Augen waren weit aufgerissen. Zu spät. Völlig sprachlos fixierte Dag ihren halb geöffneten Mund, ihr gelbliches Gebiß, ihre starren Pupillen, ihr graues Haar, das sich im Luftzug leicht bewegte. Vorsichtig hob er sie hoch, befühlte ihren Puls. Nichts. Sie war tot, eindeutig tot.
So ein Pech! Kein Blut, keine Verletzung – ein Herzanfall, und das ausgerechnet in seinen Armen. Zweifellos hatte sie Dag klingeln gehört und auf Hilfe gehofft. Scheiße. Hätte er sie ein paar Minuten früher gefunden, wäre sie jetzt nicht tot. Es war idiotisch, aber er fühlte sich schuldig.
Er richtete sich auf, wütend auf sich selbst und auf das Leben. Er brauchte unbedingt eine kleine Stärkung. Die Frau einfach so sterben zu sehen, in seinen Armen – das war hart, auch wenn er sie gar nicht gekannt hatte. Sein Blick fiel auf einen Schrank, der einige Flaschen enthielt, und er bückte sich. Rum natürlich, und noch mehr Rum, doch er hatte dieses verfluchte Rumzeug satt. Aber da! Eine Flasche Sherry. Er öffnete sie und wollte gerade zu einem kräftigen Schluck ansetzen, als lautes Hupen die Stille zerriß, so nah, daß er zusammenzuckte. Eine gehörige Portion Sherry besudelte sein Hemd. Ratternd setzte der Wagen, der gehupt hatte, seinen Weg fort, inmitten junger Stimmen, die aus Leibeskräften grölten. Rechter Hand entdeckte Dag die winzige Küche; er drehte den Wasserhahn auf, um sein Hemd zu säubern.
Als er den Hahn wieder zudrehte, bemerkte er zwei benutzte Gläser. Er roch daran. Sie hatten Rum enthalten. Guten Rum. An einem der beiden Gläser war hellroter Lippenstift. Dag ging zu der Leiche zurück. Eloise Martinets Lippen waren in diskretem Rosa geschminkt. Sie hatte aus einem der Gläser getrunken, und ein unbekannter Gast aus dem anderen. Eine Bekannte? Ein Freund? Ein Liebhaber? Er zuckte mit den Schultern: Was ging es ihn an? Sie durfte empfangen, wen sie wollte. Erneut hatte er reagiert wie ein Polizist. Apropos Polizei, es wurde Zeit, sie zu benachrichtigen. Zuvor jedoch empfahl sich eine kleine Hausdurchsuchung. Man konnte nie wissen …
Als erstes warf Dag einen Blick auf die gerahmten Fotos. Er erkannte Madame Martinet sofort wieder: an ihren hellen Augen und dem spitzen Gesicht, als Dreißig-, Vierzig- und Fünfzigjährige, jedesmal von einer Kinderschar umgeben. Die jüngsten Aufnahmen schaute er sich genauer an, vor allem die Kinder, die darauf zu sehen waren. Er wurde nicht enttäuscht. Auf einem der Fotos entdeckte er tatsächlich Charlotte. Ein völlig verschüchtert wirkendes Mädchen mit langen, sorgfältig zu Zöpfen geflochtenen Haaren, grünen Augen und einem katzenhaften Gesichtsausdruck, das sich am Rock der Sozialarbeiterin festhielt. Was noch? Er entfernte sich von den Fotos und nahm einen im hinteren Teil des Zimmers stehenden Schreibtisch auf Rollen in Augenschein. Vorsichtig ging er um die Leiche herum und näherte sich dem Möbelstück. Darauf befanden sich lediglich ein Glasbecher mit Füllfedern und ein Heft mit Kreuzworträtseln. In den Schubladen fand er kartonierte Dossiers, die gewissenhaft geordnet und mit fetten Druckbuchstaben beschriftet waren: »Strom«, »Wasser«, »Steuern«, »Rente«, »Privat«.
Neugierig griff er nach dem Ordner »Privat«.
Briefe. Auseinandergefaltete und in chronologischer Reihenfolge sortierte Briefe. Nachrichten von der Familie aus Frankreich, Briefe von Freundinnen. Es hätte Stunden gedauert, um alles genau durchzusehen. Dag beschränkte sich darauf, sie durchzublättern und sich flüchtig die Unterschriften anzusehen. Bei einem allerdings hielt er inne: er war nicht unterschrieben. Ein kariertes Blatt aus einem Heft, auf das ein paar Worte gekritzelt waren: »Sie hat nicht Selbstmord begangen. Der Teufel hat sie umgebracht. Erzählen Sie es niemandem, sonst wird er auch die Kleine töten.« Kein Datum, eine beinahe unleserliche, zittrige Schrift.
Eloise Martinet hatte das Blatt zwischen die Briefe vom Winter 1976 gelegt. Folglich hatte sie es nach dem Tod von Lorraine Dumas erhalten. Ja, dieser Brief hatte zwangsläufig mit Lorraine zu tun. Das Brummen eines Motors riß Dag aus seinen Überlegungen. War es notwendig, noch länger hierzubleiben? Für Eloise Martinet konnte er ohnehin nichts mehr tun. Er faltete den Brief, steckte ihn in seine Hosentasche und verabschiedete sich mit einem Kopfnicken von der Leiche. Dann stieg er zum Fenster hinaus, schlich geräuschlos in die Dunkelheit davon und gelangte zur Straße. Hunderte von Krebsen krochen bei ihrem nächtlichen Spaziergang über den Asphalt. Dag spürte ihre knirschenden Panzer unter seinen Sohlen. Und wie zu erwarten, funktionierte der Scheinwerfer des Motorrollers nicht.
Langsam fuhr er die von Mandelbäumen gesäumte Straße zurück ins Stadtzentrum, betrat ein kleines Restaurant und bestellte, tief in Gedanken versunken, ein Bier und ein Reisgericht.
Jemand war also der Meinung gewesen, daß Lorraine nicht Selbstmord begangen hatte, sondern umgebracht worden war. Wer würde ihm das jetzt noch sagen können? Eloise Martinet war unerwartet gestorben. So wie die Dinge momentan standen, blieb Dag nichts anderes übrig, als nach Philipsburg zurückzufahren, Lester mitzuteilen, daß die Sache schiefgegangen war, und Charlotte ihr Geld zurückzugeben. Oder wäre es besser, sie zuvor anzurufen und zu fragen, was er tun solle? Er wühlte in seiner zerschlissenen Brieftasche und zog den Zettel hervor, auf dem er sich die Telefonnummer von Miss Dumas notiert hatte. Es war neun Uhr. Möglicherweise war sie gerade zu Hause. Und, was für ein Glück, er hatte sogar daran gedacht, sein Mobiltelefon einzustecken. Doch als er die Nummer wählte, stellte er fest, daß das Warnsignal der Batterie aufleuchtete, und ihm fiel ein, daß er das Ladegerät im Büro vergessen hatte.
»Hallo?«
Ein Mann mit rauher Stimme.
»Ich möchte bitte mit Charlotte Dumas sprechen.«
»Wer ist am Apparat?«
Südamerikanischer Akzent.
»Leroy, Dag Leroy, es ist dringend. Die Batterien meines Telefons gehen zu Ende und …«
Leises Tuscheln am anderen Ende der Leitung. Heftigeres Blinken des Warnsignals.
»Hallo, Leroy?«
Charlotte. Er verzichtete auf eine Begrüßung.
»Ich bin auf Sainte-Marie. Ich werde Ihnen später alles erklären. Hören Sie, die Spur scheint abzureißen. Ich kann weitermachen, doch viel Hoffnung habe ich nicht. Ich wollte Sie nach Ihrer Meinung fragen.«
Im Hintergrund eine Männerstimme:
»Wer ist dieser Kerl?«
»Halt den Mund. Sind Sie noch dran?«
»Ich fürchte, die Verbindung wird …«
»Ich will ihn unbedingt wiederfinden, es ist sehr wichtig für mich, verstehen Sie?«
»Ja oder nein?«
»Machen Sie weiter. Noch vier Tage. Keinen Tag länger. Ich habe nicht genug Geld …«
Die Verbindung brach ab.
Dag verstaute den von nun an nutzlosen Apparat in seiner Tasche. Vier Tage – um was zu tun? Er wandte sich seinem kaum gewürzten und mittlerweile kalt gewordenen Reisteller zu. Offenbar pflegte Charlotte weitaus engere Kontakte zu Vasco Paquirri, als sie Dag gegenüber zugegeben hatte. Doch das änderte nichts an der Tatsache, daß Eloise Martinet gestorben und er selbst todmüde war. Im Moment blieb ihm nichts anderes, als ein Hotel zu suchen und zu hoffen, daß ihm am nächsten Morgen etwas einfallen würde.
Mit einem rätselhaften Gesichtsausdruck legte Charlotte auf. Der Mann hinter ihr zuckte mit den Schultern.
»Es hat doch keinen Zweck, du verplemperst nur dein Geld, Schatz!«
»Es ist mein Geld, und ich tue damit, was ich will.«
Vasco Paquirri hob die Augen zum Himmel. Diese Frau war völlig übergeschnappt! Ihr ganzes Geld zu vergeuden, bloß um einen Kerl wiederzufinden, der schnell einmal ihre Mutter gebumst und sich anschließend aus dem Staub gemacht hatte! Als wüßte er, wer sein Vater ist … Er bewegte seine fünfundvierzig Kilo braungebrannter Muskeln zur Friseurkommode, die in einer Ecke der weiträumigen und mit Mahagoniholz ausgekleideten Kabine stand, und setzte sich auf den kleinen Puff aus cremefarbenem Satin. Währenddessen stand Charlotte regungslos neben dem großen Bett, das ebenfalls mit cremefarbenem Satin bedeckt war, und kaute nervös an ihren Fingernägeln. Träge plätscherte das Wasser um den weißen Rumpf der Grand Banks 58.
»Du quälst dich und quälst dich, aber wozu eigentlich?«
»Das kapierst du nicht. Du bist bloß ein blödes Arschloch von Gangster, dem alles scheißegal ist. Deine Mutter war eine Nutte, kein Wunder also …«
Vasco grinste breit in den Spiegel, bevor er auf spanisch antwortete:
»Versuch nicht, mich wütend zu machen, dazu habe ich heute abend absolut keine Lust.«
Er ergriff eine Bürste und begann, seine dichten schwarzen Haare zu kämmen. Gleichzeitig betrachtete er wohlgefällig das Spiel seiner Muskeln, seine dunkle schimmernde Haut und sein schönes Gesicht, das an einen aztekischen Würdenträger erinnerte.
»Du Hurensohn! Du weißt nicht einmal, was es bedeutet, wütend zu werden. Du bist gar kein Mann, du bist bloß ein impotentes Arschloch!«
Charlotte hatte sich ihm genähert und musterte ihn voller Verachtung.
»Wenn du Streit mit mir suchst, Charlotte, bitte schön!«
»Los, fang an, komm doch! Beweg dich ein bißchen, du Fettsack!«
Sie verpaßte ihm einen kräftigen Stoß, doch er bewegte sich keinen Millimeter von der Stelle. Statt dessen schlug er ihr, ohne sein selbstzufriedenes Lächeln aufzugeben, die Bürste mit aller Wucht ins Gesicht. Sie fiel nach hinten auf das Bett, wobei ihr Kimono aus weißer Seide ihre nackten Schenkel entblößte. Immer noch lächelnd ging er auf sie zu.
»Scher dich zum Teufel! Ich habe morgen einen Fototermin. Sieh dir das an! Wegen dir werde ich völlig verunstaltet sein!« schrie sie ihn an und befühlte mit der Hand den bläulichen Bluterguß, der sich zwischen dem Auge und der Schläfe zu bilden begann.
Während Vasco die Bürste in der einen Hand langsam hin und her bewegte, näherte er sich Charlotte und zwang sie mit der anderen Hand, sich umzudrehen. Dann schob er ihren Kimono beiseite, beugte sich über sie, ließ die harten Bürstenhaare über ihr zartes Fleisch gleiten und flüsterte ihr ins Ohr:
»Wieviel?«
»Mindestens fünfzig …«, murmelte Charlotte und vergrub das Gesicht in den Laken.
Vasco richtete sich auf, schwang seine üppige Haarpracht mit einer anmutigen Geste nach hinten, hob den Arm und begann, auf Charlotte einzuschlagen.
3. KAPITEL
Dag fuhr aus dem Schlaf hoch. In seinem Traum war Eloise Martinet vor ihm gestanden. Sie hatte ihm zugelächelt, ihre leblosen Augen hatten ihn angestarrt, ohne ihn zu erkennen, und ihre faltige Hand war sanft über sein krauses Haar gestrichen. Und mit mitleidiger Stimme hatte sie zu ihm gesagt: »Wie dumm du manchmal bist, mein armer Dagobert …« Er hatte sich gewehrt, um ihrer Liebkosung zu entkommen.
Quietschend drehte sich der Ventilator an der Decke. Es war stockfinster, doch er wußte ganz genau, wo er sich befand: in der Auberge de l’Arbre à pain, in der Nähe des Strandes. Er hörte, wie die Wellen auf dem Strand ausliefen. Er hatte keine Lust, Licht zu machen. Tastend suchte er nach seinen Zigaretten und hätte um ein Haar das Glas Wasser umgestoßen, das auf dem Nachttisch stand. Warum, zum Teufel, hatte Madame Martinet ihm einen nächtlichen Besuch abgestattet? Daß sie in seinen Armen gestorben war, hatte ihm offensichtlich stärker zugesetzt, als er geglaubt hatte. Dabei war er an den Tod gewöhnt. Als er seine zur Hälfte gerauchte Zigarette ausgedrückt hatte, beschloß er weiterzuschlafen. Das Laken kam ihm feucht und schwer vor, und er warf es weit von sich. Dennoch wälzte er sich von einer Seite auf die andere, und erst im Morgengrauen schlief er erneut ein.
Gegen neun Uhr wurde er wach, mit schwerem Kopf, geschwollenen Augen und einem Gähnen, das seinen Kiefer auszurenken drohte. Er trank eine Tasse Kaffee auf der Terrasse vor seinem Zimmer. Lester würde sich freuen, seine Spesenrechnung in Empfang zu nehmen. Bei einem Zimmerpreis von fünfhundert Francs pro Nacht würde er froh sein, ihn so rasch wie möglich wieder bei sich zu haben. Am Strand tummelten sich schreiende Mädchen in knappen Bikinis. Dag kam sich richtig alt vor, als er sie bei ihrem koketten Gehabe beobachtete. Er mußte daran denken, wie er sich am Strand von St. Kitts an Helen herangemacht hatte. Helen kümmerte sich damals um den Wassersport-Klub einer Hotelanlage. Täglich hatte Dag ein Surfbrett gemietet und die schwierigsten Figuren vollbracht, um ihr zu imponieren. Eines Nachmittags sagte sie zu ihm: »Hören Sie, warum laden Sie mich nicht einfach zum Abendessen ein? Das ist weniger anstrengend.«