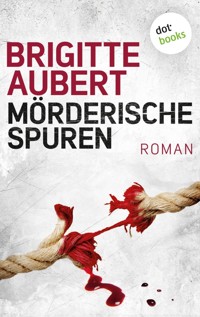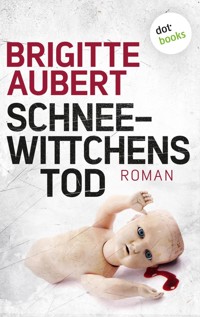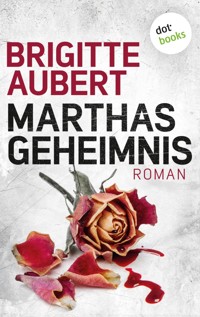4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Élise Andrioli
- Sprache: Deutsch
Die außergewöhnliche Elise Andrioli ermittelt wieder: "Tod im Schnee" von Brigitte Aubert als eBook bei dotbooks. Erholung in den Bergen ist genau das, was Elise jetzt braucht. Mit dabei ist wie immer ihre Pflegerin Yvette, denn seit einem Bombenattentat ist Elise gelähmt, blind und stumm. Doch auch in den französischen Alpen findet Elise keine Ruhe, sondern wird mit rätselhaften Ereignissen konfrontiert: Jemand legt ihr ein Päckchen schockierenden Inhalts in den Schoß, ein toter Vogel wird in ihr Zimmer geworfen, und schließlich wird sie am Telefon sogar Zeugin eines brutalen Mordes. Aus Angst, das nächste Opfer zu sein, will Elise sofort abreisen. Unerwartet heftige Schneefälle machen eine Flucht jedoch unmöglich – und so ist ihr messerscharfer Verstand gefragt, um sich selbst und Yvette vor einem Mörder zu retten, der zu allem bereit ist … Jetzt als eBook kaufen und genießen: "Tod im Schnee" von Brigitte Aubert. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 477
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Über dieses Buch:
Erholung in den Bergen ist genau das, was Elise jetzt braucht. Mit dabei ist wie immer ihre Pflegerin Yvette, denn seit einem Bombenattentat ist Elise gelähmt, blind und stumm. Doch auch in den französischen Alpen findet Elise keine Ruhe, sondern wird mit rätselhaften Ereignissen konfrontiert: Jemand legt ihr ein Päckchen schockierenden Inhalts in den Schoß, ein toter Vogel wird in ihr Zimmer geworfen, und schließlich wird sie am Telefon sogar Zeugin eines brutalen Mordes. Aus Angst, das nächste Opfer zu sein, will Elise sofort abreisen. Unerwartet heftige Schneefälle machen eine Flucht jedoch unmöglich – und so ist ihr messerscharfer Verstand gefragt, um sich selbst und Yvette vor einem Mörder zu retten, der zu allem bereit ist …
Über die Autorin:
Brigitte Aubert gehört zu Frankreichs profiliertesten Spannungsautorinnen. Neben Kriminalromanen und Thrillern schreibt sie Drehbücher und war Fernsehproduzentin der erfolgreichen »Série noire«. 1996 erhielt sie den französischen Krimipreis. Heute lebt sie in Cannes und führt ein altes Kino, das sie von ihren Eltern übernommen hat.
Bei dotbooks erscheinen auch:
Die vier Söhne des Doktor March
Marthas Geheimnis
Sein anderes Gesicht
Schneewittchens Tod
Der Puppendoktor
Nachtlokal
Tod im Schnee
***
eBook-Neuausgabe Januar 2018
Copyright © der französischen Originalausgabe 2000 by Editions du Seuil
Die französische Originalausgabe erschien 2000 unter dem Titel La Mort des Neiges bei Editions du Seuil, Paris
Copyright © der deutschen Ausgabe 2001 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2017 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Edward Fielding
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (sh)
ISBN 978-3-95824-968-4
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Tod im Schnee an: [email protected]
Gerne informieren wir Sie über unsere aktuellen Neuerscheinungen und attraktive Preisaktionen – melden Sie sich einfach für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Brigitte Aubert
Tod im Schnee
Roman
Aus dem Französischen von Eliane Hagedorn und Bettina Runge
dotbooks.
»Man baut Häuser für Verrückte, um die, die nicht darin eingesperrt sind glauben zu machen, sie wären noch bei Verstande.«
– MONTAIGNE
PROLOG
Es regnet. Ein heftiger, dichter Regen, der an die Scheiben prasselt …
Halt! Nein! Das war in dem Roman, der von den dramatischen Ereignissen in Boissy-les-Colombes berichtet. Die abscheulichen Kindermorde vor zwei Jahren. Das hat damals vielleicht Staub aufgewirbelt! Die Journalisten stürzten sich auf Boissy wie Fliegen auf einen Kuhfladen. Und da das Rätsel durch meine Mithilfe aufgeklärt werden konnte, bin ich interviewt worden und sogar ins Fernsehen gekommen.
Und dann habe ich meine Geschichte an eine Krimiautorin verkauft, die sie unter dem Titel Im Dunkel der Wälder herausgebracht hat. Das war ein Trubel!
Heute ist es in der Stadt wieder friedlich geworden. Wir lecken unsere Wunden. Versuchen zu vergessen. Doch sobald ein Kind eine Viertelstunde zu spät nach Hause kommt, bleibt seiner Mutter das Herz stehen.
Was mich an den Roman hat denken lassen, ist der Regen. Ein heftiger Regen … Stopp.
Ich fahre mit meinem elektrischen Rollstuhl zum Fenster und drücke die Stirn an die kühle Scheibe. Es ist Januar. Wenn es heute Nacht weiter regnet, könnte sich der Regen in Schnee verwandeln. Ich habe Lust, den Geruch von Schnee einzuatmen. Ich freue mich schon darauf, in wenigen Tagen in die Berge zu fahren.
Ich würde gern den Garten sehen. Ich liebe den Anblick von winterlichen Gärten im strömenden Regen.
Aber ich sehe nichts. Wie all jene wissen, die den Roman gelesen haben, wurde ich vor knapp drei Jahren Opfer eines Attentats in Irland und bin seither gelähmt, blind und stumm. Bis vor einem Jahr konnte ich mich nur mit Hilfe meines linken Zeigefingers verständlich machen, was die Dinge natürlich nicht gerade erleichtert hat.
Nach einer letzten Operation habe ich die Beweglichkeit meines ganzen linken Arms wiedererlangt. Nicht aber die Sehkraft, und auch nicht die Sprache.
»Was machen Sie da am Fenster? Sie werden sich noch erkälten!«, ruft Yvette, die hinter mir aufgetaucht ist.
Ich hebe beschwichtigend die Hand.
»Wie Sie wollen! Monsieur Tony hat angerufen«, fügt sie hinzu. »Die Verbindung war schlecht, die See war sehr unruhig. Er lässt Sie grüßen.«
Yvette mag Tony nicht. Sie nennt ihn ganz bewusst »Monsieur«. Aber Tony schert sich nicht darum, ob man ihn mag oder nicht.
Ich stelle ihn mir auf einem gischtumsprühten Deck vor. Das heißt, ich stelle mir einen Mann vor, den ich nur über meinen Tastsinn kenne.
Ich weiß immer noch nicht, wie er aussieht, da ich ihn erst nach dem Unfall kennen gelernt habe.
Eine sonderbare Vorstellung, dass mich eine Menge Leute im Fernsehen gesehen haben, wie ich auf Fragen geantwortet habe, indem ich die Hand hob und senkte, so wie wir als Kinder »Alle Vögel fliegen hoch« gespielt haben.
Elise Andrioli, der Star mit den eisernen Beinen im Trommelfeuer der Journalisten: »Wie haben Sie dieses Rätsel lösen können, wo Sie doch an den Rollstuhl gefesselt sind?« – »Ist eine Serie ›Die eiserne Frau‹ in Vorbereitung?« – »Werden Sie Tony Mercier heiraten?«
Nein, ich habe Tony nicht geheiratet. Ich hatte keine Lust, mich in eine neue Liebesgeschichte zu stürzen, bevor ich mir nicht unserer gegenseitigen Gefühle sicher bin, wie »Die Sprechstunde des Herzens« es mir raten würde. Außerdem hat Tony mich nicht gebeten, seine Frau zu werden. Er hat seinen ersten Beruf – vor dem Alkohol – wieder aufgenommen: Matrose in der Handelsmarine, und er ist die ganze Zeit unterwegs. Seine Tochter Virginie besucht ein Internat in Paris, das darauf spezialisiert ist, Kinder mit schwerem Trauma therapeutisch zu betreuen.
Auch Yvette, meine Gesellschafterin, hat den Klempner Jean Guillaume nicht geheiratet, obwohl die beiden im siebten Himmel sind. »Was hat das für einen Sinn, in unserem Alter noch aufs Standesamt zu gehen? Außerdem liebe ich meine Unabhängigkeit«, hat sie mir anvertraut. Jean, der ein verträglicher Mensch ist und selbst seine kleinen Junggesellen-Gewohnheiten hat, ist mit dem Arrangement völlig einverstanden: Yvette wohnt weiterhin bei mir; sie verbringen all ihre Freizeit zusammen, und Jean schläft ein- oder zweimal die Woche bei uns.
Im Augenblick ist er nicht in der Stadt. Er hat einen Großauftrag in der Bretagne ergattert: Die Wasserleitungen und Sanitäranlagen eines riesigen alten Herrenhauses sollen erneuert werden.
Ah, das Telefon!
»Für Sie!«, ruft Yvette.
Ich steuere den Rollstuhl zum Telefon. Yvette hält mir den Hörer ans Ohr.
»Hallo, Elise. Hier ist B* A*.«
Na, so ein Zufall! Meine Autorin.
»Ich erlaube mir, Sie anzurufen, weil ich Post für Sie erhalten habe. Ich faxe sie Ihnen«, sagt sie.
Ich klopfe mit dem Zeigefinger auf den Hörer, was so viel wie »okay« bedeutet. Zweimal klopfen heißt »nein«.
»Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Bis bald, ich bin in Eile. Ich umarme Sie.«
Du kannst mich umarmen mit all dem Geld, das ich dir eingebracht habe … Wer aber wäre fast bei lebendigem Leib verbrannt, wer hatte schon das Messer an der Kehle? Ich! Du hast nur deinen Stift genommen und hopp … Her mit dem Zaster!
Das Faxgerät summt. Yvette reißt das Blatt ab und überfliegt es.
»Ich verstehe kein Wort«, murmelt sie.
Ich werde unruhig. Wird sie mir endlich dieses verdammte Fax vorlesen? Wann gibt es endlich Faxe in Blindenschrift. Ich habe sie gelernt und komme schon ganz gut zurecht.
»Ich lese es Ihnen vor.« Das wird aber auch Zeit!
»Liebes Fräulein Andrioli, Sie können vielleicht die Öffentlichkeit täuschen, aber nicht mich. Sobald ich Sie im Fernsehen gesehen habe, war mir alles klar. Sie sind ein Engel.«
Donnerwetter! Wie hat er das erraten?
»Einer von diesen Engeln, die von Gott geschickt werden, damit sie die Legionen des Bösen bekämpfen. Ich erkenne sie immer an ihrem dümmlich selbstzufriedenen Ausdruck.«
Also, ich muss schon sagen …
»Verstehen Sie das?«, murmelt Yvette und fährt fort: »›Ich bin machtlos dagegen: Sobald ich einen Engel sehe, fühle ich, wie sich in meinem Innern alle Dämonen erheben. Sie besteigen und reiten mich, und der gebieterischste unter ihnen heißt Lust. Ich hoffe, Lust wird mich zu Ihnen führen. Hochachtungsvoll, Ihr C. A. Nibal.‹Da hat sich wohl jemand einen Scherz erlaubt«, meint Yvette und zerknüllt das Blatt.
Ich greife zum Notizblock, den ich immer auf dem Schoß liegen habe, und kritzele hastig: Bitte B* A* anrufen und fragen, woher dieser Brief kommt.
»Wie Sie meinen. Aber wenn wir auf alle Spinner reagieren wollten, die Ihnen schreiben …«
Ich bin vorsichtig. Ich möchte mich lieber vergewissern. Ich möchte nicht zur Zielscheibe der Wahnvorstellungen eines frei herumlaufenden Psychopathen werden.
»Hallo, ja, guten Tag, hier ist Yvette Holzinski. Kann ich mit B* A* sprechen, bitte? Aha, na, da kann man nichts machen … Danke und auf Wiederhören.«
Yvette legt auf.
»Wir haben sie um fünf Sekunden verpasst. Sie wartete, als sie anrief, gerade auf ihr Taxi. Sie fliegt nach Japan. Auf Lesereise. Gut … Soll ich uns einen Tee kochen?«
Ich nicke zerstreut. »C. A. Nibal.« Er scheint mir ganz schön gestört zu sein, unser C. A. Nibal.
Schweigend trinken wir unseren Tee. Yvette ist gereizt, weil Jean bei der Dreierwette groß eingestiegen ist und alles verloren hat. Er ist besessen vom Pferdelotto und von allen möglichen Rubbellosen. Er kauft mir immer welche. Ich habe noch nie gewonnen. Doch ein Mal: zehn Franc, die habe ich Virginie geschenkt.
Ich werde sehr aufgeregt bei der Vorstellung, in die Berge zu fahren. Nicht um an den paraolympischen Rollstuhl-Slalom-Wettkämpfen teilzunehmen, ganz gewiss nicht, aber mein Onkel Fernand, der in Nizza lebt, war so nett, mir sein Chalet in Castaing, einem kleinen familiären Wintersportort im Hinterland, anzubieten. Gute Luft, Spazierfahrten im Rollstuhl durch den frischen Schnee … In zwei Tagen brechen wir auf. Die Männer und Virginie kommen im Februar in den Ferien nach. Ich bin ungeduldig. Yvette hat schon dreimal die Koffer aus- und wieder eingepackt, um sicher zu sein, dass sie nichts vergessen hat. Fäustlinge, Socken, Thermounterwäsche, wir sind bereit für den Annapuma.
Weniger witzig ist dieser verrückte Brief. Yvette hat Recht, es ist sicher nur ein Scherz. Da sich Krimileser immer für besonders schlau halten, hat sich einer von ihnen wohl gedacht: »Wie wär’s, wenn ich diesem armen Krüppel mal einen ordentlichen Schreck einjage … Mal sehen, ob sie wirklich so tough ist.« Ich stelle ihn mir als notorisch Frustrierten vor, einen weißen Seidenschal sorgsam um den Hals gebunden, an den Füßen riesige Treter, wie sie die Pfaffen tragen, um die Schulter eine Umhängetasche voll mit unleserlichen Manuskripten. Ganz hinten in einem Pariser Bistro raucht er gelbe Gitanes mit Maispapier, befummelt seine Fieberbläschen und feixt, während er meine Abenteuer liest, mit überlegener Miene. Aber ich, ich komme im Fernsehen, und er, er kratzt seine Münzen zusammen, um seinen ekelhaften Kaffee zu bezahlen – ein zweiter Aufguss, der wie Spülwasser schmeckt.
KAPITEL 1
Da bin ich also. Wie eine Königin throne ich am Fuß der Pisten, bis zur Nasenspitze eingemummt. In diesen Dingen ist Verlass auf Yvette; sie hat mich in meinen alten blauen Skianzug gesteckt, dazu in knallrote Moonboots von meinem Onkel, und hat mir eine schwarze Kosakenmütze auf den Kopf gestülpt. Die Ohrklappen aus Schaffell jucken, ich bin schweißgebadet. Die Sonne brennt, doch es kommt nicht in Frage, mich um einen Webfaden zu erleichtern. Yvette passt auf und zieht meine Decke zurecht, sobald sie um einen Millimeter verrutscht. Dabei kommentiert sie die Ereignisse.
»Da hat einer vielleicht einen Sturz gedreht, und er hat den Baum nur um Haaresbreite verfehlt … Und der andere auf seinem Snowboard, eine echte Gefahr für die Menschheit … Ein Schluck Tee?«
Verneinendes Handzeichen. Wir sitzen auf der Terrasse des Chalet Canadien, dem strategischen Mittelpunkt des Ortes. Alle Zweibeiner auf Urlaub müssen irgendwann einmal hier vorbei. Ich strecke heimlich die Hand nach meiner Kosakenmütze aus, und sofort ertönt Yvettes schneidende Stimme:
»Kommt nicht in Frage! Die Kälte dringt doch vor allem durch die Ohren ein. Das wäre was, wenn Sie sich hier eine Grippe einfangen würden!«
Ich bekomme keine Grippe, und das Thermometer zeigt fünf Grad plus, das habe ich vorhin im Radio gehört. Aber Yvette verständlich machen, dass wir nicht in der sibirischen Tundra biwakieren, geht über meine Kräfte. Und mir ist nicht nach Diskussionen zumute.
Die Luft hallt wider vom metallischen Klicken der Skilifte, ich höre Gelächter und Kinderrufe. Ein Baby weint. Seine Mutter versucht es zu überzeugen, dass es keinen Grund zum Weinen gibt. Es geht mir gut. Ich habe den Eindruck, mich mit frischer Luft vollzupumpen. Ich werde braun gebrannt und gesund aussehen. Ich taste nach meiner Tasse und führe sie zum Mund.
»Elise Andrioli! Sie sind Elise Andrioli, nicht wahr?«, ruft eine Frau hinter mir.
Ich zucke zusammen und verschütte den Tee.
»Ich bin Francine Atchouel, vom CLMPAH«, fährt sie fort. CLMPAH? Was ist das?
»Ihr Onkel hat mir gesagt, dass Sie kommen. Ich habe Sie auf der Stelle erkannt.«
Das dürfte wohl nicht allzu schwierig sein: Ich denke nicht, dass es hier in der Gegend Scharen von hinreißenden jungen Blinden in elektrischen Rollstühlen gibt.
»Entschuldigen Sie, aber Mademoiselle Elise kann Ihnen nicht antworten«, bemerkt Yvette vorwurfsvoll.
»Ich weiß, ich weiß. Monsieur Andrioli hat es mir erklärt. Er ist so nett, Ihr Onkel. Er ist einer unserer wichtigsten Geldgeber.«
Wovon redet sie eigentlich?
»Er hat mir versichert, dass Sie bestimmt gern unser Zentrum besuchen und unsere Heimbewohner kennen lernen möchten. Sie sind ein Vorbild für sie … Sie müssen Madame Holzinski sein«, fährt sie zu Yvette gewandt fort, »ihre treue Mitarbeiterin.«
»So ist es. Ich hätte nicht gedacht …«, plustert sich Yvette geschmeichelt auf.
»Aber jeder hat von Ihnen gehört! Ich, zum Beispiel, habe das Buch allen meinen Freunden ausgeliehen. Was für eine schreckliche Geschichte! Umso schrecklicher, als es sich um eine wahre Geschichte handelt. Sie müssen grauenvolle Augenblicke durchgemacht haben. Oh, entschuldigen Sie, da kommt unser Transporter, ich muss mich beeilen. Hier meine Visitenkarte, rufen Sie an, damit wir einen Termin ausmachen können. Bye, bye!«
»Sie ist weg«, informiert mich Yvette. »Sie steigt in einen grünen Minibus mit gelber Aufschrift, die ich nicht entziffern kann. Sie hat uns ihre Visitenkarte dagelassen … Mal sehen … Hier: Francine Atchouel, Direktorin, und unten ›CENTRE LOISIRS MONTAGNE POUR ADULTES HANDICAPES‹
mit einer Telefonnummer.«
Ich beginne zu begreifen. Die gute Frau will mich ihren Schäflein als Beweis dafür vorführen, was man trotz einer Behinderung auf die Beine stellen kann. Und mein Mistkerl von Onkel hat mich natürlich nicht davor gewarnt. Auf alle Fälle ist das völlig idiotisch. Ich kann nicht sprechen und werde keinen Vortrag in der Taubstummensprache halten.
»Sie scheint nett zu sein«, meint Yvette, »aber ein bisschen … na ja … überschwänglich. Und dieser Wollpullover mit Rosenblüten, ganz ehrlich, der schmeichelt ihr nicht gerade. Er trägt eher auf, und da sie nicht eben dünn ist … Was halten Sie von einem Blaubeertörtchen?«
Ablehnende Handbewegung. Wir haben schon jeder zwei Crêpes verputzt, und ich mache nicht genug Gymnastik, um mir hemmungslos den Bauch vollschlagen zu können.
»Na gut, ich hole mir trotzdem eins«, beschließt Yvette und erhebt sich. »Die Bergluft macht hungrig.«
Es gelingt mir schließlich, einen Schluck von dem inzwischen kalten Tee zu trinken. Fröhliche Stimmen junger Leute. Schulterklopfen, Schreie. Auch ich bin früher die Hänge hinuntergebrettert, rot vor Kälte und Vergnügen. Ich spüre noch die Anspannung in meinen Fußgelenken. Die Erschütterungen auf den Buckelpisten, das berauschende Gefühl der Geschwindigkeit. Mit Benoît habe ich Langlauf angefangen – lange Wanderungen durch glitzernden Pulverschnee. Und Snowboard auf den Übungshängen. Im Keller muss immer noch die nagelneue Ausrüstung stehen. Wir hatten sie kurz vor … vor dem Unfall erstanden. Schluss damit. Es ist wie lebenslänglich, nur dass die Zelle der eigene Körper ist. Halt, stopp, keine negativen Gedanken, ich will doch nicht in aller Öffentlichkeit zu heulen anfangen.
»Elise …«
Eine Stimme zu meiner Linken, sanft, flüsternd. Noch ein Bekannter, der unvermutet aufkreuzt?
»Elise …«
Ich hebe die Hand, um kundzutun, dass ich gehört habe. »Ich habe ein Geschenk für Sie«, fährt die Stimme fast zärtlich fort.
Ein Verehrer? Ich spüre eine Hand die meine berühren, trockene, warme Haut. Meine Finger werden um das Ende eines Plastikbeutels geschlossen.
»Bis später …«
Ich sitze überrascht da, den Beutel in der Hand.
»Sie hätten doch eines nehmen sollen; das Törtchen sieht köstlich aus!«
Yvette lässt sich in den Sessel sinken.
»Was ist denn das für ein Beutel?«
Ich reiche ihn ihr und kritzele auf meinen Block: Hast du jemanden mit mir sprechen sehen?
»Aber … Wenn jemand mit Ihnen gesprochen hat, dann müssten Sie’s doch wissen!«, gibt sie mit vollem Mund zurück. »Nein, ich habe niemanden gesehen, na ja, kein Wunder bei diesem Gewimmel … Was ist das denn überhaupt? Ein Geschenkpäckchen! Jemand hat Ihnen ein Geschenk gemacht?«
Ich schreibe hastig: Ja, aber ich weiß nicht, wer. Öffne es.
Rascheln von Papier.
»Na, so was! Das ist ja völlig verrückt. Ein Steak in Plastikfolie! Was für eine Idee, ein Steak wie ein Geschenk einzuwickeln! Oder überhaupt, ein Steak zu schenken!«
Ein Steak?
Verwirrt erkundige ich mich: Was für eine Art von Steak?
»Rotes Fleisch, dick und blutig. Ich hoffe, es ist französisches Fleisch. Wir sollten es vielleicht besser wegwerfen. Oder wir geben es den Hunden. Ich möchte kein Fleisch essen, von dem ich nicht weiß, wer es Ihnen gegeben hat. Ein Steak! Also wirklich, ein starkes Stück …«
Mein Verstand arbeitet auf Hochtouren. Jemand hat mir ein Steak geschenkt, ohne seinen Namen zu nennen. Er hat sich Yvettes Abwesenheit zu Nutze gemacht, er will also anonym bleiben. Aber was steckt hinter diesem Scherz, wenn es denn einer ist?
Will man mir vielleicht eine Mitteilung überbringen? Ein Rätsel, dessen erstes Element das Steak ist? Ja, die Skiorte sind voll von Spaßvögeln, die den armen, sich langweilenden Behinderten mit Rätseln in 3D die Zeit vertreiben. Bezahlt vom Fremdenverkehrsamt, um für Stimmung zu sorgen. Das ist geglückt, ich langweile mich überhaupt nicht mehr. Ich habe sogar richtig Angst.
»Halt! Hier ist ein Aufkleber!«, ruft Yvette. »Ihr Metzger wünscht Ihnen einen guten Aufenthalt.« Für Werbung greifen die heutzutage wirklich zu allen Mitteln.
Uff, das Geheimnis wäre gelüftet. In zwei Jahren habe ich meine Dosis an Abenteuern gehabt, und alles, was vom Üblichen abweicht, bringt mich leicht aus dem Gleichgewicht, sagt mein Psy, mein Psychotherapeut.
Er ist praktisch, mein Psy: Ich kann ihn überallhin mitnehmen. Ich habe ihn mir eines Tages, als ich wirklich Lust hatte, Schluss zu machen, vor meinem geistigen Auge erschaffen. Ein großer Typ in weißem Kittel mit einem passenden Bart, eine Mischung aus Gott und Weihnachtsmann, in einem riesigen Ledersessel. Er hört mir aufmerksam und wohlwollend zu. Denn mit ihm kann ich sprechen. Die Worte sprudeln aus mir heraus wie früher. Und ich sehe. Ich sehe ihn, ich sehe das Fenster hinter ihm, den blauen Himmel, die Wolken. Und ich kann mich bewegen. Ich schlage die Beine übereinander. Ich ziehe meinen Rock zurecht. Ich bewege die Zehen in meinen Schuhen. Und Psy gibt Antworten und ermutigt mich und redet mir gut zu, nicht zu verzweifeln. Danke, Psy.
Yvette reißt mich aus meinen Tagträumereien und kündigt an, es sei Zeit zum Aufbruch, die Sonne stehe schon tief. In ihren Augen ist es hier nach Sonnenuntergang schlimmer als in Transsilvanien: Alle unvorsichtigen Fußgänger laufen Gefahr, zu erfrieren oder bei lebendigem Leib von Rudeln von Werwölfen verschlungen zu werden. Zum Glück werden wir im Warmen sein, vor dem Kaminfeuer in unserem Chalet.
Das Feuer knistert wohltuend. Ich fühle mich ein wenig benommen. Der Rest des Nachmittags ist wie im Flug vergangen. Kaum habe ich meine Muskelübungen absolviert, sitzen Yvette und ich vor dem Fernseher und machen bei einem Quiz mit. Yvette gewinnt immer. Ich frage mich, wie meine Schrift wohl aussieht, meine neue Schrift müsste ich sagen, da ich mit der linken Hand neu lernen musste zu schreiben, ohne meine Fortschritte sehen zu können.
Stundenlange Übungen. Anfangs schien Yvette ratlos. Und eines Nachmittags rief sie dann plötzlich: »Geschafft! Ich kann lesen! Sie haben Hunger? Pech gehabt, es ist noch nicht so weit.«
Ich muss lächeln. Ich fühle mich wohl.
Nach einer positiven Geschmacksprobe haben wir schließlich das Steak mit Dampfkartoffeln gegessen, begleitet von einem Côtes de Nuit. Jetzt ist Yvette in der Küche beim Spülen. Telefon. Da ich mich neben dem kleinen Tischchen befinde, taste ich nach dem Hörer und hebe ab.
»Mein Engel …«
Tony! Freude durchströmt mich, aber nur kurz: Es ist nicht Tonys Stimme. Es ist eine süßliche Stimme, eine Stimme, die ich heute Nachmittag schon vernommen habe.
»Mein Engel, hast du’s schon probiert? War’s gut? Zart und saftig? Wie dein Herz?«
»Wer ist es?«, fragt Yvette.
»Bis bald.«
Er hat aufgelegt. Ich schneide eine Grimasse in Yvettes Richtung, um kundzutun, dass ich nicht weiß, wer am Apparat war.
»Da hat sich wohl jemand verwählt«, versichert sie mir. »Gut, ich will mal das Bett vorbereiten.«
Wir mussten das Schlafzimmer herrichten, damit ich mich problemlos darin aufhalten kann. Das Bett, die Kissen gegen das Wundliegen, die Schüssel, der Galgen, an dem ich mich in eine sitzende Position hochziehen kann … Ein wahrer Palast für Behinderte.
Wer mag dieser Typ sein? Auf alle Fälle nicht der Metzger, dieser nette dicke Kerl mit der Donnerstimme. Ist es Zufall, dass ich vor wenigen Tagen eine rätselhafte Nachricht, signiert mit »C. A. Nibal«, erhalten habe, der mich mit Engel tituliert, als wäre es eine Beleidigung, und dass ich heute ein Steak geschenkt bekomme, bevor man mich anruft und mich »mein Engel« nennt? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um einen solchen Zufall handelt? Wenn es kein Zufall ist, bedeutet es, dass Mister C. A. Nibal meiner Spur gefolgt ist. Dass er mich kennt. Dass er von meinem Urlaub hier wusste. Dass er mich beobachtet. Und dass er mit leidenschaftlicher Stimme »mein Engel« zu mir sagt. Seit meinem Unfall werden die Leute nicht müde, mir zu sagen, dass sie mich lieben. Man könnte meinen, dass sie, als ich mich noch bewegen und ausdrücken konnte, Angst vor mir hatten.
Mir behagt dieser Anruf nicht. Ganz und gar nicht.
KAPITEL 2
Nach dem Frühstück schiebt mich Yvette durch die Hauptstraße, um die tägliche Einkaufszeremonie zu absolvieren. Ich komme mir vor wie eine Kaiserin, die die Parade abnimmt. Wir begeben uns unverzüglich zum Metzger, und Yvette parkt mich vor dem Schaufenster. Ich sehe mich im Geist von Kalbs- und Wildschweinköpfen eingerahmt. Kinder liefern sich mit lautem Geschrei eine Schneeballschlacht. Das ist nett, aber gefährlich, und ich fürchte … Zack! Da haben wir’s schon. Ein Volltreffer ins Gesicht. Wilde Flucht der kleinen Truppe. Schnee, der mir über Wangen und Kinn rinnt. Mit der gesunden Hand wische ich ihn weg.
»Er war’s nicht!«, ruft Yvette und übernimmt wieder den Rollstuhl. »Er weiß nichts von dem Steak. Ich hab’s Ihnen ja gesagt, wir hätten es nicht essen dürfen. Bei all den wahnsinnigen Rindern …«
Ich stelle mir Yvette einen Augenblick vor, wie sie im Zickzack springt und misstönend muht.
»Was lachen Sie? Ach, da ist die Dame von gestern, Sie wissen schon. Die von den Behinderten …«
»Guten Morgen, verehrte Madame Holzinski, guten Morgen, Mademoiselle Andrioli!«, ertönt die Stimme mit dem Pariser Akzent. »Ich hoffe, Sie erweisen uns die Ehre, heute Nachmittag zum Tee zu kommen. Um fünf? Ich zähle auf Sie. Sie würden uns eine große Freude bereiten.«
Yvette wartet auf meine Order. Ich unterdrücke ein Seufzen und kritzele »Gern«.
»Ach, Sie können schreiben, das ist ja großartig! Also um Punkt fünf. Der Minibus holt Sie vor dem Fremdenverkehrsamt ab. Bis später!«
Yvette brummt etwas über die Dreistigkeit der Leute und schiebt mich bis zum kleinen Supermarkt. Dort braucht sie eine gute Viertelstunde, und ich kann unterdessen ein Sonnenbad nehmen.
Hecheln zu meiner Linken, dann eine raue Zunge, die meine Hände leckt.
»Tintin, lass das! Er ist noch jung, wissen Sie … Er darf nicht mit in den Laden. Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn ich ihn hier bei Ihnen lasse?«, fragt eine sehr sanfte weibliche Stimme.
Schweigen. Ich suche meinen Stift, der mir zwischen die Knie gerutscht ist. Die Frau beginnt zu verstehen.
»Oh, entschuldigen Sie, ich hatte nicht gesehen, dass … ich wollte sagen … Das macht nichts, ich binde ihn an die Stange. Es ist ein Labrador«, fügt sie hinzu. »Er ist schwarz.«
Warum klingt ihre Stimme so traurig?
Ich hebe die Hand, fühle dichtes Fell, eine feuchte Nase.
Die Frau entfernt sich, der frische Schnee knirscht unter ihren Sohlen. Der Hund legt die Schnauze auf meine Knie und stößt einen langen Seufzer aus. Ja, mein Alter, so ist das. Man hat draußen zu warten und brav zu sein. Ich kraule ihn zwischen den Ohren, er leckt meine Hand. Plötzlich möchte ich einen Hund haben. Und eine Katze. Und einen Papagei, der mich unterhält. Ich muss mit Yvette darüber »sprechen«.
Ach, die Sonne ist verschwunden. Dem Hund sträubt sich das Fell, und er beginnt leise zu knurren. Das musste natürlich mir passieren. Der einzige Labrador im Dorf, der Behinderte attackiert. Ich ziehe langsam die Hand zurück, er beruhigt sich. Die Sonne ist wieder da. Dieses Tier ist vielleicht gegen Wolken allergisch. Ich zögere, ihn erneut zu streicheln, doch er schiebt seine Schnauze beharrlich in meine Hand. Ganz in der Nähe die Stimme eines alten Mannes:
»Die Welt ist verrückt, sage ich Ihnen.«
»Sie soll einer Sekte angehört haben«, erwidert eine andere zittrige Männerstimme.
»Sie glauben, deswegen wurde sie gekreuzigt? Ein satanisches Opfer?«
»Wahrscheinlich Rauschgiftsüchtige! Wegen den Drogen wissen sie nicht mehr, was sie tun.«
Die beiden alten Männer entfernen sich plappernd. Ich grabe meine Finger ins Fell des Labradors, fest entschlossen, mir durch solch finstere Nachrichten nicht die Laune verderben zu lassen.
»Ich dachte schon, die Schlange nimmt kein Ende! Was machen Sie mit diesem Hund?«
Im selben Augenblick ertönt die traurige Stimme:
»Ich danke Ihnen. Ich hoffe, es hat nicht zu lange gedauert. Komm, Tintin, wir gehen. Auf Wiedersehen.«
Der Hund stößt ein beglücktes »Wuff« aus und entfernt sich. Yvette beugt sich zu mir herab und murmelt:
»Es ist eines von den Mädchen, die in der Diskothek arbeiten, eine Blondine mit Haaren bis zur Taille und einem Minirock. Mitten im Winter! Und wie sie sich bewegt, das beschreibe ich Ihnen lieber nicht. In Entrevaux hat es gestern Nacht einen Mord gegeben«, fährt sie ganz aufgeregt fort. »Ich habe eine Zeitung gekauft. Wir wollen uns irgendwo in eine Ecke setzen.«
Entrevaux ist ein kleines Dorf in der Nähe, ein friedlicher Ort, wo ein Mord in der lokalen Presse tagelang für Schlagzeilen sorgt. Ich rufe mir das Gespräch der beiden Alten ins Gedächtnis zurück und mache mich auf das Schlimmste gefasst.
Wir lassen uns am Fuß der Schlepplifte nieder, ich in meinem Rollstuhl, Yvette auf einem Betonmäuerchen. Rascheln von Zeitungspapier, das entfaltet wird.
»Hier auf der Titelseite steht: ›Die nackte Leiche einer jungen Frau wurde gekreuzigt in einem verlassenen Haus gefunden. Das Opfer, das noch nicht identifiziert werden konnte‹, sicher eine Obdachlose, ›ist gekreuzigt worden‹, gekreuzigt, das muss man sich vorstellen! ›Und zwar auf einer Sperrholzplatte von 25 mm Dicke mit Schrauben von 70 mm‹ … das geht nur mit einem Akkuschraubenzieher, die sieht man ja dauernd in der Werbung … ›Erste Untersuchungen haben ergeben, dass der Tod, der zwei oder drei Tage zurückliegt, auf die gewaltsame Zuführung von Chlorwasser zurückgeht.‹Mein Gott, wie entsetzlich! Und das alles ganz in der Nähe!«
Mich überkommt eine leichte Übelkeit bei der Vorstellung, wie diese unglückselige Person lebend gekreuzigt und dann vergiftet wurde. Ich bedauere lebhaft, dass Yvette mir diesen Bericht vorgelesen hat. Nicht dass ich die Augen verschließen will vor dem, was rings um mich geschieht, aber ich habe meine Dosis an Verbrechen gehabt. Mit Albträumen und nächtlichen Schweißausbrüchen, und das ein halbes Jahr lang. Yvette fährt unerbittlich fort:
»›Der Gipfel des Grauens: Der Mörder hat nach dem Tod‹, Gott sei Dank wenigstens nachher, ›große Stücke Fleisch aus den Schenkeln des Opfers geschnitten, höchstwahrscheinlich mit einer elektrischen Säge. Berechtigter Aufruhr in Entrevaux … Gendarmerie in Alarmbereitschaft … Das seit Jahren verlassene Gebäude wurde immer wieder von Hausbesetzern bewohnt … Die Ermittler gehen von einem Verbrechen aus, das unter Einfluss von Drogen begangen wurde …‹Ich kann mir schwer einen Drogensüchtigen vorstellen, der Sperrholzplatte, Schrauben und dergleichen kauft … So einer plant doch einen Mord nicht«, kommentiert Yvette und legt die Zeitung zusammen. »Meiner Meinung nach war das ein Verrückter. Kein Wunder bei dieser Arbeitslosigkeit!«
Daraufhin zieht sie heftig gegen die Regierung und den ganzen Planeten zu Felde. Ich versuche, mich auf die Wärme der Sonne und das Lachen der Kinder zu konzentrieren, doch ich sehe immer wieder diese junge Frau vor mir, die verzweifelt schreit, während sich eine 70-mm-Schraube in ihr Handgelenk bohrt …
Nein, ich verbiete mir, daran zu denken.
Lieber an den Hund denken. An die Hundeschnauze, das warme Fell. Die Blase vermag das Wasser nicht mehr zu halten … Das absolute Grauen … Das Surren der Säge, die das Fleisch zerteilt … Nein! Ich greife nach dem Stift, habe Mühe, ihn zu halten, trotzdem gelingt es mir zu schreiben: Ich werde mir einen Hund kaufen.
»Einen Hund? So ein Tier macht Dreck! Schließlich müssen Sie ja nicht putzen. Das ist meine Meinung dazu … Natürlich würde Ihnen ein Hund Gesellschaft leisten. So ein süßer kleiner Kerl, den man auf dem Schoß haben kann. Ich könnte ihm ein Mäntelchen stricken für den Winter, wo es bei uns ständig regnet.«
Ich habe sie auf ein anderes Thema gebracht! Yvette ist dabei, alle Hunde der Nachbarschaft aufzuzählen, als ein Schrei ertönt: »Vorsicht!« Auch Yvette schreit auf. Ich mache einen Satz nach vorn, dann ein Aufprall, der Rollstuhl gerät ins Rutschen, kippt, und ich liege am Boden, Kopf nach unten, Hintern in die Luft – eine Stellung, die noch unbequemer als die sitzende ist. Eine zerknirschte Männerstimme:
»Tut mir Leid, ich wollte einem Jungen ausweichen, der gestürzt war und …«
»Wenn man nicht richtig Snowboard fahren kann, sollte man wenigstens das Tempo drosseln«, schimpft Yvette, die versucht, mich aufzurichten.
»Tut mir wirklich furchtbar Leid. Warten Sie, ich helfe Ihnen.«
Ehe ich mich versehe, befinde ich mich in den Armen eines Unbekannten, der nach Aftershave riecht. Seine Haare kitzeln mein Gesicht, sie müssen lang sein. Er ist kräftig, er hat nicht mal gestöhnt, als er mich aufgehoben hat. Yvette hat den Rollstuhl wieder aufgestellt. Der Fremde setzt mich behutsam hinein.
»Notizblock und Stift dürften Ihnen gehören.«
Er legt beides auf meinen Schoß.
»Ich bin untröstlich. Darf ich Sie beide, um meine Schandtat wieder gutzumachen, zum Mittagessen einladen?«
Und, zack, noch einer! Mein unwiderstehlicher Charme hat ihn bereits betört! Ich schreibe: Ja, gern, bevor Yvette ablehnen kann. Auch wenn ich noch Probleme habe, in der Öffentlichkeit zu essen, wird man bei dieser Gelegenheit wenigstens nicht von dem Mord sprechen. Denke ich mir.
Falsch gedacht, Elise. Nur wenn sie gerade den Mund voll haben, sprechen Yvette und er nicht davon. Mein Karamboleur heißt Yann, er ist Erzieher und hat die Zeitung gelesen. Daher die leidenschaftlichen Kommentare, die ich mit zugeschnürtem Magen anhören muss. Warum interessieren sich die Leute immer nur für das Böse? Warum sprechen sie nicht von der Farbe des Tischtuchs, vom Lied des Stieglitz in der Paarungszeit oder von den Vorzügen des Olivenöls. Wie soll man ein Raclette essen, wenn man so was zu hören bekommt:
»Ich bin sicher, dass er sie bei lebendigem Leibe mit der Säge malträtiert hat. Das ist ein Sadist.«
»Vielleicht haben Sie Recht. Noch etwas Käse, Elise? Wenn Sie wüssten, was ich bei meinem Praktikum in der psychiatrischen Klinik alles gesehen habe … Sachen, bei denen es Ihnen eiskalt den Rücken runterlaufen würde. Schon diese Kreuzigung deutet darauf hin, dass er nicht ganz richtig im Kopf ist. Ein mystischer Spinner wahrscheinlich. Oder einer aus diesen satanischen Sekten …«
»Und das Chlorwasser? Mein Gott, wie das brennen muss! Ich schenke Ihnen noch Weißwein nach, Elise«, sagt Yvette.
»Ein Ritual der Reinigung vielleicht«, meint Yann. »Was weiß ich. Tatsache ist, dass ein gefährlicher Krimineller frei herumläuft, irgendwo in der Nähe.«
Genau das, was man braucht, um sich behaglich zu fühlen. Ich leere mein Glas in einem Zug.
»Vielleicht sogar hier«, fährt Yann eifrig fort. »Wo könnte man sich besser verstecken als im Gewimmel eines Skiorts? Anorak, Mütze, Skibrille – da sehen doch alle gleich aus.«
Es weiß aber doch niemand, wie er aussieht, der Mörder. Er braucht sich also gar nicht zu verstecken. Er kann in aller Ruhe sein Leben weiterführen. Wütend und ohne Appetit stochere ich in meinem Salat herum.
»Sind Sie auf Urlaub?«, fragt Yvette.
»Nein, ich arbeite hier. In einem Zentrum für Behinderte.« Ich glaub, ich träume!
»Im CLMPAH!«, antwortet Yvette sehr schnell.
»Woher wissen Sie das?«
Erklärungen, Lachen. »Na, so ein Zufall aber auch!« Man bestellt den Kaffee bei bester Laune, bis auf Elise, die Spaßverderberin, die von schlimmsten Vorahnungen heimgesucht wird. Wenn ein Verrückter in der Gegend herumspaziert, stehen die Chancen zehn zu eins, dass sein Weg den meinen kreuzen wird …
Kaffee, Verdauungsschnäpschen, der Raum dröhnt von angeregten Gesprächen, Yvette lässt sich über mein Schicksal aus, erzählt von meinem Unfall, von meinem Buch, von den Ereignissen des letzten Jahres, während ich wie ein Ölgötze dasitze. Es ist nervtötend, die Leute ständig über einen reden zu hören, als wäre man gar nicht da. Fast hätte ich Lust, an der Tischdecke zu ziehen und alles umzuwerfen. Yann scheint das zu verstehen, denn ich fühle plötzlich, wie sich seine Hand auf meine legt.
»Ist es für Sie nicht schwer, Elise, plötzlich eine Berühmtheit zu sein?«
Notizblock: Ist mir egal. Gehen wir?
»Oh, oh! Entweder täusche ich mich, oder Sie sind schlecht gelaunt. Aber Sie haben Recht. Hier drinnen zu hocken, wo draußen die Sonne scheint! Ich will versuchen, die Piste runterzukommen, ohne jemanden über den Haufen zu fahren. Die Rechnung, bitte. Nein, nein, kommt nicht in Frage. Ich habe Sie eingeladen.«
Draußen ist Wind aufgekommen. Yann verabschiedet sich mit einem kräftigen Händedruck. Yvette erzählt mir, dass er eine graue Skihose trägt und dazu einen grau-schwarz-orangefarbenen Pullover. Dass er lange blonde Haare hat, die mit einem Stirnband zurückgehalten sind. »Ich hätte ihn niemals für einen Erzieher gehalten, eher für einen Skilehrer«, fügt sie gut gelaunt hinzu. Anscheinend ist es Yann gelungen, meinen Gesellschaftsdrachen zu erobern.
Wir machen uns gemächlich auf den Weg zu unserer gewohnten Terrasse. Yvette vertieft sich sogleich in ihre neueste Illustrierte, während ich mich in mathematische Denkaufgaben stürze. Etwas, das ich unlängst entdeckt habe und das mich beschäftigt. Lange Additionen, Multiplikationen, Dreisatzrechnungen usw. Wenn ich mich allzu sehr langweile, kann ich immer noch meinen Walkman anschalten und Musik oder Radio hören. Das Problem ist nur, dass mich Musik ziemlich kalt lässt. Das Radio übrigens auch. Die Leute reden die ganze Zeit, das ödet mich an. Was ich wirklich gern täte, wäre, ein gutes Buch zu lesen. Aber ich habe schon die ganze letzte Lieferung in Blindenschrift gelesen und warte auf die nächste.
Ich muss die Sonne auskosten. Ich muss mich entspannen, versuchen, ein Nickerchen zu machen. 365 Schäfchen springen in 13 Minuten 28 mal über 36 Zäune. Wie oft springt jedes Schaf in 42 Minuten über die Zäune?
Ich werde wachgerüttelt. Ich gähne ausgiebig. Für ein Nickerchen habe ich ganz schön tief geschlafen. Ich bin völlig benebelt.
»Es ist zehn vor fünf«, verkündet Yvette. »Der Minibus ist schon da.«
»Guten Tag, ich bin Hugo!«, ruft die heisere Stimme eines Mannes von etwa Fünfzig. »Kommen Sie, junge Dame, ich helfe Ihnen hinein.«
Der Wagen ist speziell für Behinderte eingerichtet. Ich befinde mich auf einer Art Plattform. Yvette setzt sich nach vorn neben Hugo, der uns mitteilt, dass er der Pfleger des Zentrums ist. Ansonsten gibt es noch eine Pflegerin.
Der Minibus kriecht auf einer kurvenreichen Straße den Berg hinauf.
»Wir fahren zu einem großen Gebäude aus Stein, das hoch über dem Dorf liegt«, erklärt Yvette.
Das große Gebäude aus Stein, wie sie es nennt, stammt aus dem 19. Jahrhundert und thront über dem Ort. Hier nennt man es immer noch »das Sanatorium«, obwohl dieses schon vor über vierzig Jahren geschlossen wurde! In meiner Kindheit war es verwahrlost, und mein Onkel hatte mir strikt verboten, den Fuß hineinzusetzen. Und so hatte ich nichts Besseres zu tun, als durch ein eingeschlagenes Fenster einzusteigen. Ich fand mich in einem riesigen finsteren Saal mit Gewölbe und Parkett wieder, in dem es nach Urin stank. Leere Bierdosen lagen am Boden verstreut. Eine halb aus den Angeln gerissene Tür gab den Blick frei auf einen großen weiß gekachelten Raum mit einem gewaltigen gusseisernen Herd. Der rief Bilder in mir wach von allzu neugierigen Kindern, die von einer lächelnden Menschenfresserin zu Bouillon verarbeitet werden. In einer Ecke lag eine verrenkte nackte Puppe. Ich hatte plötzlich den unwiderstehlichen Drang, Pipi zu machen. Irgendwo schlug eine Tür zu, und ich rannte von Panik ergriffen davon.
Ich bin nie wieder dorthin zurückgekehrt, zumal mir, als ich älter wurde, Castaing immer »verstaubter« vorkam. 1968 zog ich London vor, und wie alle träumte ich von Katmandu.
Der Wagen hält an. Hugo setzt mich am Fuß einer Rampe für Behinderte ab. Er ist bärtig – ich spüre die dichten, struppigen Haare an meiner Hand – und kräftig gebaut, seine Bizeps treten fühlbar hervor. Klappern von Absätzen auf dem Beton. Francine Atchouel eilt auf uns zu.
»Ich freue mich so, dass Sie gekommen sind! Danke, Hugo, ich kümmere mich um alles Weitere. Italienische Architektur Anfang neunzehntes Jahrhundert«, erklärt sie Yvette. »Das Gebäude war ursprünglich eine Kaserne der piemontesischen Truppen, in den zwanziger Jahren wurde es dann zu einem ›Kindersanatorium‹ umfunktioniert, bevor es in den Fünfzigern verfiel.«
»Hat die Stiftung es aufgekauft?«, fragt Yvette.
»Das CLMPAH, ja. Vor vier Jahren. Die Luft hier ist sehr gesund, wissen Sie, und jetzt, im renovierten Zustand, ist es wunderschön.«
Die Räder meines Rollstuhls gleiten über ein Parkett, das angenehm nach Wachs riecht, während Francine Atchouel uns in den großen Salon, »unser Heim«, führt, wo uns die Patienten in totalem Schweigen empfangen.
»Guten Tag allerseits«, posaunt Madame Atchouel. »Das sind Elise und ihre Gesellschaftsdame Yvette.«
Glucksen, Trampeln, Flüstern. Yvette hüstelt nervös.
»Ich stelle sie Ihnen jetzt vor, sie sind ein bisschen schüchtern«, fährt Francine fort. »Das ist Magali. Infantile Psychose«, flüstert sie uns zu.
Ich strecke die Hand ins Leere, ein kleines Lachen und eine Hand, die ungeschickt die meine schüttelt. Dann unkontrolliertes Hinken, und jemand berührt meine Schulter, ohne ein Wort zu sagen.
»Léonard de Quincey«, kündigt Madame Atchouel in feierlichem Ton an. »Léonard ist unser Astronom. Leider motorisch behindert«, raunt sie mir zu.
Léonard entfernt sich.
»Christian«, fährt sie fort.
»Gutn Taaag, Mam’sal!«, ruft eine kräftige Stimme. »Sal Sal Sal in der Küche.«
»Red keinen Unsinn. Christian ist leicht debil, mit einer Neigung zur Echolalie, das ist mechanisches Nachsprechen«, haucht mir Francine zu.
»Laetitia, mein Liebes, komm doch bitte mal her.« Sonderbares Scharren. Klar, ein Gehgestell, das über den Parkettboden gleitet.
Und so geht das eine gute Viertelstunde weiter. Es sind insgesamt acht Teilnehmer, die einen geistig, die anderen motorisch behindert: Das Zentrum nimmt alle Patienten auf. Jean-Claude, achtundzwanzig, Opfer des Charcot-Syndroms, das zu einer progressiven, unheilbaren Lähmung führt, ist ein Video-Fan, der mit dem Camcorder auf der Schulter lebt. Bernard, fünfundzwanzig, der nie sozialisiert worden ist und bei dem das Ganser-Syndrom, das heißt so genannter Scheinblödsinn, diagnostiziert wurde (was ist denn das?) und OCD (Zwangsneurosen, das weiß ich: Das sind Leute, die sich hundertmal am Tag die Hände waschen und sechshundertmal überprüfen, ob sie den Gashahn zugedreht haben). Emilie, zweiunddreißig, Trisomie, das heißt, dass ein einzelnes Chromosom in drei statt nur in zwei Kopien vorliegt, was zu Veränderungen des Erscheinungsbilds führt; Clara, dreiundvierzig, Oligophrenie, so nannte man früher die geistige Behinderung. Emilie behauptet, Clara sei verrückt, doch offensichtlich halten sie zusammen wie Pech und Schwefel.
Von all diesen fremden Stimmen wird mir ganz schwindelig; ich verwechsele die Namen und spüre erste Ermüdungserscheinungen, als man endlich Tee serviert. Das ist wiederum nicht ganz einfach, weil wir, unter der Leitung der beiden Pfleger, Hugo und Martine, von den Heimbewohnern bedient werden.
»Sie werden sich fragen, wie wir aussehen«, sagt Hugo in freundlichem Ton zu mir. »Also, Martine ähnelt der Oberschwester in Einer flog übers Kuckucksnest«, fährt er lachend fort.
»Und du Captain Haddock, nur mit roten Haaren!«, gibt sie zurück.
Francine Atchouel reicht einen »von unseren Heimbewohnern gebackenen« Kuchen herum und besteht darauf, dass wir ein zweites Mal reichlich davon nehmen.
Yvette fragt Hugo im Flüsterton, was »Oligophrenie« bedeutet.
»Das ist ein anderes Wort für Geistesschwäche oder geistiges Zurückgebliebensein.«
»Früher nannte man sie die ›Unschuldigen‹«, erklärt Martine. »Man unterscheidet zwischen denen, die sprechen und die Grundzüge des Lesens und Schreibens lernen können, denen, die nur sprechen können, und denen, die nicht einmal die Sprache beherrschen«, fügt sie hinzu und brüllt Clara an, die versucht, Emilie ihre Tasse zu entreißen.
»Beim Ganser-Syndrom wiederum«, sagt Hugo, »handelt es sich um Patienten wie Bernard, die systematisch vorbeireden oder -handeln, obwohl sie, das glaubt man zumindest, genau verstehen, was man ihnen sagt.«
»Wie viel wiegt Bernard?«, fragt Yvette noch leiser. »Hundertzwanzig Kilo bei einem Meter sechzig«, antwortet Hugo.
Ein Fettleibiger also. Sie plaudern munter weiter. Ich höre nur halb zu, bin angespannt, es ist mir unangenehm, unter Fremden zu sein, die mich beäugen und die ich nicht sehen kann. Und – ich weiß, das ist nicht sehr ehrenwert, aber die Gegenwart von »Zurückgebliebenen« löst bei mir stets ein leichtes Unbehagen aus. Das Gefühl, ihren Erwartungen, ihren Wünschen nicht entsprechen zu können. Und eine gewisse Abneigung gegen Körperkontakt, den sie fast immer verlangen. Ich bin kein Fan körperlicher Berührungen außerhalb des Bettes. Benoît hat mir oft meine Kälte vorgeworfen. Wie anders ich heute bin, Benoît! Wie abhängig!
Plötzlich Freudenschreie, als jemand ein joviales »Hallo, zusammen!« ruft. Yann. Er hat ganz offensichtlich bei den Heimbewohnern einen Stein im Brett. Emilie wiederholt verzückt seinen Namen. Magali zerrt vor Begeisterung an meinem Arm. Christian zieht mehrmals kräftig die Nase hoch.
Francine will ihn uns vorstellen, doch Yann erklärt, dass wir uns schon kennen gelernt haben.
Es dauert mindestens eine Viertelstunde, bis das Thema auf den grausamen Mord von Entrevaux kommt. Yann hat brandneue Nachrichten von einem seiner Snowboard-Kumpel, der nebenbei auch noch Adjudant-Chef, also Polizeikommissar der lokalen Gendarmeriebrigade und mit dem Fall betraut ist. Francine hüstelt vernehmbar, und Yann hält inne.
»Hugo, ist es nicht Zeit für die Fernsehserie?«, fragt sie. »Wer sie im Freizeitraum sehen will, kann mit Hugo gehen.«
»Sie lassen sie Police City Blues sehen?«, wundert sich Yvette, die das Fernsehprogramm auswendig kennt.
Vage Vorstellung von durchdringenden Schreien, Schusswechseln, Flüchen, Verfolgungsjagden mit quietschenden Reifen, athletischem und/oder verliebtem Keuchen … »Es sind Erwachsene!«, erwidert Francine Atchouel.
»Wir sind nicht aus Zucker, wissen Sie!«, ruft Laetitia. »Gut, ich gehe, ich steh auf so was.«
Stühlescharren. Jemand drückt mir einen Kuss auf die Wange.
»Das ist Magali«, erklärt mir Francine. »Sie lässt keine Folge aus. Sie ist versessen aufs Blaulicht.«
Man quetscht mir die Hand.
»Das ist Christian.«
»Tatütata, hiiiii!«
Die anderen gehen ohne Gruß. Ich höre Bernard mit kleinen Schritten schlurfen. »Ich muss mir beide Hände waschen, morgen ist Samstag«, stößt er hervor.
»Ich wäre Ihnen dankbar, Yann, solche Themen in Zukunft vor unseren Patienten zu meiden!«, ruft Francine, kaum dass sie gegangen sind. »Sie wissen doch, wie sensibel sie sind.«
»Sie setzen sie ja schließlich auch vor die Glotze!«, entgegnet Yann trotzig.
»Und weiter? Was hat Ihr Freund von der Gendarmerie gesagt?«, unterbricht Yvette, die vor Neugier platzt.
»Nichts sehr Schönes. Die Nachrichten hatten Recht: Das Mädchen wurde bei lebendigem Leib gekreuzigt und dann gezwungen, einen Liter Chlorwasser zu trinken, wahrscheinlich mit Hilfe eines Trichters.«
Entsetztes Raunen. Ich beiße die Zähne zusammen, um mir die Szene nicht vorstellen zu müssen.
»Und weiter?«, fragt Yvette mit tonloser Stimme.
»Man hat ihr ein gutes Kilo Fleisch aus den Schenkeln geschnitten. Da hätte man ein paar ansehnliche Steaks draus machen können.«
»Yann! Etwas mehr Respekt, bitte!«, ruft Francine empört.
Anscheinend schätzt sie ihren Sporterzieher nicht allzu sehr.
»Nach ersten Ermittlungen ist die Frau um die Dreißig, brünett, langes Haar, blaue Augen, keine besonderen Merkmale«, fährt Yann fort, ohne sich aus der Fassung bringen zu lassen. »Er hat den STRJD kontaktiert – bislang allerdings ohne Erfolg.«
»Den was?«, fragt Francine. »Könnten Sie sich vielleicht etwas klarer ausdrücken?«
»Den Service Technique de Recherche et de Documentation, den polizeilichen Erkennungsdienst«, sagt Yann brav auf. »Philippe steht auf wissenschaftliche Methoden, müssen Sie wissen. Er hat kriminaltechnische Kurse beim CNPPJ und IRCGN absolviert«, fügt er genüsslich hinzu. »Beim Centre National de Perfectionnement de Police Judiciaire und beim Institut de Recherche Criminelle.«
»Donnerwetter!«, staunt Yvette. »Und haben sie etwas gefunden?«
»Nichts. Sie wollen das Foto des Opfers im Fernsehen zeigen.«
»Es ist bestimmt eine Obdachlose, die zufällig in diesem leer stehenden Haus auf einen Sadisten getroffen ist«, meint Yvette bestimmt.
»Ein Sadist, der im Voraus seine kleine Ausrüstung gekauft hat?« Yann schüttelt den Kopf. »Ich denke, er hat sie dorthin gelockt und lange vorher beschlossen, sie zu töten.«
»Oder er hasst alle Frauen und hat sein Opfer wahllos ausgesucht!«, murmelt Francine. »Mein Gott, da kann einem ja richtig Angst werden. Ich hoffe, sie werden ihn bald finden.«
»Das würde mich wundern. Hm, köstlich, der Kuchen. Sie haben noch absolut keine heiße Spur«, erwidert Yann mit einer gewissen Genugtuung. »Er hat mit Sicherheit Handschuhe getragen. Ach, das hätte ich fast vergessen: Sie haben eine Plane gefunden, voll mit Blut von dem armen Mädchen. Wahrscheinlich hat er sie benutzt, um seine Kleider zu schützen.«
»Jetzt hören Sie endlich auf, mir wird noch übel!«, protestiert Francine.
»Wie Sie wollen. Übrigens, hat der Typ mit den Schlitten angerufen?«, fragt Yann.
»Ja, alles ist bereit für morgen zehn Uhr. Yann hat eine Schlittenfahrt für unsere Heimbewohner organisiert. Die Schlitten werden von Huskies gezogen«, erklärt uns Francine.
»Ach, das muss ja herrlich sein!«, schwärmt Yvette.
»Dann kommen Sie doch einfach mit!«, meint Yann.
Die Idee gefällt mir eigentlich. Eine Spazierfahrt an der frischen Luft, fest eingemummelt, dazu das Hecheln der Hunde. Bilder vom Hohen Norden … Ich drücke Yvettes Hand als Zeichen der Zustimmung.
Ein Treffen wird für den nächsten Morgen ausgemacht, dann gibt Yvette das Zeichen zum Aufbruch.
Im Minibus dreht sich das Gespräch natürlich um die Heimbewohner. Hugo erzählt uns, dass Jean-Claude nur noch wenige Jahre zu leben hat.
»Er hat ein sympathisches Gesicht, aber er ist so mager!«, sagt Yvette mitfühlend. »Der Astronom dagegen ist eigentlich ein hübscher Junge«, fährt sie nach einem kurzen Schweigen fort, bevor sie traurig hinzufügt: »Es ist wirklich zum Gotterbarmen!«
»Ja, unser Léonard, er leidet sehr unter seinem Zustand«, sagt Hugo, »und schämt sich. Eine gequälte Seele. Ich überwache seine Medikamentengabe.«
»Sie haben Angst, er könnte sich umbringen?«, fragt Yvette.
»Man weiß nie. Alle halten ihn für debil, dabei ist er Mathematikdozent. Sie können sich vielleicht vorstellen, wie hart das ist.«
Ja, ich weiß, was das bedeutet. Ich erinnere mich, wie nach dem Unfall alle glaubten, ich sei nur noch eine lebendige Leiche. Dieses schreckliche Gefühl der Unfähigkeit, sich verständlich zu machen, zu zeigen, dass man versteht. Das erinnert mich daran, dass ich Anfang Februar zu neuen Untersuchungen nach Paris muss. Und dann vielleicht zu einer neuen Operation. Wer weiß? Wenn ich nach jedem Eingriff ein bisschen mehr Eigenständigkeit zurückgewinne, kann ich in zehn Jahren vielleicht Hänschen klein spielen.
»Außerdem«, sagt Hugo noch immer zum Thema Léonard, »hat es im Vorbereitungsjahr zur École Polytechnique in seiner Klasse gebrannt. Fünfzehn seiner Kameraden sind dabei umgekommen. Er hat danach unter schrecklichen Depressionen gelitten und war jahrelang in psychiatrischer Behandlung. Madame Atchouel hat uns davon in Kenntnis gesetzt. Man kann besser mit den Patienten arbeiten, wenn man ihre Vorgeschichte kennt.«
Das ist allerdings ein finsterer Hintergrund. Behutsam schaltet Hugo die Gänge. Dröhnende Rapmusik aus einem benachbarten Wagen, mehrfaches Hupen, Bremsen.
»Die Leute haben ein Talent, sich vor fahrende Autos zu werfen!«, kommentiert Hugo.
Und fügt lachend hinzu:
»Na ja, wenn wir unsere kleine Truppe spazieren führen, geht es auch nicht gerade triste zu. Gestern ist uns Magali entwischt, ich habe sie vor dem kleinen Supermarkt wieder gefunden. Und Bernard wäre fast vom Bus überfahren worden. Er wollte die Straße überqueren, um sich die Kuchen in der Vitrine des Bäckers anzusehen.«
»Lassen Sie ihn so viel essen, wie er will?«, fragt Yvette.
»Er sollte eigentlich Diät leben, aber gut … Bernard hat Integrationsprobleme, er hat lange allein mit seiner Mutter gelebt. Er ist gleichzeitig dumm und durchtrieben, zu folgsam. Genau die sind es, die manchmal durchdrehen und große Dummheiten machen.«
»Und Christian? Er macht mir ein bisschen Angst«, gesteht Yvette. »Er ist ein richtiger Koloss«, erklärt sie mir.
»Christian, das ist ein anderer Fall. Er hat unter der schlechten Behandlung in seiner Kindheit gelitten. Man hat den Eltern das Sorgerecht entzogen. Er ist sehr impulsiv und liebt es, wie ein Kleinkind die Wörter zu wiederholen. Er ist alles andere als dumm, aber unfähig, sich wie ein Erwachsener zu benehmen. Ein Baby von einem Meter fünfundachtzig, gebaut wie ein Rugbyspieler.«
»Sie kommen mir alle ein bisschen vor wie Babys, die man als Erwachsene verkleidet hat«, murmelt Yvette. »Vernachlässigte Babys, die man ihrem Kummer überlassen hat.«
»He! Und wir, die Erzieher, zählen wir etwa gar nicht? Wir sind da, um ihre ohnmächtigen Eltern zu ersetzen.«
»Entschuldigen Sie, ich wollte Ihr Engagement nicht in Frage stellen. Hier bitte rechts!«
Reifenquietschen, leichtes Rutschen des Minibusses auf der glatten Fahrbahn.
Zu Hause stürzt Yvette leise schimpfend zum Fernseher: Ihre Sendung hat bereits begonnen. Ich fahre mit meinem Rollstuhl ans halb geöffnete Fenster. Der Abend ist hereingebrochen, ich höre den Schnee unter den Stiefeln der Passanten knirschen, das Tack-Tack-Tack der Ketten, wenn ein Wagen vorbeifährt. Ich nehme den Geruch des nächtlichen Schnees wahr. Ein leichter Wind hat sich erhoben, er wirbelt ein paar feuchte Flocken durch die Luft, die sich auf die Fensterscheibe, auf meine Nase, meine Wangen, meine Lippen legen, frisch und zart. Yvette beschimpft den Showmaster wegen einer Antwort, mit der sie nicht einverstanden ist. Ich lächele vor mich hin, dann muss ich wieder an die gefolterte junge Frau denken, und mir vergeht das Lächeln. Die gestrige Nacht war ebenso friedlich gewesen wie diese, und doch ist ganz in der Nähe ein Mensch unter grausamen Qualen gestorben.
»Elise …«
Ich zucke zusammen. Habe ich geträumt, oder hat eben jemand unter dem Fenster meinen Namen geflüstert?
»Elise …«
Nein, ich träume nicht. Jemand ruft mich. Yann? Mit der gesunden Hand ziehe ich das Fenster ein Stück weiter auf und berühre etwas. Ein Gesicht? Ja, ich glaube, es ist ein Gesicht. Ich strecke den Arm aus, aber ins Leere. Dann schließt sich meine Hand um ein weiches Päckchen.
»Für dich, mon amour«, flüstert die Stimme.
Also wieder!
Schnell, schnell, mein Block: Wer sind Sie? Ich halte den Zettel ans Fenster.
Ein kleines unangenehmes Lachen. Eine warme Hand streift die meine. Ich ziehe sie zurück. Dann Schritte, die sich entfernen. Mein mysteriöser Besucher ist fort! Ich steuere mit meinem Rollstuhl auf Yvette zu, die von allem nichts bemerkt hat. Ich befühle das kleine weiche Päckchen und schnuppere daran. Wie erwartet, riecht es nach Fleisch. Der Steakspender hat erneut zugeschlagen!
Steak. Oh, mein Gott! Steak! Mir ist, als hätte man mir einen Schlag in die Magengrube versetzt. »Ein paar ansehnliche Steaks herausgeschnitten …« Das Päckchen entgleitet meiner Hand und fällt auf den Boden.
»Elise?«, ruft Yvette im Ton des Vorwurfs. »Oh! Was ist denn das? Noch ein Steak? Woher haben Sie das denn wieder?«
Als könnte ich etwas dazu! Meine Hand zittert, während ich schreibe: Jemand hat es mir durchs Fenster gereicht. »Aber das ist doch völlig verrückt!«
Rascheln von Papier, das entfaltet wird.
»Tatsächlich, ein Steak! Schönes rotes Fleisch wie das von gestern. Das ist mir jetzt wirklich ein Rätsel …«
Ruf Yann an.
»Ich weiß nicht, was Yann mit dem Steak zu tun hat. Es ist bestimmt nicht Yann, der sich solche Scherze erlaubt.«
Ruf Yann an.
»Schon gut, schon gut«, knurrt Yvette und hebt den Telefonhörer ab.
Sie erklärt ihm mehr schlecht als recht unser kleines Problem, während ich ihr eine Mitteilung zuschiebe.
»Moment bitte, ich muss das hier erst lesen … Elise möchte wissen, ob Ihr Freund bei der Gendarmerie das Stück Fleisch untersuchen lassen könnte … Eine Marotte, ich weiß auch nicht, was in sie gefahren ist … Kein Problem? Das ist wirklich sehr nett von Ihnen. Ich bringe es Ihnen morgen früh vorbei … In den Kühlschrank, klar … Guten Abend und noch mal vielen Dank. Wir machen uns lächerlich!«, protestiert Yvette, als sie aufgelegt hat. »Wir hätten das Steak einfach in den Mülleimer werfen sollen und basta!«
Telefonläuten unterbricht sie: Es ist Jean, ihr Freund. Es folgt ein ausführliches Gespräch, bei dem ich angestrengt wegzuhören versuche. Ich kann kaum erwarten, was bei der Untersuchung herauskommt, wenn es bloß nicht das ist, was ich befürchte.
KAPITEL 3
Seit heute Morgen bin ich fiebrig, ungeduldig, nervös. Yvette hat das Steak bei Yann abgeliefert, der es durch den Postboten an seinen Freund bei der Gendarmerie weitergeschickt hat. Und dann der Aufbruch zum Polarkreis. Der Minibus vom Zentrum hat uns beim Polarkamp abgesetzt.
Die Heimbewohner veranstalten einen Höllenlärm, sind außer sich vor Aufregung über diese Expedition. Auch die Hunde sind kaum zu bändigen. Laetitia, die sich fürchtet, hält meinen Arm umklammert, während Magali kleine spitze Schreie ausstößt. Hugo und Martine müssen zuerst Emilie und Clara daran hindern, die Hände in die Mäuler der Bestien zu stecken, und dann Christian, sich im Schnee zu wälzen. Bernard fragt jeden nach der Uhrzeit und versichert uns, dass Zeit Geld ist. Ich denke noch vage an das verdammte Steak und seinen geheimnisvollen Spender, bin aber zu sehr damit beschäftigt, alles zu registrieren, was rings um mich geschieht, um wirklich in Sorge zu sein.
Jean-Claude hat seinen Camcorder genommen und filmt uns auf Teufel komm raus. Er, der Halbinvalide, möchte Bewegung festhalten. Dabei ruft er immer wieder: »Das habe ich im Kasten!«, als ließe sich Aktion eindosen.
Ich würde mich gern im Film sehen. Wissen, wie ich ausschaue. Mich den Arm heben sehen wie eine automatische Barbiepuppe.
Die Hunde heulen, bellen, knurren, schütteln sich vor Ungeduld. Yann verteilt seine kleine Truppe, bespricht sich mit den Schlittenführern, drei jungen Männern mit stark südfranzösischem Akzent. Ein frischer Wind ist aufgekommen. Yvette hilft mir, den Kragen meines Skianzugs zuzuknöpfen und mir die Mütze aufzusetzen. Hugo hebt mich hoch. Ich nehme seine knotigen Muskeln wahr, seinen Bart, seinen Geruch nach Arzneimitteln. Er setzt mich auf die fellbedeckte Holzbank neben Laetitia. Uns gegenüber hocken Magali und Christian. Yvette klettert als Letzte herauf, sinkt an meine Seite und murmelt: »Das ist nichts mehr für mein Alter.« Hugo setzt sich zu Emilie, Clara und Bernard. Martine steigt mit Jean-Claude und Léonard auf. Yann teilt dicke Decken aus, spart nicht an guten Ratschlägen und Ermunterungen und lässt die Zügel knallen. Die anderen Schlittenführer stoßen ein begeistertes »Juhu« aus. Die Schlitten setzen sich in Bewegung, werden schneller. Wir gleiten in den Wald, ich nehme den würzigen Tannengeruch auf.
»Wie schön!«, ruft Yvette. »Man könnte meinen, wir wären in Kanada.«
Der Wind peitscht mir ins Gesicht. Das Geräusch der Holzkufen auf dem Schnee erinnert mich ans Langlaufen früher, ich werde trübsinnig, fange mich wieder, höre Laetitia zu, die bei allem in Verzückung gerät. Seit ihrem Autounfall im Teenager-Alter halb gelähmt, ist sie mit vierundzwanzig das erste Mal in den Bergen. Sie lacht, ein heiteres Lachen, ist einfach glücklich, durch den Schnee zu gleiten.
Ich frage mich, ob sie nicht ständig an die Zeit zurückdenkt, als sie noch ganz normal gehen konnte. Sie war fünfzehn, als der Unfall passierte, hat mir Yvette erzählt. Yvette weiß inzwischen praktisch alles über die Heimbewohner, weil sie sich mit Martine angefreundet hat – die beiden haben sogar schon ihre Rezepte für ein Gratin Dauphinois ausgetauscht! Das Gratin Dauphinois ist eines der wichtigsten Wettkampfterrains französischer Hausfrauen. Welche Desaster es schon angerichtet hat, das Gratin Dauphinois! Versuchen Sie mal, eines zu machen, wenn Ihre beste Freundin zum Essen kommt. Sie wird ums Verrecken nicht zugeben können, dass es vielleicht besser schmeckt als ihres. Schlimmer noch der Fall, wenn ihr Ehemann, den Mund voll Kartoffeln, herausposaunt: »Schiebst du, Liebling, scho musch ein Gratin Dauphinois schmecken!« Ich persönlich kann umso leichteren Herzens einen solch tragischen Fall weiblicher Zwietracht heraufbeschwören, als Benoît, mein Ex, nie ein Gratin-Fan war. Bei Tony weiß ich nicht so genau. Er legt keinen großen Wert aufs Essen. Und bei meinem Problem, schriftlich Konversation zu pflegen, vermeidet man solche zweitrangigen Themen.
»Der Hund!«
Magali ist ganz aufgeregt. Yvette stimmt ihr zerstreut zu. »Der Hund! Der Hund! Der Hund! Der Hund!«
»Ja, ja, hier sind viele Hunde«, sagt Yvette. »Jetzt setz dich aber wieder. Sonst fällst du noch vom Schlitten.«
»Der Hund! Großer Hund!«
»Magali, jetzt zappel nicht so herum!«, schimpft Yann und dreht sich um.
»Beruhige dich, Mag. Sieh dir den Schnee an«, sagt Laetitia freundlich.
»Ach, jetzt verstehe ich!«, ruft Yvette. »Sie meint den großen Hund da vom, den Labrador!«
Labrador? Vielleicht der, mit dem ich gestern Morgen vor dem kleinen Supermarkt Bekanntschaft gemacht habe … Allerdings dürfte sein Frauchen im Minirock kaum Waldspaziergänge mit ihm machen.
Doch Yvette schüttelt meinen Arm:
»Das ist der Hund von dem Disco-Mädchen. Sie wissen schon, der große schwarze. Das Mädchen ist allerdings nicht zu sehen …«
Wütendes Bellen.