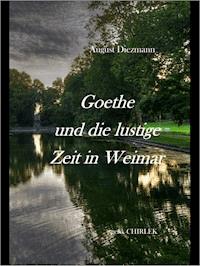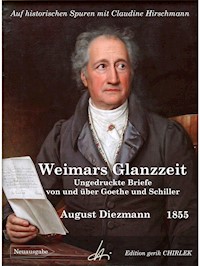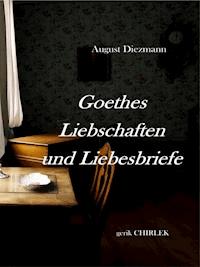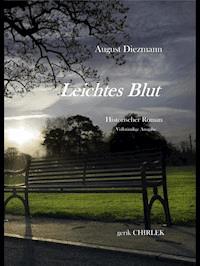Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Auf historischen Spuren
- Sprache: Deutsch
Digitale Neufassung [1830] ... Die Revolution, mit deren Schilderung die folgenden Blätter sich beschäftigen, zeichnet sich vor allen übrigen aus. Masaniello ihr Urheber und Leiter, ging aus dem Volke selbst hervor, welches gegen seine Unterdrücker die Waffen ergriff und hat in zehn Tagen mehr Wunder getan, als oft ein ganzes Jahrhundert hervorzubringen vermag. Dieser außerordentliche Mensch ist in den beiden letzten Jahrhunderten, besonders von französischen und italienischen Dichtern, häufig auf die Bühne gebracht worden; bei uns hat ihn Meißner zu dem Helden eines Romans gemacht, welcher vielen Beifall fand. Und wahrhaftig, es dürfte sich auf dem ganzen weiten Gebiete der Geschichte kaum noch ein interessanterer Charakter und ein anderer Mann auffinden lassen, welcher, wie er, in der kurzen Zeit von drei Tagen von der Armut eines Fischers zu der Macht eines Königs erhoben, wie ein Verbrecher ums Leben gebracht und wie ein Heiliger verehrt worden wäre. ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 73
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Masaniello oder der Volksaufstand zu Neapel 1647.
Technische Anmerkungen
Vorwort.
Masaniello.
Bildnachweis
Impressum
Masaniello oder der Volksaufstand zu Neapel 1647.
Geschichtliches Factum, welches Scripes Oper: „Die Stumme von Portici“, zum Grunde liegt.
Frei nach dem Französischen von Edme Thédore Bourg
von August Diezmann
Leipzig, 1830
Baumgärtners Buchhandlung
Technische Anmerkungen
Die vorliegende digitale Neufassung des altdeutschen Originals erfolgte im Hinblick auf eine möglichst komfortable Verwendbarkeit auf eBook Readern. Dabei wurde versucht, den Schreibstil des Verfassers möglichst unverändert zu übernehmen, um den Sprachgebrauch der damaligen Zeit zu erhalten.
Vorwort.
Die Revolution, mit deren Schilderung die folgenden Blätter sich beschäftigen, zeichnet sich vor allen übrigen aus. Masaniello ihr Urheber und Leiter, ging aus dem Volke selbst hervor, welches gegen seine Unterdrücker die Waffen ergriff und hat in zehn Tagen mehr Wunder getan, als oft ein ganzes Jahrhundert hervorzubringen vermag. Dieser außerordentliche Mensch ist in den beiden letzten Jahrhunderten, besonders von französischen und italienischen Dichtern, häufig auf die Bühne gebracht worden; bei uns hat ihn Meißner zu dem Helden eines Romans gemacht, welcher vielen Beifall fand. Und wahrhaftig, es dürfte sich auf dem ganzen weiten Gebiete der Geschichte kaum noch ein interessanterer Charakter und ein anderer Mann auffinden lassen, welcher, wie er, in der kurzen Zeit von drei Tagen von der Armut eines Fischers zu der Macht eines Königs erhoben, wie ein Verbrecher ums Leben gebracht und wie ein Heiliger verehrt worden wäre. Deshalb wundern wir uns, dass Meißner keinen Nachfolger gefunden hat, vorzüglich in unseren Tagen, wo historisch – romantische Erzählungen die Lieblingslektüre des Publikums bilden. Den jüngsten Versuch, den Helden jenes merkwürdigen Volksaufstandes auf die Bühne zu bringen, hat ein Engländer, Namens William Mitchell, gemacht, dessen „Masaniello; a tragedy“ sich in London gegenwärtig unter der Presse befindet; kurz vor diesem dichtete der geistreiche Scribe zu Paris seine Oper: „Die Stumme von Portici“, welcher ebenfalls die Ereignisse, welche wir zu schildern versuchten, zum Grunde liegen. Das Original der vorliegenden Blätter führt den Titel: „Masaniello, histoire du soùlevement de Naples en 1647; par M. C. L. Paris 1828.“ Außer ihm benutzten wir die kürzlich davon erschienene englische Bearbeitung, so wie den Aufsatz: „Revolutions of Naples in 1647 and 1648“ im 8. Heft von „the foreign quarterly review. Lond. 1829“ und empfehlen nun das Werkchen dem Wohlwollen des Publikums.
Leipzig, im Oktober 1829.
A. D.
Masaniello.
Schon hatten die Könige von Spanien Neapel fast ein Jahrhundert lang besessen, als ein, außerordentlicher Mensch, ein Wunder seiner Zeit, auf der politischen Bühne Italiens auftrat und dem Schicksale seines Vaterlandes beinahe eine andere Richtung gegeben hätte. Masaniello ist sein Name und noch heute wird er von den Neapolitanern mit Achtung und Ehrfurcht genannt. Über sein eigentliches Gewerbe streiten sich die Geschichtsschreiber noch; die einen, an ihrer Spitze Giannone, behaupten, er habe auf den Märkten Papiertüten verkauft; nach einer anderen Meinung war er ein Fischerknecht und nach einer dritten endlich, die das meiste für sich hat, selbst ein Fischer, der mit Mühe und Not sich von seiner Hände Arbeit nährte. Zu der Zeit, welche wir zu schildern uns vorgenommen haben, stand er ungefähr im fünfundzwanzigsten Jahre. Er war von mittlerer Größe, sein Gesicht offen und regelmäßig, aber der Blick seines Auges düster und ernst. Ob er schon durch seine Geburt den Letzten im Volke angehörte, so hatte ihn doch die Natur durch einen Geist mit seltenen Gaben, ein Herz mit Heldenmut und eine Zunge mit unwiderstehlicher Beredsamkeit den Ersten im Lande gleichgestellt. „Und wodurch“ – wird man fragen – „ward es ihm möglich, ganz Neapel zu einem Aufstande, der ohne Gleichen in der Geschichte dasteht, zu bewegen?“ Die Antwort liegt im Verlaufe unserer Erzählung. Die Könige von Spanien ließen Neapel durch Vizekönige, geld-und beutegierige Männer, regieren, die, gleich ihren Herren, das Königreich für ein erobertes Land ansahen, welches vor der Zurückgabe erst ausgeplündert werden müsse. Ihre italienische Armee ergänzten sie, bei der unaufhörlichen Bedrohung von Frankreich, stets mit Neapolitanern, sodass dem unglücklichen Lande seit Ferdinand dem Katholischen bereits hunderttausend seiner Kinder entführt worden waren. Während so der Krieg die Bevölkerung aufrieb, plünderten die Spanier das Vermögen des Staats und aller seiner Bürger. Es genüge, den Zustand des Königreiches Neapel mit einigen wenigen Pinselstrichen zu zeichnen: Die Herabsetzung des Geldwertes hatte allen Handel aufgehoben; eine große Anzahl neapolitanischer Schiffe war den Türken, die sich bis an den Circello und die Nachbarküsten Neapels herabwagten, in die Hände gefallen und bei den Erdbeben in den Jahren 1626 und 1627, welche ganze Städte zerstörten, eine solche Menge Menschen umgekommen, dass man ihre Leichname nicht begraben konnte, sondern verbrennen musste. Noch rauchten die Umgebungen Neapels, als 1631 der Ausbruch des Vesuvs die Hauptstadt selbst bedrohte. Nicastro, mehrere Flecken und Dörfer wurden mit 10,000 Einwohnern von dem Erdbeben im Jahre 1638 verschlungen und das jenseitige Kalabrien litt fortwährend von diesem fürchterlichen Nebel. Jeden Augenblick fürchtete man, die Pest, die in Sizilien herrschte, auch innerhalb der Mauern Neapels wüten zu sehen. Unbekümmert um alle diese Unglücksfälle, fuhr der unersättliche Hof zu Madrid fort, hohe Abgaben zu fordern. Nach einer alten Handschrift, welche der Erzbischof von Tarent (Capecelattro) dem Grafen Orloff mitteilte, belaufen sich allein die freiwilligen Geschenke unter den vier Königen Carl V., Philipp II., Philipp III. und Philipp IV. auf hundertunddreißig Millionen Taler. Durch die allgemeine Not ermutigt und begünstigt, raubten und mordeten die Banditen in der Hauptstadt und auf dem Lande. Das Königreich war nicht mehr im Stande, die wiederholten Forderungen Spaniens zu befriedigen; die Vizekönige und Behörden sahen sich genötigt, die Staatsgüter zu veräußern. Jedermann war überzeugt, dass das Elend, welches die Türken, die Erdbeben und die Ausbrüche des Vesuvs herbeiführten, sich bei aller seiner Größe doch nicht mit dem unerträglichen Drucke der spanischen Verwaltung messen könne, die zur Vergrößerung ihrer Land- und Seemacht das Land entvölkert, zur Ausrüstung von Flotten und zur Erbauung von Schiffen ungeheure Summen erpresst, alle Dörfer, die Neapel, Nola und mehreren anderen Städten gehörten, verkauft, die Handelsleute mit Schatzungen belegt, die alten Abgaben von Getreide, Öl, Salz, Seide usw. erhöht und auf Kalk, Spielkarten, Gold- und Silberdraht neue gelegt hatte. Bei der Ankunft des Herzogs von Arcos als Vizekönig befanden sich die Neapolitaner auf einer solchen Höhe des Ungemachs und Elendes, dass sie zu einer gewaltsamen Abwerfung ihrer Fesseln fast gezwungen waren. Es ist also nicht zu verwundern, dass der neue Regent, als er mit der ganzen Strenge der drückenden Gesetze die gewöhnlichen Abgaben und Steuern erheben wollte, auf Widerstand stieß. Um die allgemeine Not noch höher zu steigern, drangen nun auch die Franzosen in Neapel ein, setzten Truppen an der Insel Elba ans Land, bemächtigten sich Porto Longone und zeigten sich selbst vor dem Hafen Neapels. Der Herzog von Arcos zwang sie zwar zum Rückzuge, sah sich aber, um die Kosten dieses unvorhergesehenen Krieges zu decken, genötigt, auch noch die Baum- und Hülsenfrüchte, die einzigen Nahrungsmittel des Volkes, mit Abgaben zu belegen. Der deshalb erscheinende Befehl war das Signal zu dem Volksaufstande, der uns hier beschäftiget. Das Volk versammelte sich in Menge und forderte mit Ungestüm die Zurücknahme des Befehls. Da ihm nicht gewillfahrt wurde, so steckte es, durch den Aufstand der Bewohner Palermos und die Verbrennung des Admiralschiffes im Hafen durch einen angesehenen, feindlich gegen Spanien gesinnten, Neapolitaner ermutigt, die Zollhäuser in Brand. Es fehlte ihm nur noch ein Anführer, für den die Rache bald sorgte. Tommasso Aniello (durch Zusammenziehung des Namens Mas'Aniello, Masaniello), seit vier Jahren verheiratet und Vater von vier Kindern, war durch die Strenge des Fiskus zu der äußersten Armut gebracht worden. Seine Frau hatte einmal ein wenig in einem Strumpfe verstecktes Mehl in die Stadt geschmuggelt, war entdeckt und zu einigen Tagen Gefängnis- und einer Geldstrafe verurteilt worden. Um diese Geldstrafe zu bezahlen, hatte Aniello die unentbehrlichsten Gerätschaften seines Gewerbes verkaufen müssen und trug seit dieser Zeit den bittersten Hass gegen die Regierung im Herzen. Gewöhnliche Rache war ihm zu klein, sein Mut wuchs mit seinen Plänen und er versuchte daher zuerst die Obsthändler aufzuwiegeln, indem er ihnen im Vorbeigehen ins Ohr raunte: „keine Abgaben mehr! keine Abgaben!“ Hierauf lehrte er einige Kinder Herabsetzung des Preises der Lebensmittel fordern und schickte sie in die Stadt, um überall das, was sie gelernt hatten, auszurufen. Übrigens war Masaniello schon durch seine Spottlieder auf die Spanier bekannt, die das Volk um desto leichter im Gedächtnis behielt und nachsang, da sie schlüpfrig und grob waren. – Späterhin begünstigte ihn der Zufall und überlieferte ihm die Menge. Bei der Feier des Festes der heiligen Maria vom Karmel, im Juli, wird nämlich von einem Teil der Bewohner Neapels der Angriff und die Erstürmung einer, hier aus Holz erbauten, Feste nachgeahmt. Die Belagerten heißen Alarben, die Belagernden Lazaren. Die Ersten, sind als Türken, die Letzteren als Matrosen mit weiten Beinkleidern gekleidet, alle Jünglinge von ungefähr 20 Jahren und aus den niedrigsten Ständen. Ihre Anzahl beläuft sich auf 500 bis 600 und der Stock ist ihre Waffe. Masaniello stellte sich an die Spitze eines dieser Haufen und versah ihn mit etwas stärkeren Stöcken als gewöhnlich, die er sich durch das von einem in seinen Plan eingeweihten Karmelitermönch erhaltene Geld verschafft hatte. Drei Sonntage hintereinander werden die Streiter eingeübt. Am zweiten bemerkte Masaniello den von seinen Höflingen umgebenen Vizekönig auf dem Balkon; sogleich ließ er seine kleine Armee Halt machen und befahl einem jeden, mit dem Rücken gegen den Balkon gekehrt, die Beinkleider zu küssen. Lazzi, Gesichterschneiden und Spottreden begleiteten diesen gröblichen Spaß, den der Vizekönig belachen zu müssen glaubte. Hätte er diesen Spott Masaniellos bestraft, so wäre wahrscheinlich der fürchterliche Aufruhr im Entstehen unterdrückt worden.