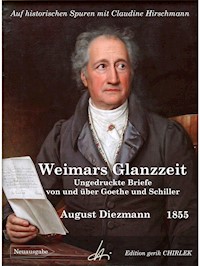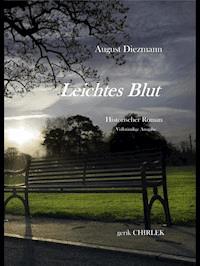
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Alte Reihe
- Sprache: Deutsch
= Digitale Neufassung für eBook-Reader = Diezmann: Ich heiße Ulrich Lenz und bin fast genau in der Mitte des lieben deutschen Vaterlandes geboren, wodurch vielleicht erklärt wird, dass der heitere, leichte Sinn des Süddeutschen mit der zähen Ausdauer und der ruhigen, langmütigen Geduld des Norddeutschen in mir sich vereinigte. Ich kam, um es noch genauer zu bezeichnen, zur Welt in einem kleinen Dorfe, das, von Wiesen umgrünt, von einem ewig tänzelnden Bache umgaukelt, zwischen sanft ansteigenden, bewaldeten Höhen versteckt liegt, wie ein Nest in einem Busche.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 539
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Leichtes Blut.
Technische Anmerkungen
Band 1
Erstes Kapitel / Band 1
Zweites Kapitel / Band 1
Drittes Kapitel / Band 1
Band 2
Erstes Kapitel / Band 2
Zweites Kapitel / Band 2
Drittes Kapitel / Band 2
Viertes Kapitel / Band 2
Band 3
Erstes Kapitel / Band 3
Zweites Kapitel / Band 3
Drittes Kapitel / Band 3
Viertes Kapitel / Band 3
Fünftes Kapitel / Band 3
Digitale Neufassungen
Impressum
Leichtes Blut.
Roman.
von August Diezmann
Band 1, Band 2, Band 3
Jena und Leipzig,
Hermann Costenoble,
1864 / 1869.
Digitale Neufassung des altdeutschen Originals
von Gerik Chirlek
Reihe: Alte Reihe / Band 15
Technische Anmerkungen
Die vorliegende digitale Neufassung des altdeutschen Originals erfolgte im Hinblick auf eine möglichst komfortable Verwendbarkeit auf eBook Readern. Dabei wurde versucht, den Schreibstil des Verfassers möglichst unverändert zu übernehmen, um den Sprachgebrauch der damaligen Zeit zu erhalten.
Band 1
Leichtes Blut.
Roman.
von August Diezmann
Jena und Leipzig,
Hermann Costenoble,
1864.
Erstes Kapitel / Band 1
Ich heiße Ulrich Lenz und bin fast genau in der Mitte des lieben deutschen Vaterlandes geboren, wodurch vielleicht erklärt wird, dass der heitere, leichte Sinn des Süddeutschen mit der zähen Ausdauer und der ruhigen, langmütigen Geduld des Norddeutschen in mir sich vereinigte. Ich kam, um es noch genauer zu bezeichnen, zur Welt in einem kleinen Dorfe, das, von Wiesen umgrünt, von einem ewig tänzelnden Bache umgaukelt, zwischen sanft ansteigenden, bewaldeten Höhen versteckt liegt, wie ein Nest in einem Busche. Einen großen, vielleicht den größten Teil meiner Knabenzeit verbrachte ich im Freien, und mein liebster Aufenthalt war der Wald. Jedes trauliche, lauschige Plätzchen darin kannte ich, jede sonnige, blumenbunte kleine Wiese, jedes Quellchen, das sich zwischen moosbewachsenen Steinen emsig und unermüdlich an das Licht hervorarbeitete, und alle Bäume waren mir vertraute Freunde. War ich doch so lange in dem Walde auf Abenteuer und Entdeckungen umhergewandert, bis er mir nichts Fremdes mehr zu bieten vermochte. Auch alle Töne und Stimmen des Waldes kannte ich genau, alle, von dem leichten Rascheln flinker Eidechsen im dürren Laube bis zu dem lauten Klopfen und Hämmern, Hacken und Meißeln des Spechtes, der so rasch und gewandt an den Baumstämmen emporzulaufen und dabei allerlei Insekten unter der Rinde hervorzutrommeln versteht; von dem leise zwitschernden Gesange des Rotkehlchens und dem Girren der Waldtaube bis zu dem schmetternden Liebesjubel der Nachtigall und des frech-eitlen Kuckucks endlosem Rufen des eigenen Namens; von dem sanftesten Säuseln des Windes bis zu dem unheimlichen Pfeifen und dem orgelartigen, majestätischen Rauschen des Sturmes in den Wipfeln der Fichten und Tannen. Andachtsschauer umfingen mich, wenn es still, feierlich still, so ganz eigentümlich ergreifend still war, wie es eben nur im Walde sein kann, wenn kein Blättchen sich regt, keine Stimme sich hören lässt, die Luft selbst zu schlafen scheint und der Fall einer reifen Eichel oder Buchnuss schauerlich weit hin schallt und das lauschende Wild wie den schlummernden Vogel erschreckt. Ein ganz besonderer Genuss war es mir, am Rande einer sonnigen Lichtung im dunkeln Schatten zu liegen und gerade hinauf, in dem Himmel über mir, zu schauen voll seltsamer Gedanken, was wohl jene dunkelblaue Tiefe bergen möge, oder dem Zuge und Spiele der Wolken zuzusehen, wenn die Schatten, derselben über die sonnenbeleuchtete Gegend eilig dahinflogen, oder auch mit der Beobachtung ihrer unablässig wechselnden Form und Gestaltung mich zu unterhalten wie mit dem Lesen eines Märchenbuches, denn sie erschienen mir bald als ferne gewaltige Gebirgsmassen, bald als Burgen und Schlösser, bald als phantastische ungeheuerliche Tiergestalten, bald selbst als menschenähnliche Köpfe und Gesichter von Riesen.
Eine große Vorliebe hatte ich einer stattlichen Eiche zugewendet, die auf dem höchsten Punkte der Gegend stand und über die anderen Bäume um sie her hoch hinausragte. Ich kannte keine größere Wonne, als in den äußersten Wipfel dieser Eiche hinauf zu steigen, wo drei eigentümlich gestellte Äste einen natürlichen, fast bequemen Sitz gewährten. Da oben saß ich dann, lauschte auf das geschwätzige leise Flüstern und Plaudern der Blätter und schaute hinaus in die unbekannte blaue Ferne. Am wohlsten aber war mir, wenn der Wind wehte und mich in der grünen Wiege da oben hin- und herschaukelte, während ich in ruhiger Sicherheit auf das Wogen des Waldes unter mir herabsah, der in solchen Stunden einem Felde riesiger Getreidehalme glich, welche im Winde sich beugen und wiederaufrichten und so grüne Wellentäler und Wellenberge bilden. O, wie viele selige Stunden voll ahnungsvoller Träume habe ich auf diesem Lieblingsbaume verbracht! Auch später, wenn ich von der Schule in die Heimat zurückkam, versäumte ich fast keinen Tag, meine liebe Eiche aufzusuchen und zu dem wohlbekannten Plätzchen in ihrem Wipfel emporzusteigen. In diesem Baumwipfel haben Schillers Gedichte zuerst mich entzückend begeistert und in ihm, glaube ich, schrieb ich auch mit Bleistift auf ein Papierblättchen die eigenen ersten Verse, die selbstverständlich „an Sie“ gerichtet waren.
Nicht minder erfreulich als die Wanderungen im Walde waren die Kinderspiele an Sommerabenden unter der mächtigen Linde vor der kleinen, altersgrauen Kirche des Dorfes, aber wenn sie mir recht und ganz zusagen sollten, mussten an diesen Spielen auch die Mädchen teilnehmen. Zwar habe ich mich auch von den wildesten Knabenspielen, wie Wettlaufen, Wettwerfen, Springen, Ringen und allerlei Kämpfen niemals ausgeschlossen, im Gegenteil, dieselben meist veranlasst, angeregt und angeordnet, aber wohler als dabei befand ich mich doch immer in Mädchengesellschaft. Ein unbeschreibliches Gefühl, eine Empfindung, die ich mir damals nicht zu erklären vermochte, etwas seltsam Bängliches und doch wieder unendlich Wohltuendes zitterte mir durch die jungen Glieder, wenn ich eine Mädchenhand berührte oder in ein freundliches Mädchenauge sah. Jetzt weiß ich wohl, dass es die Liebe war, die, knospend gleichsam, in so früher Knabenzeit schon in mir sich regte und entwickelte, weil sie sich zeitig zur vollen Blüte entfalten sollte, zu einer Blüte mit süß berauschendem, ja, mit betäubendem Dufte. Ich erinnere mich namentlich eines kleinen, ungewöhnlich zierlichen Mädchens mit prächtigen goldfarbigen dicken Zöpfen, veilchenblauen Augen und frisch blühenden Wangen. Sie war außerordentlich schüchtern und scheu, deshalb nur schwer und selten zu bewegen, in ein Spiel mit einzutreten. Wenn sie es aber tat und mit ihren lieben, lächelnden Augen mich ansah, dann war es mir stets, als wolle sich der Schleier vor einem wunderbaren Geheimnis heben. Ich glaubte in ihren Blicken den Ausdruck zu lesen, dass meine Nähe und meine Freundlichkeit gegen sie ihr ebenso wohltue, wie mir die ihrige tat. Die Mädchen wissen ja sehr bald mit den Augen zu reden, und sie können mit denselben langen Geschichten schon dann erzählen, wenn die Knaben in der Regel die ersten Elemente dieser Sprache noch nicht begriffen haben. Jedenfalls war es jenes kleine zierliche Bauermädchen, das mich zuerst in die Kenntnis jener schönsten und wunderbarsten Sprache, der Sprache der Augen, einführte. Leider verlor ich das liebliche Kind sehr bald aus dem Gesicht, weil die Eltern desselben, sich anderswo niederließen, und ich habe die kleine Schöne nie wiedergesehen, auch nie wieder etwas von ihr gehört. Wer weiß, welche rohe, plumpe Hand diese zarte Mädchenblume zerpflückte und zerdrückte! An der Pforte des Paradieses meiner Jugend stand sie als freundlich hütender Engel, der alles Rohe und Gemeine von mir fernhielt, und so sehe ich sie heute noch vor mir.
Zu unseren festlichsten Lustbarkeiten gehörte im Winter eine eigentümliche Schlittenfahrt, die allerdings anderes Schlittenfahren auch nicht ausschloss. In der Mitte des zugefrorenen nicht ganz kleinen Dorfteiches wurde nämlich ein starker Pfahl eingerammt und auf die obere abgerundete Spitze desselben ein etwa zehn Ellen langer Baumstamm gesteckt, in dessen Ende ein entsprechendes Loch gebohrt oder gemeißelt war. Das andere untere Ende dieses Stammes ruhte auf dem Eise. An diesem unteren Ende nun wurde ein kleiner Schlitten befestigt, und der Stamm dann um den Pfahl herumgedreht. Auf den Schlitten an dem Stammende setzten wir uns der Reihe nach, meist paarweise, ein Junge mit einem Mädchen auf dem Schoße, während die anderen sich an den Stamm stemmten und ihn so schnell als möglich herumdrehten. Man kann sich denken, wie pfeilschnell der kleine Schlitten im Kreise herumflog, und welcher Jubel auf dem Teich herrschte, wie grimmig kalt es auch bisweilen war. Schwerlich aber kann man sich vorstellen, was ich empfand, wenn das erwähnte zierliche Mädchen sich bewegen ließ, mit mir – sie tat es mit keinem andern – auf dem glatten Eise so dahinzufliegen, wenn sie sich ängstlich an mich schmiegte und ich sie mit meinen Armen fast krampfhaft festhielt, wenn mit der eigentümlichen Empfindung, welches solches Dahinjagen, solches pfeilschnelle und atemversetzende Luftdurchschneiden namentlich auf jugendliche Nerven hervorbringt, wenn mit dieser beängstigenden Wonneempfindung in mir jene ganz und gar unbeschreibliche sich verband, die liebste Jugendgenossin schützend festzuhalten und ihr zitterndes Herz an dem meinigen zu fühlen.
Ein ähnliches Vergnügen gewährte uns eine mächtige Schaukel, welche in der dick mit Stroh belegten Tenne der großen Pfarrscheune sich befand, hoch oben an den Deckbalken befestigt war, und, von mehreren Knaben mit aller Kraft gezogen, wohl zehn bis zwölf Ellen hochschwang. Auch auf dieser Schaukel mussten stets zwei gleichzeitig sitzen, weil außerdem jeder einzelne zu lange hätte warten müssen, ehe die Reihe an ihn kam. Dass ich auch auf der Schaukel, mit dem gleichen Gefühle wie auf dem Schlitten, jene ängstliche Kleine am Liebsten bei mir hatte, zumal sie keinem der anderen Knaben diese Gunst gewährte, brauche ich schwerlich ausdrücklich zu erwähnen.
Bei den Vorbereitungen zu manchen unserer Spiele bedurften wir, wie man schon bei der Teichschlittenfahrt gesehen hat, der Beihilfe und Unterstützung geschickterer Hände und kräftigerer Arme, als wir Kinder sie besaßen. In allen solchen Fällen wendeten wir uns an meinen Vater, und wir konnten jeder Zeit sicher auf seine Mitwirkung zählen, denn er hatte große Freude am Treiben lustiger Knabenspiele, weil er selbst – bis an sein leider frühes Ende – ein wahrhaft kindliches Gemüht in sich trug, und nichts ihn mehr verdross und unwilliger machen konnte, als wenn andere Männer im Dorf unsere, allerdings bisweilen ausgelassenen Spiele stören oder gar verhindern wollten. Ich glaube sogar, dass seine Bereitwilligkeit, uns dabei förderlich und behilflich zu sein, häufig geradezu aus seiner Überzeugung hervorging, er ärgere durch solches Tun manchen griesgrämigen Alten. Er kannte in der Tat keine größere Freude, als irgendjemanden eine – bisweilen sogar sehr derbe – Neckerei zu spielen, oder, wie wir sagten, einen Schabernack anzutun. Um einen solchen auszuführen, scheute er weder Mühe noch Zeit. Er konnte Tage lang mit unendlicher Geduld solche Schelmereien vorbereiten, wohl auch Stunden weit gehen, um von da etwas herbeizuholen, dessen er nach seinem Plane zur Ausführung bedurfte. Er war in solcher Zeit meist ungewöhnlich still, aber still vergnügt; um seine Mundwinkel spielte dann ein leichtes Schalkslächeln, und seine Augenbrauen zogen sich an den äußeren Seiten noch mehr als sonst mephistophelisch in die Höhe. Die Mutter, seit längerer Zeit fast ununterbrochen kränklich, in ihrer Jugend, wie es hieß, eine seltene Schönheit, jetzt eine Frau mit unsäglich gutmütigen blauen Augen und dicken, kohlschwarzen Brauen darüber, mit dem weichsten Herzen, aber doch voll ausdauernden zähen Mutes, – die Mutter, sage ich, erriet stets sofort, wenn wiederum ein Schelmstückchen ausgeführt werden sollte, und sie machte dem Vater mit Lächeln Vorwürfe darüber, dass er „doch ewig ein Kind bleibe.“ Gewöhnlich antwortete er darauf weiter nichts, als: „zanke nicht, Mutter“, während in seinen Augen der Schalk schon im Voraus über das Gelingen des Planes lachte, mit dem er sich eben beschäftigte. Die meisten der Neckereien, die er ausführte, waren freilich gewissermaßen Züchtigungen für etwas, das der Betroffene getan oder unterlassen hatte, eine Art Volksjustiz, die er auf eigene Faust ausübte. So trug er einmal in stockfinsterer Mitternacht, leise und vorsichtig wie ein Dieb und mit Anstrengung aller seiner Kräfte, den Ackerpflug eines Nachbars, der jeden Tag und fast den ganzen Tag im Wirtshause trinkend saß und darüber seine Feldarbeiten versäumte, auf einer langen Leiter hinauf auf das Dach des Hauses jenes Nachbars, und stellte ihn da auf den Schornstein. Als am andern Morgen alle Finger im Dorfe nach dem seltsamen Aufputz jenes Hauses deuteten und der Besitzer desselben mehrere Leute aufbieten musste, um den Pflug wieder herunterzuschaffen, alle auch – scheinbar – sich den Kopf zerbrachen, wer wohl den Schabernack ausgeführt habe, obwohl niemand zweifelte, wer der Täter gewesen, ging mein Vater so befriedigt umher, als sei ihm eine große oder doch wenigstens eine gute Tat gelungen. Und der so Geneckte begann allerdings noch an demselben Tage seine bis dahin versäumten Arbeiten.
Wenn ich oben sagte, mein Vater habe keine größere Freude gekannt, als solchen Schabernack auszuführen, so tat ich schweres Unrecht, und alle, die ihn gekannt haben, werden solcher Behauptung widersprechen. Das Necken und Schabernacken war ihm allerdings eine große Lust, und er konnte niemals der Versuchung dazu widerstehen, aber es gab doch etwas, das er mit noch größerem Eifer und mit noch rascherer Bereitwilligkeit tat, nämlich irgendeinem, wer er auch sein mochte, gleichviel ob der beste Freund, der schlimmste Feind oder ein ganz Fremder, eine Gefälligkeit zu erzeigen oder ihm in Not, Leid oder Gefahr beizustehen. Bei jedem Unglücksfall im Dorfe oder in dessen Nähe war er sicherlich unter den Helfenden der Erste, der Tüchtigste, ja der Tollkühnste, denn an sich, an seine Gesundheit, an sein Leben und seine Familie dachte er da ganz und gar nicht. Hatten unverständige Eltern einem Kinde zu schwere Arbeit aufgegeben, und mein Vater sah es, so half er sicherlich zunächst dem Kinde und dann schalt er die Eltern desselben tüchtig aus. War im Dorfe jemand plötzlich schwer erkrankt und die Familie hatte niemand, den sie in die nächste Stadt zum Arzte hätte schicken können, so wandte sie sich gewiss an meinen stets hilfebereiten Vater, ihn um den Liebesdienst zu ersuchen. Zu jeder Stunde des Tages, trotz wirklich dringender Arbeit, wie zu jeder Stunde der Nacht war er freudig bereit, zu raten und zu helfen, wo und wie er konnte. Hunderte von Beispielen solcher Art könnte ich erzählen, aber ich unterlasse es, denn ich würde durch solches Erzählen und Rühmen ihn im Grabe kränken, weil er alles das, was er für andere tat, keineswegs für etwas Verdienstliches hielt, sondern der Ansicht war, es verstehe sich das von selbst. Auf der anderen Seite nahm er fremde Hilfe nur im alleräußersten Falle in Anspruch, denn sein Grundsatz lautete: „Hilf dir selbst, denn du musst es; hilf den anderen, denn du kannst es.“
Einer der wichtigsten Vorgänge in unserem Dorfe, der in diese meine frühe Knabenzeit fiel und einen unauslöschlichen Eindruck in meiner Erinnerung zurückgelassen hat, war eine ungewöhnlich große Hochzeit, die acht Tage lang gefeiert wurde. Weder die Eltern der Braut, noch die des Bräutigams, welche letztere in dem nächsten Städtchen wohnten, waren besonders wohlhabend, und ich weiß nicht, was die Leute veranlasste, diese Hochzeit so ganz außerordentlich glänzend zu begehen, wenn es nicht etwa der Umstand war, dass die Braut einen ansehnlichen Höcker hatte und der Bräutigam sehr bedeutend hinkte. Lange vor der Feier schon sprach Alt und Jung von nichts anderem als dieser Hochzeit, und die Vorbereitungen zu derselben beschäftigten das ganze Dorf. Dass mein Vater eine große Rolle dabei spielte und spielen musste, ließ sich bei seiner Allbeliebtheit und Hilfebereitwilligkeit im Voraus erwarten. Und so geschah es. Zunächst übernahm er das Amt des Hochzeitsbitters. Als solcher hatte er eine drollige poetische Einladung einstudiert, die wer weiß von wem verfasst war, und die er in den einzuladenden Familien vortragen sollte. Er machte aber die Rundwanderung nicht etwa zu Fuß, sondern stolz zu Pferd. Ich sehe ihn noch vor mir, wie er, am Hut und auf den Achseln mit vielen flatternden, bunten Bändern aufgeputzt, auf einem jungen, wilden Rappen, der an Mähne und Schweif ebenfalls überreich mit Bändern geschmückt war, ohne Sattel im gestreckten Galopp durch den spritzenden Schmutz der Dorfgasse jagte, um den Verwandten und Freunden des Bräutigams in der Stadt die Einladung zu überbringen. Wie sich die zahlreichen Gäste eine ganze Woche lang während der Hochzeitsfeier unterhalten haben mögen, kann ich nicht angeben, ich weiß nur, dass sehr viel gegessen und noch mehr getrunken, dass gespielt und getanzt wurde. Ein Ereignis am letzten Tage dieser langen Hochzeitsfeier nur ist mir sehr deutlich in der Erinnerung geblieben. Es sollte ein Wettlauf der sämtlichen männlichen Gäste gehalten werden, und der Preis für den Sieger ein gewaltiger Kuchen sein.
Das Dorf liegt am Abhange eines kleinen Höhenzuges im Osten. Von ihm aus dehnt sich ein Wiesenplan einige tausend Schritte breit bis an den Abhang der Höhe im Westen. Am Fuße dieser letzteren schlängelt sich der schon erwähnte Bach hin, und von dem Dorfe aus führt nach dieser Seite hin über die Wiese ein Weg, den ein Steg ohne Lehne über den Bach in den sich dicht anschließenden Wald hineinträgt. Jene Wiese sollte der Rennplan sein. Dicht an dem Dorfe, unter einer Erlengruppe, war der Sammelplatz der Wettlaufenden wie der Zuschauer, und am Ende der Wiese, dicht vor dem Steg über den Bach, ward der Preiskuchen auf einem Tisch ausgestellt. Die Gäste aus dem Städtchen hielten sich natürlich für gewandter und schnellfüßiger als die Dörfler, und wohl ein jeder dieser ersteren meinte, ihm könne der Preis unmöglich entgehen. Die Aufregung und Spannung war sehr groß. Als alle Vorbereitungen beendet waren, wurde durch einen Trompetentusch das Zeichen zum Beginn des Wettlaufes gegeben. Sehr eifrig und hitzig begannen ihn alle, bald aber stolperte der eine und der andere fiel gar, darüber lachten andere und blieben zurück; einige, die wahrscheinlich mehr getrunken hatten, als gerade zu einem Wettlauf gut war, konnten die gerade Linie nicht einhalten, und kamen bald genug mehr oder weniger weit rechts oder links von der rechten Richtung ab; anderen ging unerwartet schnell der Atem aus, oder sie sahen aus anderen Gründen ein, dass sie schwerlich zuerst an das Ziel gelangen würden. So stellte einer nach dem andern den nutzlosen Wettlauf ein, so dass schon in der Mitte des Wiesenplans nur noch etwa sechs Läufer, tapfer und mutig wetteifernd, aushielten. Sie näherten sich rasch dem lockenden Ziele. Da sprang plötzlich ein Mann mit geschwärztem Gesicht und in zerlumptem Anzuge aus dem Walde jenseits heraus, lief schnell und hastig über den Bachsteg, ergriff den großen Preiskuchen, und kehrte mit dieser seiner Beute, so rasch wie er gekommen war, in den Wald zurück. Das Erscheinen des Mannes und sein Verschwinden mit dem Kuchen war das Werk fast eines Augenblicks. Die Wettlaufenden, welche sämtlich die Augen unverwandt auf ihr Ziel und den sie da erwartenden Preis gerichtet hatten, stutzten bei dem überraschenden Erscheinen des schwarzen Räubers und hielten im Laufe inne, weil sie nicht sogleich wussten, was sie nun beginnen sollten. Erst als einer aus der Menge der Zuschauenden mit lauter Stimme rief: „Nach! Fangt ihn!“, kamen sie zur Besinnung und taten, was sie sogleich hätten tun sollen. Sie, die Wettlaufenden nicht nur, sondern fast alle auf dem Platze Anwesenden beeilten sich, so rasch als möglich über die Wiese und über den Steg in den Wald hineinzukommen, denn man meinte, wenn so viele in dem Walde suchend und verfolgend sich verteilten, könne ihnen der Räuber unmöglich entgehen, ja man werde seiner sehr bald habhaft werden. Man hielt ihn für einen allbekannten und gefürchteten Vagabunden und Bettler aus dem Städtchen, der Heimat des Bräutigams und glaubte, er habe sich von der großen Hochzeit auch etwas holen wollen. Der aber, welcher den „Raub“ begangen hatte, war jedenfalls besser mit allen Örtlichkeiten bekannt gewesen, als seine zahlreichen Verfolger. Er hatte, sobald er über den Steg wieder in den Wald gekommen, keineswegs die Richtung nach Norden, nach dem Städtchen, in welcher man den angeblichen Bettler eifrig verfolgte, sondern jene nach Süden eingeschlagen, wo die beiden Höhenzüge sich zusammenschließen, und von da aus den Weg in das Dorf zurück lange gefunden, auch die Schwärze vom Gesicht bereits gewaschen, als die Verfolger, einer nach dem andern, von ihren vergeblichen Anstrengungen erschöpft und fluchend, zurückkamen.
Der „schwarze Räuber“ war kein anderer gewesen, als der Hochzeitsbitter, der auch bei dieser gar zu lockenden Gelegenheit der Lust an Necken und Schabernack nicht hatte widerstehen können. Er brachte, wie sich von selbst versteht, den Preiskuchen triumphierend in das Hochzeitshaus und zog die Brautmutter in das Geheimnis. So erfuhren die Gäste den Zusammenhang erst bei dem Abschiednehmen, als einem jeden ein großes Stück des so schmerzlich vermissten und tief betrauerten Preiskuchens zur Erinnerung an den Vorgang auf den Heimweg mitgegeben wurde.
Kurze Zeit darauf traf mich selbst ein Unfall, den ich hier erzählen muss, weil er einen entscheidenden Einfluss auf mein Leben übte, indem er dem Gange desselben eine völlig unerwartete Richtung gab. Bei einer Nachahmung jenes Wettlaufes und Kuchenraubes, die wir Jungen im Dorfe an einem Sonntagnachmittag anstellten, fiel ich so unglücklich, dass ich dabei den rechten Oberschenkel brach. So war auch dieser nachgeahmte Wettlauf gestört. Man musste mich nach Hause tragen, und welche Schmerzen ich in den Wochen zu erdulden hatte, in denen ich mit dem gebrochenen Gliede unbeweglich still im Bette liegen musste, mitten im schönsten Sommer, will und kann ich nicht beschreiben. Sie waren schlimm genug; aber noch viel schlimmer peinigte mich die Langeweile und die Sehnsucht nach dem Freien, nach dem Walde. Als die Meinigen gar nicht mehr wussten, womit mir die Zeit einigermaßen zu vertreiben sein könnte, brachte man mir „die schöne Magelone“ und den „hörnernen Siegfried“, dünne Heftchen, „gedruckt in diesem Jahr“. Ich fing also an zu lesen, fand dabei eine bisher ganz ungeahnte Unterhaltung und verlangte mehr und immer mehr dergleichen. Alle Bücher, die sich zufällig in dem Dorfe fanden, alle alten Kalender und dergleichen mussten mir zugetragen werden auf mein Schmerzenslager. Eine Geschichte der Türkenkriege in Ungarn, mit gräulichen Schlacht- und Belagerungsbildern, die sich, wer weiß wie, in das Dorf verirrt hatte, beschäftigte mich mehrere Tage lang auf das Lebhafteste.
Während bis dahin unser Dörfchen mit seinen Umgebungen meine Welt gewesen war, tat sich nun vor mir eine neue, weite, unbegrenzte auf. Ich erfuhr zum ersten Mal, dass es sogar andere Sprachen, als die liebe Muttersprache, und dass es eine ungeheure Anzahl Bücher in allen diesen verschiedenen Sprachen gebe. Welche Aussicht also auf endloses Lesen! Weil ich indes gar vieles in den Büchern, die man mir bis dahin gebracht, nicht verstanden hatte, fühlte ich drückend meine Unwissenheit, die mich wie schwarze Finsternis umgab, und es entstand in mir ein fast fieberhaftes Sehnen und Verlangen nach Licht, nach Wissen. So ging aus der unersättlichen Leselust allmählich ein brennender Lerndurst hervor. Wie ich es anzufangen habe, viel, womöglich alles zu lernen und zu wissen, konnte mir freilich niemand sagen; man wusste in dem Dorfe nur, dass die, welche viel lernen wollten, eine „hohe“ Schule in der Stadt besuchen müssten, was man „studieren“ nannte. Also studieren! Um jeden Preis studieren! Ich bat die Eltern tagtäglich und so lange, sie sollten mich „studieren“ lassen, bis sie mir versprachen, mit dem Herrn Pfarrer darüber zu sprechen, und sie versprachen es bald und gern, denn ihre Liebe zu mir, dem einzigen Kinde, das sie so lange an das Schmerzenslager gefesselt hatten sehen müssen, war durch das Mitleid womöglich noch gesteigert worden. Vielleicht wirkte indes auch die stille Hoffnung mit, dass sie ihren Ulrich, wenn sie ihn studieren ließen, später einmal im schwarzen Priesterrock auf der Kanzel der heimatlichen Kirche stehen sehen und ihn predigen hören könnten; denn dies ist ja, oder war wenigstens damals, häufig der höchste Wunsch und Stolz der Landleute, welche einen ihrer Söhne studieren lassen.
Der Pfarrer, ein sehr verständiger Mann, der meinen aufgeweckten Sinn schon kannte und große Freude an meinem täglich wachsenden Lerneifer hatte, erbot sich bereitwillig, mir, sobald ich wieder werde gehen können, den notwendigen ersten Unterricht im Lateinischen zu geben. Lateinisch! Später, wenn ich das erste Mal vor einem altehrwürdigen großartigen Bau, vor einem Dom z. B. stand, erinnerte ich mich stets meiner damaligen Empfindungen, als mir der Eintritt in jene fremdartige, geheimnisvolle Sprache verheißen war. Und sobald der gebrochene Fuß so weit geheilt war, dass ich wieder Gehversuche machen durfte, wanderte ich, anfangs noch auf eine Krücke gestützt, in das nahe Pfarrhaus. Allerdings hatte ich mir das Erlernen des Lateinischen, wie überhaupt einer fremden Sprache, wohl um vieles leichter vorgestellt, als es in der Tat ist, weil ich mich nicht erinnerte, dass mir das Erlernen der deutschen Schwierigkeiten geboten hatte; aber ich ließ mich doch nicht abschrecken, meinen Lerneifer nicht erkalten und machte im Ganzen rasch ziemlich bedeutende Fortschritte.
In der gewöhnlichen Dorfschule, die ich mit den anderen Kindern besuchte, und welche nur Lesen (in der Bibel), Schreiben und notdürftiges einfaches Rechnen lehrte, dagegen eine zahllose Menge von Gesangbuchliedern und Bibelsprüchen zum Auswendiglernen aufgab, übersah ich bald alle meine Mitschüler und Mitschülerinnen, denn die Knaben und Mädchen waren in der Schulstube nicht getrennt. Alle staunten es z. B. als eine Wunderleistung an, wenn ich die Hunderte fremdartiger Namen eines jüdischen Familienstammbaumes, die bekanntlich viele lange Kapitel, im alten Testamente füllen, die bei dem Lesen nicht übergangen werden durften, und von den anderen Kindern nur mit großer Mühe, oder auch gar nicht zusammenbuchstabiert werden konnten, rasch hintereinander und ohne Anstoß vorlas. Solcher Art waren meine ersten Triumphe, und welche Auszeichnungen ich mir auch in späterer Zeit zu erwerben Gelegenheit fand, keine hat mich mit größerer Freude und höherem Stolze erfüllt. Ich war aber auch der erklärte und wohl zu sehr vorgezogene Liebling des alten Lehrers, von dem ich, vielleicht eben deshalb, nur eine einzige Strafpredigt anzuhören hatte, und diese auch nur, weil ich während des Unterrichts und laut einen gotteslästerlichen Zweifel auszusprechen mich nicht gescheut hatte. Er erzählte einmal viel von der unendlichen Liebe, Güte, Barmherzigkeit und Langmut Gottes, ich aber konnte mir, bei dem besten Willen, keine liebevollere Güte und keine langmütigere Nachsicht denken, als die meiner Mutter, an der ich mit schwärmerischer Liebe und Verehrung hing, und ich wagte deshalb den alten eifrigen Lehrer mit der Bemerkung laut zu unterbrechen: gütiger und liebevoller als meine Mutter könne selbst der liebe Gott nicht sein. Da schwieg der alte Mann eine Zeit lang, dann sagte er in so tiefer Bewegung, dass seine Stimme bebte: er habe vorausgeschickt, dass Gott gütig, liebreich und barmherzig sei über alles menschliche Begreifen; wenn trotzdem ein naseweiser Junge sich unterfange, Zweifel daran auszusprechen, so sei dies eine Lästerung, also ein schweres Verbrechen. Diese vorwurfsvollen Worte trieben mir zwar brennende Schamröte in die Wangen, aber meine kindlichen Zweifel vermochten sie dennoch nicht zu zerstreuen. Nach Beendigung der Schulstunden nahm mich der Lehrer bei Seite, legte die eine Hand auf mein blondes Haar, streichelte mir mit der andern die roten Backen und sagte freundlich:
„Du hast schon Recht, mein Sohn, wenn du deine Mutter über alles auf Erden liebst, auf Erden, aber selbst die Liebe zu der Mutter kann eine Sünde werden, wenn sie sich über die Liebe zu Gott erheben will. Er möge dein junges Herz vor allem Zweifel bewahren immerdar und dich so fromm und gut erhalten, wie du bis jetzt gewesen bist.“
Damit entließ er mich. Ich war tief gerührt; die Sache beschäftigte meine Gedanken aber noch eine gar lange Zeit, und meine Mutter liebte ich von da an womöglich noch viel mehr.
Ich weiß nicht, ob mir dieser Lehrer einen besonderen Beweis seiner Zuneigung, gewissermaßen eine Entschädigung für jene öffentliche Rüge geben wollte, genug, er erbot sich bald darauf, mir Unterricht in der Musik zu erteilen. Begierig, wie immer, wenn es galt, etwas Neues zu lernen, nahm ich sofort dies Anerbieten an, und schon am nächsten Tage darauf begann ich die Buchstaben einer neuen Sprache, die Noten, mir erklären zu lassen. Dann folgte Unterricht auf einem kleinen Klavier, später auf der Orgel, und es war noch nicht ein Jahr vergangen, so konnte ich einen neuen Triumph feiern, denn mein alter Lehrer gestattete mir, an einem Sonntagsnachmittag ein Lied, welches die Gemeinde in der Kirche sang, mit der Orgel zu begleiten. Gewiss hat nie ein römischer Feldherr stolzer, auf seinem Triumphwagen gestanden, als ich an jenem Nachmittag auf der schmalen Orgelbank saß, und sicherlich hat auch niemals das römische Volk einen Triumphator mit größerem Erstaunen angeschaut, als meine Mitschüler bei dieser Gelegenheit mir zusahen.
Als ich zwölf Jahre alt geworden war, hielt der Pfarrer mich für befähigt, in die dritte Klasse eines Gymnasiums einzutreten. In einer etwa fünf Stunden von unserem Dorfe entfernten Stadt befand sich eine solche, und zwar altberühmte Schulanstalt, und da der Pfarrer einmal in jener Stadt Geschäfte zu besorgen hatte, erbot er sich freundlich, mich mit sich zu nehmen und dem Rektor des Gymnasiums vorzustellen, damit er mich prüfe und über meine Aufnahme entscheide. Da ich die Prüfung gut bestand, so wurde mir die ersehnte Aufnahme zugesagt, und meine Freude war grenzenlos, weil ich mich ja der Erfüllung meines Lieblingswunsches nun endlich ganz nahegebracht sah. Ich kehrte in fieberhafter Aufregung noch einmal in die Heimat zurück. Anfangs konnte ich die Zeit kaum erwarten, in welcher ich das Dorf verlassen sollte, und ich zählte die Tage und die Stunden, die ich da noch aushalten musste. Je geringer aber die Zahl dieser Tage wurde, umso stiller ging ich umher, und ein Gefühl herzbeengender Bangigkeit ergriff mich, namentlich als ich alle meine Lieblingsplätzchen im Walde vor dem Scheiden noch einmal aufsuchte, um Abschied von ihnen zu nehmen. Als endlich meine kleine Ausstattung fertig und gepackt war, als der Wagen, der mich hinwegbringen sollte von allem, was mir bis dahin lieb und teuer gewesen war, vor der Tür stand, als ich Abschied vom Elternhause nehmen sollte, ach! wie viel Tränen flossen mir heiß über die Wangen! Und doch waren Vater und Mutter noch bei mir, denn sie begleiteten mich beide in die fremde Stadt, um mich selbst der Familie zu übergeben, deren Pflege und Obhut ich anvertraut werden sollte. Ich habe seitdem viele schmerzensreiche Stunden erlebt, aber schmerzlicher war doch keine, als die, in welcher die Eltern, der immer heitere Vater und die unendlich liebevolle Mutter, ohne mich in die Heimat zurückkehren mussten, als die Mutter lautweinend mich noch einmal an ihr Herz drückte, mich mit ihren Küssen und Tränen bedeckte, ja als ich große Tränentropfen selbst in den Augen des Vaters sah, die ich bis dahin fast nur lachend gekannt hatte. Er drängte indes den Abschiedsschmerz mit Anstrengung zurück, ermahnte mich zum Fleiß, empfahl mich dringend nochmals meiner Pflegefamilie, zog mit freundlichem Zwang die Mutter aus meinen Armen, und ich – ein Kind noch – stand allein in der fremden Welt. Ich vermochte mich kaum zu fassen in meinem Herzensweh, denn ich fühlte mich unsäglich einsam und verlassen. Vielleicht empfindet etwas Ähnliches der Vogel, den man draußen im freien grünen Walde einfängt, in die Stadt bringt und in einen Käfig einsperrt. War ich doch in der Tat auch in der Freiheit, im Walde gleichsam, aufgewachsen, hatte mich bis dahin nur in den Armen der Natur, jener andern geliebten Mutter, wohl befunden und sah mich nun in der düstern alten Stadt, deren enge Gassen mit den hohen, kalten, steinernen Häusern mich beengten, als wollten sie mein jugendliches, ängstlich zuckendes Herz zerdrücken.
Es folgten traurige Wochen krankhaften Heimwehs, in denen ich so oft als möglich hinaus auf eine Anhöhe in der Nähe der Stadt lief, um, wenn auch nicht das im Walde versteckte ferne heimatliche Dorf selbst, doch ziemlich genau die Stelle, wo es liegen musste, zu sehen. Ganz deutlich erblickte ich bei diesen sehnsuchtsvollen Wanderungen wenigstens den mir sehr wohlbekannten weißen Kirchturm eines auf der Höhe liegenden Nachbardorfes. Ihn begrüßte ich jedes Mal wie einen getreuen, lieben Freund, und wenn ich endlich in die alte Stadt zurückkehren musste, sah ich mich stets zu wiederholten Malen nach ihm um, ob er noch immer dastehe und nicht etwa auch verschwunden sei, wie alles andere, das ich bisher geliebt, und ich trug ihm Grüße auf an meine Welt, an den Vater und die liebe Mutter.
Dass ich an dem Heimweh so gar schmerzlich litt, hatte seinen Grund wohl auch in dem Umstande, dass ich mich anfangs unter meinen neuen Mitschülern nichts weniger als wohl befand. Sie waren meist kecke Buben aus der Stadt selbst, standen in den nur zu wohl bekannten Flegeljahren und kamen mir nicht eben freundlich entgegen, sondern benutzten vielmehr eifrig jede Gelegenheit, den schüchternen und unerfahrenen „Neuen vom Dorfe“ womöglich zu hänseln und in allerlei Verlegenheit zu bringen.
Die Zeit heilt indes alles Leid, am schnellsten in der Jugend. Auch mir brachte sie allmählich Linderung des großen Herzenswehes, an dem ich litt, namentlich, weil meine drei nächsten Nachbarn in der Klasse mich bald näher und besser kennenlernten und dann liebgewannen. Ich habe ihnen dafür eine unveränderliche dankbare Freundschaft bewahrt. Der eine von ihnen ist jetzt ein vielbeschäftigter Arzt, der zweite Mitglied eines hohen Gerichtshofs und der dritte ein bekannter Reiteroberst.
Ehe ich fortfahre, mein Schulleben weiter zu schildern, muss ich die Leser in die Familie einführen, der ich übergeben worden war. Sie bestand aus einer Frau, die sich Witwe nannte und über vierzig Jahre zählen mochte, und aus ihren zwei Töchtern, von denen die ältere achtzehn und die jüngere fünfzehn Jahre alt war. Die Mutter war sehr groß, sehr hager, sehr ernst und kalt und sehr stolz, die ältere Tochter dagegen, welche den wunderlichen Namen Dulcamar führte und gewöhnlich Süß‘chen genannt wurde, kaum mittelgroß, aber jugendlich voll, sehr sanften, weichen Gemüts, sehr still und schweigsam, auch wie es schien, fortwährend mit trüben Gedanken beschäftigt, was ihren zwar nicht schönen, aber angenehmen Zügen einen Ausdruck tiefen Leidens oder vielmehr schmerzlicher Schwermut gab. Dieser Ausdruck wurde dadurch noch erhöhet, dass sie sich unverändert ganz schwarz kleidete. Ihre jüngere Schwester, ein Backfisch der aller unangenehmsten Sorte, schien in jeder Hinsicht das vollkommene Ebenbild der Mutter zu werden.
Die Familie befand sich in nichts weniger als glänzenden Verhältnissen, hatte aber jedenfalls viel bessere Tage gekannt. Süß‘chen nähte emsig täglich vom frühesten Morgen bis zum Abende, ja oftmals bis spät in die Nacht hinein, für andere, wie ich bald bemerkte, weil sie durch ihren geduldigen Fleiß und ihre Geschicklichkeit das meiste zur Erhaltung der ganzen Familie erwerben musste. Wohl kaum einmal habe ich sie lachen sehen; auch gönnte sie sich keine andere Unterhaltung und kein anderes Vergnügen, als dass sie bisweilen, an einem Sommerabend oder in der Dämmerstunde im Winter eine Mozartische Sonate auf dem Klavier spielte, oder auch, um mir eine rechte Festfreude zu machen, eine Zumsteg'sche Ballade sang und sich dazu auf dem Instrument selbst begleitete. Ihre Stimme war zwar nur klein und wohl auch nur wenig ausgebildet, aber sie sprach ungemein zum Herzen und erhielt nicht selten einen tief ergreifenden, dramatischen Ausdruck. So gern ich nun auch das Mädchen spielen und namentlich singen hörte, wagte ich doch gar bald nur selten sie zu bitten, mir diesen Genuss zu gewähren, weil sie jedes Mal bei solchem Spiel oder Gesang noch viel schwermütiger wurde, als sie es gewöhnlich war, ja bisweilen sogar plötzlich sich unterbrechen musste, weil ihr die Tränen in die Augen traten und sie dieselben trotz aller Anstrengung nicht zurückhalten konnte. Erst nach und nach erfuhr ich einiges von der traurigen, seltsamen Geschichte der Familie, und damit auch etwas von der Ursache der Schwermut des gefühlvollen Mädchens, wenn mir das Ganze auch rätselhaft blieb.
Die „gnädige Frau“, wie die Witwe genannt wurde, war in ihrer Jugend eine blühende, aber kalte und stolze Schöne gewesen, die Tochter eines reichen Kaufmannes, Sebastian Müller, der nach dem Tode seiner Frau von den Geschäften sich zurückgezogen und wegen seiner maßlos stolzen Tochter den Adel gekauft hatte. Diese seine einzige Tochter wies die zahlreichen Bewerber, die sich um ihr Herz und ihre Hand, mehr aber noch um ihr Geld bemühten, mit geringschätziger Kälte zurück, weil sie alle entweder gar nicht adelig, oder doch nur von niederem Adel waren, sie aber ihre Schönheit so hoch im Preise hielt, dass sie dieselbe nur für eine Grafenkrone hingeben zu dürfen glaubte. Ihr eitler Vater begünstigte und unterstützte alle ihre derartigen hochfliegenden Pläne.
Da erschien plötzlich ein Baron von Lynck, dessen echt vornehmes Wesen und ganzes Auftreten das größte Aufsehen in der Mädchen- und Frauenwelt der Umgegend, und, vielleicht gerade deswegen, auch auf jenes bis dahin so spröde Herz einen tiefen Eindruck machte. Der Baron war Offizier gewesen, hatte aber wegen schwerer Verwundung und aus andern Gründen seinen Abschied von dem Militär genommen. Jetzt war er auf einer Reise durch Deutschland begriffen, teils um seine Gesundheit vollends zu kräftigen, teils um die Gegenden des Vaterlandes kennenzulernen, die er noch nicht gesehen. Sehr bald kam es zu einem Liebesverhältnis zwischen ihm und der Tochter des reichen Herrn von Müller, die es für einen großen Triumph hielt, den allbegehrten und ersehnten interessanten Fremden allen anderen zu entziehen und für sich zu gewinnen. Der Vater gab seine Einwilligung zu der Verbindung der beiden Liebenden umso bereitwilliger, als er sich freute, seine Tochter von dem Verlangen nach einem Grafen zurückkommen zu sehen, weil er schon fürchtete, die Hoffnung aufgeben zu müssen, die Tochter ganz nach ihrem Wunsche verheiratet zu sehen. Er versprach auch, ein ansehnliches Gut zu kaufen, das der Schwiegersohn bewirtschaften sollte, um eine passende Beschäftigung zu haben.
Da der Baron, wie er sagte, der letzte seiner alten Familie war, auch gar keine Verwandten mehr hatte und sein Offizierspatent, wie seine anderen Papiere, die seinen Adel und seine anderen Verhältnisse beglaubigten, bei sich hatte, so bedurfte es keiner langen Vorbereitungen und Schreibereien wegen der Heirat, und die Trauung erfolgte denn in der Tat sehr bald.
Über zehn Jahre lang hatte das Paar in der glücklichsten Ehe gelebt, wie in der ganzen Umgegend im höchsten Ansehen und in allgemeiner Achtung gestanden, welcher nur der Stolz der Frau von Lynck einigermaßen Eintrag zu tun vermochte. Der Baron beschäftigte sich eifrig mit der Verwaltung des Gutes, und den größten Teil der ihm dabei noch freibleibenden Zeit widmete er seiner ältesten Tochter, die er ausschließlich selbst unterrichtete, auch im Klavierspiel und Gesang, und die ihm dafür mit all' der Liebe lohnte, deren ihr Herz fähig war.
Eines Tages meldete sich ein Unbekannter, der unter keiner Bedingung seinen Namen nennen wollte, aber dringend begehrte, mit dem Herrn Baron allein zu sprechen. Als die beiden Männer einander gegenüberstanden, sahen sie einander lange und verwundert, wie es schien, indes keineswegs freudig überrascht, an. Dann fragte der Fremde den Herrn vom Hause in ganz eigentümlichen Tone, ob er ihn wiedererkenne. Von Lynck verneinte dies, er war aber totenbleich geworden, wie der anmeldende Diener erzählte.
„So werde ich Ihnen unter vier Augen meinen Namen nennen“, antwortete der Fremde sehr ernst.
Sie traten nun in das Zimmer des Barons und verweilten da über eine Stunde lang. Jedenfalls hatten sie sehr wichtige Angelegenheiten zu besprechen, und als die Baronin einmal an der Zimmertür vorüberging, hörte sie den Unbekannten sehr laut, und wie es schien, in zornigem Unwillen reden.
Endlich entfernte sich der Fremde, und er reiste so plötzlich, wie er gekommen war, wieder ab.
Der Baron dagegen erschien erst bei dem Abendessen wieder bei seiner Familie. Er sah da noch immer sehr bleich aus, sprach gegen seine Gewohnheit fast kein Wort, wies sogar, wenn auch sanft und liebreich, die Liebkosungen, seiner älteren Tochter ab, ließ aber häufig, so bald es unbeachtet geschehen konnte, Blicke des tiefsten Schmerzes auf ihr ruhen und begab sich bald von neuem in sein Zimmer, nachdem er den Seinigen mitgeteilt hatte, dass er eine kleine Reise machen müsse und am andern Morgen sehr früh aufbrechen werde.
Als früh um drei Uhr am andern Tage vor der Tür des Hauses der Wagen hielt, der ihn nach der Stadt bringen sollte, erschien alsbald auch der Baron, der seinem Aussehen nach wenig oder gar nicht in der vergangenen Nacht geschlafen hatte. Er blickte lange nach den Fenstern des Schlafgemachs seiner Kinder hinauf, strich dann mit der Hand über die Augen, sprang in den Wagen, und die Familie sah ihn seitdem nicht wieder. Er hatte eine ansehnliche Summe Geldes mit sich genommen und auch alle seine Papiere, nach denen die Baronin später ängstlich suchte, waren verschwunden. Der Kutscher, welcher ihn gefahren hatte, erzählte bei seiner Rückkunft, der Herr habe in der Stadt, in welche er ihn gebracht, Extrapost genommen und sei sogleich weitergereist. Er brachte aber auch einen Brief des Barons an die ,,gnädige Frau Baronin“ mit, die, als sie ihn gelesen, ebenso überrascht und erschüttert, als empört und erzürnt zu sein schien. Sie teilte den Brief auch nur ihrem Vater mit, während sie ihren Kindern und anderen erzählte, ihr Mann habe plötzlich eine längere Reise in dringenden Geschäften unternehmen müssen. Aus ihrem ganzen Benehmen und aus einzelnen Worten, die ihr gelegentlich entschlüpften, ging offenbar hervor, dass sie ihren Mann seit dem Verschwinden desselben in eben dem Grade hasste, als sie ihn früher geliebt hatte. Nach einiger Zeit legte sie nebst ihren Kindern Trauerkleidung an, weil die Nachricht eingegangen sein sollte, der Baron sei auf der Reise gestorben. So tief aber auch der Eindruck sein mochte, welchen die plötzliche Abreise des Mannes, und noch mehr der Inhalt seines Briefes auf sie gemacht hatte, sie bemühte sich mit ziemlichem Erfolge, ihn unter der kalten und stolzen Ruhe zu verbergen, die sie von dieser Zeit an anzunehmen für gut fand. Auf ihren alten Vater indes wirkte der Vorgang insofern um vieles trauriger, als er in Folge davon in eine eigentümliche und fortwährend zunehmende Aufregung und Unruhe geriet. In dieser Aufregung ließ er sich in höchst gewagte, großartige Spekulationen ein, die einen so unglücklichen Ausgang nahmen und nehmen mussten, dass sie bald sein ganzes großes Vermögen aufzehrten. Dieser Verlust zerrüttete dann seinen Geist so vollständig, dass er in eine Irrenanstalt gebracht werden musste, in welcher er glücklicherweise bald starb. Das Gut, welches der Baron bewirtschaftet hatte, verkauften die Gläubiger. Die Baronin rettete mit Mühe einen sehr kleinen Teil ihres Vermögens, und als auch dieser fast ganz aufgezehrt war, musste sie sich entschließen, mit ihren beiden Töchtern in die Stadt zu ziehen, um da womöglich Unterhalt zu suchen.
In dieser Familie war ich untergebracht worden, und dass es mir schwer wurde, in derselben heimisch zu werden, schwerer noch als in der Schule, wird man sehr erklärlich finden.
Das Gebäude, in welchem sich die Schule befand, war ein ehemaliges Kloster mit düsteren, gewölbten Kreuzgängen, von deren Wänden hier und da, trotz wiederholter Übertünchung, einzelne Mönchs- und Märtyrergestalten, Überreste früherer Freskomalerei, verblasst zwar und undeutlich, aber deshalb auch umso gespenstischer auf die Vorübergehenden herabsahen und den schauerlich unheimlichen Eindruck erhöhten, den der Eintritt in diese „Stätte der Wissenschaft“ namentlich in jugendlichen Gemütern hervorbringen musste.
Die angestellten Lehrer waren zwar sämtlich in ihrem Fache tüchtige Männer, alle aber hatten trotzdem irgendetwas an sich, das sie wenigstens einigermaßen zu Originalen machte und ihren mutwilligen Schülern Stoff und Veranlassung zu Verspottung und Verhöhnung gab. Der Rektor zum Beispiel war ein äußerlich und innerlich vertrockneter Philologe, der alles Wissen, das sich nicht auf Lateinisch und Griechisch bezog, auf das Gründlichste verachtete, und deshalb auch mir einmal seine aufrichtigste Geringschätzung zu erkennen gab, als er bei irgendeiner Gelegenheit zu seinem großen Verdrusse in Erfahrung gebracht hatte, dass ich mich mit dem Erlernen seines verehrten Griechisch und Lateinisch, ja nicht einmal mit dem des geduldeten Französisch begnüge, sondern mich überdies mit der ganz profanen englischen Sprache beschäftige. Er war sehr hager und hatte die Schrulle, jeder Zeit, im Sommer wie im Winter, und bei jeder Gelegenheit vom Kopf bis zu den Füßen in grauer Kleidung zu erscheinen, zu welcher namentlich ein Frack mit sehr hohem Kragen und sehr langen Schößen gehörte. Von diesem allgemeinen Grau stach sein Haar nur deshalb ein wenig ab, weil es mehr in Weiß als in Grau spielte, während sein hageres Gesicht und seine langen dürren Hände durch einen, freilich nur sehr leichten Anflug von Braun sich abhoben. Dazu kam, dass er bei seinem Erscheinen stets einen starken Geruch um sich her verbreitete, nicht etwa einen Wohlgeruch von seinem Parfüm, sondern jenen ganz eigentümlichen, widerlichen, der sich allen denen unvertilgbar anhängt, welche stark Tabak aus Pfeifen rauchen. Dies tat der Mann in wahrhaft erschreckender Weise. In seinem Zimmer saß er stets in so dichten Tabaksrauchwolken, dass es dem Eintretenden schwer wurde, den grauen Mann in dem grauen Nebel zu erkennen. Wenn man die Töne mit Farben bezeichnen könnte, würde ich sagen, auch die Stimme des Herrn Rektors sei grau gewesen; jedenfalls hatte sie einen heiseren, dumpfen und eintönigen Klang.
Ein anderer Lehrer hatte die Gewohnheit, während der Lektion in dem großen, saalähnlichen Klassenzimmer, dem ehemaligen Refektorium, langsam auf- und abzugehen, dabei den Zeigefinger der rechten Hand an seine Unterlippe zu legen, und dieselbe, mit der größten Regelmäßigkeit abwechselnd, nach links und dann wieder nach rechts zu schieben. Da er, trotz seinen Säbelbeinen, kurze, enge Hosen und darüber große Stulpenstiefeln trug, die bei jedem seiner bedächtigen, langsamen Schritte mit anerkennenswerter Ausdauer ein gedehntes Knarren hören ließen, so war er in der Tat eine gar komische Figur.
Einer der jüngeren Lehrer, welcher den Unterricht in der Mathematik, Physik und Geographie zu erteilen hatte, zeichnete sich durch eine eigentümliche Grausamkeit aus, welche er sehr häufig gegen manchen der Schüler in Anwendung brachte. Zweimal nämlich ließ er sich gefallen, dass er auf eine Frage gar keine oder doch keine richtige Antwort erhielt. Erfolgte aber auf seine dritte Frage nicht sofort eine Antwort, so blieb er – oftmals bis zu Ende seiner Unterrichtsstunde – regungslos und schweigend, wie immer auf die Antwort wartend, vor dem unglücklichen Unwissenden stehen, der ihm dann diese ganze Zeit über natürlich auch schweigend und wie auf der Folter gegenüberstehen musste. Bei dem ersten Schlag der Stunde, welche den Unterricht beendigte, griff dieser wunderliche Pädagoge, ohne ein Wort zu sagen, hastig nach seinem Hute, verließ mit großen, eiligen Schritten, vor Ärger hochrot im Gesicht, das Zimmer und warf die Tür hinter sich donnernd in das Schloss. In früherer Zeit war er mit einem anderen jungen Lehrer eng befreundet gewesen, damals aber hasste er ihn – wie es hieß, seiner hübschen Frau wegen, der jener den Hof zu machen gewagt hatte – wie einen Todfeind, und er gab diesem seinen Hasse bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit vor den Schülern leider auch Worte. In welcher Weise mag nur ein Beispiel zeigen. Als er eines Tages im geographischen Unterricht an Weimar kam, teilte er uns über diese Stadt, in welcher Goethe vor nicht sehr langer Zeit gestorben war, gar nichts mit, aber er entblödete sich nicht, im Tone des schneidendsten Hohnes zu sagen:
„Weimar! Weimar! Was kann aus einer Stadt Gutes kommen, in welcher ein Mann Verse machte, wie:
Röslein, Röslein, Röslein rot,
Röslein auf der Heide!“
Diese frechen Worte sollten, was die Schüler sehr wohl wussten, nur jenen von ihm gehassten Lehrer, seinen ehemaligen Freund, herabsetzen, der zufällig in Weimar geboren war.
Auch unter den Mitschülern befand sich wenigstens ein Original, und von ihm muss ich hier sprechen, weil er mir im Leben später zu wiederholten Malen und stets unter eigentümlichen Umständen, ja in verderblicher Weise entgegentreten sollte. Er war um mehrere Jahre älter als irgendeiner unter uns, und er erfreute sich bereits eines dichten Backenbartes, während wir anderen noch sehnsüchtig auf den ersten Flaum am Kinn warteten. Dagegen hatte sein Körper die dem Alter entsprechende Größe nicht erreicht, wenn er auch kräftig und namentlich sehr breitschulterig war. Seine Kleidungsstücke waren stets nicht bloß alt, sondern auch von altmodischem Schnitt und offenbar ursprünglich für ihn nicht bestimmt gewesen. Er hatte das eigentümlichste Haar, das ich jemals an einem jungen Menschen gesehen, denn es war völlig weißgrau, wie das eines Greises. Dazu kamen die seltsamsten, ja unheimlichsten Augen, die mir im Leben vorgekommen sind. Sie waren ziemlich groß, matt-weiß, ohne allen Glanz, und die Pupille darin so sehr schwachblau oder grau, dass sie von dem vielen Weiß umher schwer unterschieden werden konnte. Die Augenbrauen und die Wimpern fehlten ihm entweder ganz, oder sie stimmten so vollständig mit der zweifelhaften Fleischfarbe des Gesichts überein, dass sie nicht erkennbar hervortraten. Die Nase war klein und tief eingedrückt, der Mund dagegen ungewöhnlich breit mit schmalen, schlechtschließenden Lippen, so dass man fast immer seine gelblichen Zähne sah. Wir alle mieden ihn und hatten sogar eine gewisse unerklärliche Scheu vor ihm. Auch nahm er an unseren Scherzen, Spielen und Neckereien in den Zwischenstunden niemals Anteil; er saß auch in dieser Zeit entweder in Gedanken versunken auf seinem Platze oder las in einem der alten vergilbten Bücher, die er gewöhnlich mitbrachte, aber von niemand ansehen ließ. Die Scheu vor ihm steigerte der Umstand, dass er einer Familie in der Stadt angehörte, die in dem ältesten, kleinsten und schlechtesten Hause, dicht an der dort noch stehenden Stadtmauer, zum Teil auf derselben, wohnte, welches sie von niemand betreten ließ und in dem sie scheu und versteckt eulenartig hauste. Klopfte jemand an die stets verschlossene Tür, so öffnete sich nach einiger Zeit ein Schieber in derselben, und es zeigte sich entweder das Gesicht einer Frau mit einer Eulenschnabelnase und einzelnen borstigen Haaren auf den schmalen Lippen, oder der Kopf eines Mannes, welcher die frappanteste Ähnlichkeit mit einem Froschkopf hatte. Erst nach vielem Fragen erfuhr ich, dass jene Frau, die Mutter unseres wunderlichen Mitschülers, in der Dämmerung auf geschehene Einladung in die Wohnungen ging, um da aus schmutzigen Karten die Zukunft zu prophezeien; der Mann aber als Kammerjäger ärmlich sich nährte, im Herbst aber auch Hamster ausgrub, um sich der Getreidevorräte zu bemächtigen, welche die vorsorglichen, fleißigen Tiere für den Winter eingesammelt hatten. Nebenbei trieb er einen kleinen Handel mit alten Büchern, und zwar ausschließlich mit Büchern über Goldmachern, Schatzgräberei, Wahrsagerei und Geisterseherei, die er in Auktionen usw. so billig als möglich kaufte, um sie später an wahrscheinlich ihm schon bekannte Liebhaber solcher Kuriositäten mit kleinem Gewinn wieder abzusetzen.
Wie es unter den Vögeln und anderen Tieren gewisse Arten gibt, die am Tage sich verbergen und schlafen, um mit der eintretenden Dunkelheit ihre eigentliche Tätigkeit zu beginnen, so führen auch manche Menschen ein solches Dämmerungsleben, und sie haben meist auch das mit den Nachtvögeln gemein, dass sie geflohen oder verhöhnt und verfolgt werden, wenn sie sich einmal im Tageslichte zeigen. Solcher Art waren die Eltern jenes Schulgenossen, und er selbst gehörte einigermaßen auch bereits dazu.
Eines Tages brachte er die ganze Schule in große Aufregung. Es war im vierten Jahre meines Aufenthaltes im Gymnasium, im Hochsommer, und zwar in der ersten heißen Nachmittagslehrstunde, welche der graue Rektor in der einförmigsten und langweiligsten Art hielt. In der Klasse herrschte eine ungewöhnliche Ruhe und Stille, nicht etwa in Folge unserer gespannten Aufmerksamkeit, sondern vielmehr wegen der allgemeinen Abspannung und der drückenden Langenweile. Jener unheimliche Schulgenosse, Anselm Valter geheißen, saß mir schräg gegenüber an dem Ende einer Bank, und ich hatte seine stieren Augen und sein ängstlich unruhiges Wesen bereits eine Zeit lang beobachtet, als er langsam und allmählich, wie widerstrebend, aufstand, als würde er von unsichtbaren Händen emporgezogen, gegen die er sich zu sträuben versuche. Ebenso langsam und wie einem Zwang folgend, leisen Schrittes, totenbleich, die großen weißen Augen weit aufgerissen, ging er, von unseren verwunderten Blicken aufmerksam gefolgt, durch das ganze lange Klassenzimmer nach der Tür zu. An dieser zögerte er einen Augenblick, und er schien stehen bleiben zu wollen, plötzlich aber fasste seine rechte Hand, wie durch eine unwiderstehliche Gewalt geführt, den Drücker des Schlosses. So öffnete er die Tür, dann schritt er hinaus, die Tür schloss sich hinter ihm, und wir sahen ihn an diesem Tage nicht wieder.
Nach Beendigung des Nachmittagsunterrichts war er in der Wohnung des grauen Rektors erschienen, und hatte diesem in geheimnisvoller Weise anvertraut, was ihm begegnet sei. Es klang abenteuerlich genug. Ein Mann in einer Mönchskutte, mit ganz kahlem Scheitel, und langem weißen Bart, hatte er erzählt, habe in der ersten Unterrichtsstunde plötzlich vor ihm gestanden und gewinkt, ihm zu folgen, anfangs freundlich, dann ernster und ernster, endlich gebieterisch und drohend. Weil er sich vor der Gestalt sehr gefürchtet, habe er sich lange nicht gerührt, den Mann nur angestarrt, aber ihm zu folgen nicht gewagt. Erst als die Gestalt näher und näher an ihn herangetreten, ihm dann gar die knochendürre Hand auf die Achsel gelegt, und in Folge davon eisige Kälte ihm durch die Glieder gebebt, sei er aufgestanden und, aber noch immer widerstrebend, dem langsam voranschreitenden Mönch gefolgt. Draußen, vor der Tür, habe ihn derselbe bis an das äußerste und dunkelste Ende des Kreuzganges, an die Stelle geführt, wo eine große Steinplatte am Fußboden liege. Diese Platte habe sich, als sie vor ihr angekommen, langsam, geräuschlos, von selbst emporgehoben, so dass der darunter befindliche Zugang zu mehreren in die Tiefe hinunterführenden Stufen undeutlich sichtbar geworden. Dahinein sei die Gestalt geschritten, und da er in seiner großen Angst gezögert, ihr weiter zu folgen, habe sie seine Hand gefasst und mit Gewalt ihm nach und hinuntergezogen. In völligem Dunkel wären sie dann, ziemlich lange wieder auf ebenem Boden, weitergegangen, er immer an der Hand festgehalten. Endlich habe ihn die Gestalt an einer Stelle losgelassen, auf die von oben herab ein schwacher Lichtschimmer gefallen. Da habe ihn die Gestalt auf eine große eiserne Truhe aufmerksam gemacht, die, nach einer leichten Berührung an einer Stelle, sich aufgetan und ihren Inhalt enthüllt, nämlich sehr vieles goldenes und silbernes Geschirr, nebst Perlen und Edelsteinen, welche in dem Halbdunkel wie Sterne in der Nacht blendend und funkelnd geleuchtet. Darauf habe die Mönchsgestalt mit hohler, dumpfer Stimme zu ihm gesagt, dieser große Schatz sei in bösen Zeiten hier, genau unter dem Altar oben in der Klosterkirche, versteckt worden, müsse aber nun endlich von hier entfernt und nach Rom gebracht werden, wo er zu besonderen Zwecken bestimmt sei. An welche Person der Schatz in Rom zu senden sei, nebst anderen Angaben sei auf dem Papier zu lesen, das dem jetzigen Vorsteher des Hauses übergeben werden müsse, welcher der Weisung genau nachzukommen habe, wenn ihm sein Leben lieb sei. Dabei habe die Gestalt, hatte der Erzähler weiter berichtet, ein Papier, unter der Kutte hervor, von der Brust genommen und ihm mit den drohenden Worten übergeben, er werde ihm so lange wiedererscheinen, bis der Auftrag ausgerichtet sei. Zur Bürgschaft dafür, dass er gehorsam sein wolle, möge er die rechte Hand darreichen. Als er zögernd die ihm hingehaltene Hand des Mönchs berührt, sei es ihm vor den Augen plötzlich dunkel geworden, er habe das Bewusstsein verloren, und wisse nichts mehr, als dass er fröstelnd oben im Kreuzgang auf der großen Steinplatte wieder zu sich gekommen sei, die sich früher von selbst vor der Mönchsgestalt aufgehoben habe. Diese Gestalt sei verschwunden gewesen, er selbst aber habe das Papier, das er unten zur Abgabe an den Herrn Rektor empfangen, in der Hand gehalten. Dieses Papier überreichte Anselm Valter dem grauen Rektor, der sich während der Erzählung in eine ganz ungewöhnlich dicke Tabaksrauchwolke gehüllt hatte. Es war in der Tat sehr alt, vergilbt und mit unleserlicher oder doch unverständlicher Mönchsschrift und kabbalistischen Zeichen bedeckt. Der Rektor, der auch nicht im Mindesten Sinn für Romantik hatte, wies den gläubigen jungen Geisterseher mit einer harten Strafpredigt barsch ab, schwieg aber über den Vorgang wahrscheinlich nicht, denn das Gerücht von jener Erscheinung verbreitete sich mit allerlei Zusätzen sehr bald in der ganzen Stadt und selbst in einer ziemlich weiten Entfernung. Anselm Valter selbst zeigte sich von diesem Tage an nicht mehr in der Schule, weil er sich dem Erscheinen und der Rache des vielleicht erzürnten Mönchs nicht noch einmal aussetzen wollte, wie es hieß, wahrscheinlich aber, weil er eine genaue Untersuchung der ganzen abenteuerlichen Sache fürchtete, denn jedenfalls hatte er selbst auf einem Papierblatte, das er aus einem seiner alten Bücher geschnitten, jene Mönchsschrift nach irgendeiner Vorlage nachgemalt, so wie seine Erzählung, die ja seiner Lieblingsliteratur genau entsprach, entweder ganz erfunden oder geträumt, nachdem er in dem kühlen Kreuzgange des Hauses eingeschlafen. Genug, er verließ um diese Zeit die Schule, trat als Teilnehmer in das Geschäft seines Vaters und übernahm vorzugsweise die Führung des antiquarischen Bücherhandels. Er besuchte mit seinem kleinen Vorrat alter Schriften der schon bezeichneten Art die Jahrmärkte und Messen in den benachbarten Städten, um Bücher seines Fachs zu kaufen und zu verkaufen. Auch war er so rührig, dass er bald mit mehreren Liebhabern solcher wunderlichen Literatur in Verbindung und Tauschverkehr stand. Er handelte mit dem größten Eifer und witterte gleichsam durch eine eigentümliche Art von Instinkt seine Lieblinge selbst an Orten, wo sie gewiss niemand gesucht hatte. Sie hatten freilich einen so außerordentlichen und unwiderstehlichen Reiz für ihn, dass er sicherlich kein Mittel scheute, um in den Besitz eines für ihn besonders begehrenswerten alten Buches zu gelangen, wenn es durch Kauf oder Tausch für ihn nicht zu erwerben war. Er glaubte fest und zuversichtlich an den Inhalt, an Goldmachern, Zauberei usw., weshalb er eigentlich immer nur ungern und mit Widerwillen etwas von seinen Schätzen wiederverkaufte.
Außer dem seltsamen Valter'schen Ehepaar und diesem Sohne desselben zählte die alte Stadt, ein ehemaliger Bischofssitz, unter ihren Einwohnern noch manche andere, die sich durch Originalität, ungewöhnliche Schicksale, wie die Familie, in welcher ich wohnte, durch eigentümliche Lebensweise oder Gewohnheiten hervortaten und zwar namentlich in den sogenannten höheren Ständen. Es wohnten nämlich in der Stadt verhältnismäßig viel Familien von sehr altem Adel, die aber außer ihrem Reichtum von Ahnen wenig oder nichts besaßen. Am auffälligsten war mir ein alter Freiherr von kleiner, zierlicher Figur, der noch immer stets in Schuhen und Strümpfen, in Frack und kurzen Kniehosen, mit einem langen Stock mit goldenem Knopf in der Stadt umherging. Jeden Tag, zwischen zwölf und ein Uhr, wenn das Wetter nur irgend erträglich war, machte er an der Seite seiner hochbejahrten, gleich ihm altväterisch gekleideten Frau Gemahlin seinen regelmäßigen Spaziergang, und dem Paare folgte dabei stets, in gebührender Entfernung, ein sehr alter Diener in abgetragener Livree, der einen alten fetten Mops an einem seidenen Schnürchen führte. Alle vier, auch der Mops, wandelten sehr stolz einher und sahen mit gnädiger Herablassung auf die Vorübergehenden. Von einem großen Vermögen war dem Freiherrn nichts geblieben, als eine kleine Rente aus einer Familienstiftung und das stattlichste Haus in der Stadt, das seit Jahrhunderten im Besitze seiner Familie gewesen und von einem seiner Vorfahren erbaut worden war. Er bewohnte dasselbe allein mit seiner Gemahlin, einer alten Magd und dem alten Diener, denn der alte, adelsstolze Herr hielt es, trotz seiner Armut, unter seiner Würde, einen Teil der großen, schönen Räume des Hauses zu vermieten. Die meisten derselben blieben deshalb unbenutzt und leer und enthielten nur das zum Teil uralte, ehemals glänzende Familienmobiliar nebst den zahlreichen Ahnenbildern.
Das Haupt einer andern altadeligen, aber ebenfalls verarmten Familie war ein kleiner verwachsener Mann, der nur durch Spiel, und zwar auf den Jahrmärkten in den umliegenden kleinen Städten, ja selbst in Dorfschenken und an anderen Orten den Unterhalt für seine Familie zu erwerben suchte oder zu erwerben verstand, nachdem er durch das Spiel sein eigenes Vermögen, wie das nicht unansehnliche Erbe seiner Frau verloren hatte. Seine Familie bestand aus einer fein gebildeten Frau, die früher Hofdame bei einer kleinen Fürstin gewesen war und von derselben noch immer ein kleines Gnadengehalt bezog, und aus drei blühenden Töchtern von gleich junonischer Gestalt und ungewöhnlicher Schönheit. Die Frau hatte sich nach langen Kämpfen und vielen Tränen mit philosophischem Gleichmut in ihr trauriges Geschick ergeben, und die Töchter ertrugen dasselbe mit Hilfe ihres heitern, leichten Sinnes, den ihnen die gütige Natur wie zur Entschädigung erteilt hatte. Bald befand sich die Familie – und das war die Regel – in der bittersten Not, bald – dies freilich selten – in einem gewissen Überfluss, je nachdem dem Vater das Spielglück günstig oder ungünstig gewesen war.
Ella, die jüngste dieser drei Mädchen, hatte ich aufwachsen und zur Schönheit erblühen sehen, weil sie als Freundin der Schwester Dulcamara's häufig bei uns war. Wir hatten oft und viel miteinander gescherzt und gelacht. Sie war über ein Jahr jünger, als ich, und stand in der Zeit, in welcher ich sie dem Leser vorführe, in ihrem sechszehnten Jahre, war aber fast vollkommen ausgebildet, mit reizender Fülle, mit glänzend schwarzen Locken und großen blitzenden blauen Augen, mit etwas sinnlich schwellenden Lippen, die sich bisweilen an dem äußern Ende etwas schalkhaft, aber in unbeschreiblichem Liebreiz ein wenig emporzogen. Ihre Zähne waren weiß und regelmäßig, vielleicht nur ein wenig zu groß. In ihre meist lachenden, aber oft auch träumerischen und sinnenden Augen hatte ich schon seit Langem häufig mit halbbewusster Bewunderung geblickt, wie ich denn schöne Augen auch später jeder Zeit für den höchsten aller weiblichen Reize gehalten habe, und schöne Augen deshalb immer einen unwiderstehlichen Zauber auf mich ausübten.
Ich will denn auch gleich hier gestehen, dass ich mich stets zuerst in die Augen eines Mädchens verliebte, weil die Augen dasjenige Weiblich-Schöne sind, das zum Denken und Raten auffordert, während alle anderen Körperreize nur die Sinnlichkeit anregen.
Das Auge ist ein See von unergründlicher Tiefe, und übt wie jeder andere See auf den Hineinschauenden eine geheimnisvolle Anziehungskraft aus. Diese Anziehungsmacht klaren, tiefen Wassers schreiben Sagen und Märchen den Nixen, Feen und lieblichen Wasserfräuleins zu, die darin wohnen sollen. Ein nur mir bekanntes Märchen erzählt zur Begründung dieses Glaubens:
Als allen Nixen, Feen, Meermädchen und Wasserfräuleins in den Meeren, Seen, Flüssen und Quellen ein Wohnort angewiesen worden, waren die kleinsten, zierlichsten, aber zaubermächtigsten unter ihnen übriggeblieben, und sie baten deshalb in ängstlicher Besorgnis ihre Königin, ihnen doch auch eine Heimat zu geben.
„O“, antwortete die Königin den Bittenden gütig, „Ihr seid nicht vergessen. Euch gebe ich den tiefsten See, der zwar klein ist, in dem sich aber der ganze Himmel spiegelt, der auch die gefährlichsten Klippen und Untiefen, ja sogar Ungetüme birgt, die grauenhafter und furchtbarer sind als alle Meerungeheuer, der bald lieblicher erscheint als ein anderer ruhiger, mondbeglänzter oder sonnenbeleuchteter See, bald aber auch von den schlimmsten und wildesten Stürmen heimgesucht wird. Der See, den ich meine, ist das Auge des Menschen, und die Zaubermacht, die Ihr in demselben und durch dasselbe üben sollt, wird unwiderstehlich sein.“
Wenn es einem Leser oder einer der Leserinnen vor einem schönen Auge einmal ergangen ist oder künftig ergeht wie dem Goethe'schen „Fischer“, wenn sie hinsinken wollten oder hinsinken möchten, so wissen sie nun wenigstens, dass sie von der Zaubernixe in jenem Auge hingezogen werden.
Ich wusste dies damals auch noch nicht, sonst hätte ich mich vielleicht vorsichtiger gehütet, in Ellas schöne Augen zu sehen, namentlich in der „Tanzstunde“, in welcher wir einander wieder begegneten, und in der die freundschaftliche Zuneigung, welche ich immer für das schöne Mädchen empfunden hatte, sehr bald zur ersten Leidenschaft sich steigerte.
Tanzstunde! Lebt jemand, der in späteren Jahren nicht mit sehnsüchtiger Erinnerung an jene Zeit seiner Jugend zurückdenkt, in welcher schon die Berührung der Hand eines geliebten Mädchens hoch erfreute, ein leichter Druck von dieser Hand beglückte, ein freundlicher Blick des Auges in Entzücken versetzte, und ach! ein Kuss, ein halb geraubter, halb geduldeter Kuss beseligte? Kann jemand die liebliche Tanzstundenzeit vergessen, in welcher er anfänglich kaum wagte, seinen Arm um die zarte Gestalt der Bevorzugten zu legen und elektrische Funken gleichsam ihm durch alle Glieder zuckten, wenn er ihre Hand auf seinem Arme, auf seiner Schulter fühlte? Wenn er ihr in die glücklichen Augen schaute und ihr Herz an dem seinigen klopfen fühlte? Wer alles dies nicht voll und ganz empfunden hat, kennt den Frühlingsreiz der Liebe nicht, weiß überhaupt nichts von dem echten und rechten Zauber der Liebe, selbst wenn später sein Herz von der gewaltigsten und stürmischsten Leidenschaft erschüttert worden sein sollte.
Ella erlaubte mir bald – da es so Sitte war – nach der Tanzstunde sie nach Hause zu begleiten, und während es mich anfangs schon über alles beglückte, nur neben ihr gehen zu dürfen, wagte ich später, ihr meinen Arm anzubieten, den sie auch, das erste Mal mit einigem Sträuben, annahm, und bei dem Abschied an ihrer Tür fehlte mir nie ein freundlicher Druck von ihrer Hand, der dann lange, lange in mir nachzitterte.
Eines Abends bei solchem Nachhausegehen kam es uns beiden vor, als schleiche jemand hinter uns her, und Ella hing sich in ihrer Ängstlichkeit fester als sonst an meinen Arm. Sie fürchte sich, sagte sie, weil sie schon mehrmals in solcher Weise abends erschreckt worden sei, auch beruhigte sie sich einigermaßen erst dann wieder, als wir durch wiederholtes und aufmerksames Zurückblicken uns überzeugt zu haben glaubten, dass wir uns getäuscht und dass niemand uns folge. Bei dem Abschiednehmen vor der Wohnung Ellas aber, als sie mir eben die Hand reichte, tauchte aus dem Dunkel dicht neben mir eine Gestalt auf, und eine Stimme sagte leise und höhnend: „Ja, ja, gute Nacht!“ Ella entzog mir rasch die Hand und eilte erschreckt in das Haus. Ich dagegen drehte mich nach dem Sprechenden um und erkannte, nicht zu meiner Freude, den ehemaligen Schulgenossen Anselm Valter.
So aufgebracht ich über die Störung und den Störer war, fühlte ich doch durchaus keine Neigung, mich in ein Gespräch, noch weniger in einen Wortwechsel mit dem Menschen einzulassen, ich ging vielmehr ohne Aufenthalt weiter. Er schritt indes neben mir her, anfangs schweigend, dann begann er:
„So? Die schöne Ella gefällt Dir? Mir auch. Alle jungen Mädchen und alle alten Bücher gefallen mir. Die Bücher kann ich für mich gewinnen, aber keines der Mädchen. Keine will von mir etwas wissen, weil meine Hässlichkeit sie abschreckt. Aber nur Geduld! Aus meinen Büchern weiß ich, dass es Mittel gibt, durch welche ich die Hässlichkeit beseitigen und die Mädchen zwingen kann, mich auch für liebenswert zu halten. So hässlich ich jetzt noch bin, habe ich doch in dem hässlichen Körper ein Herz mit denselben Wünschen wie ein anderes. Die Natur gab meinem verfluchten Leibe die brennendsten Triebe, die befriedigt sein wollen und befriedigt werden sollen. Warum versündigte sich die Natur an mir dadurch, dass sie mir diese Befriedigung schwerer machte als anderen? Warum pflanzte sie mir die Sehnsucht ein, geliebt zu werden, und bildete mich so, wie ich bin, dass mein Anblick schon Abscheu und Widerwillen erregt? Ach, ich bin ein unglücklicher, ein elender Mensch! Aber ich will nicht elend sein und bleiben! Ich will auch so glücklich werden, wie die anderen, und ich erzwinge es, habe ich nur erst das Buch, in welchem das Mittel dazu angegeben ist!“
Er sprach diese Worte im grimmigsten Unwillen, und ich wusste nicht, ob ich lachen oder mich entsetzen sollte; jedenfalls hatte ich keine Lust, nach einer näheren Erklärung zu fragen und bald auch keine Gelegenheit dazu, denn der Unheimliche bog ohne Abschied in eine enge Seitengasse ein, in welcher er verschwand.