
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Auf historischen Spuren
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
= Digitale Neufassung für eBook-Reader = Diezmann: "Der Abfassung der vorliegenden Schrift standen, wie sich leicht denken lässt, viele Schwierigkeiten und Hindernisse verschiedener Art entgegen und obwohl ich ihr viel Zeit und viel Liebe gewidmet habe, bin ich doch lange unentschlossen gewesen, ob ich sie so wie sie ist dem Publikum vorlegen dürfe oder nicht. Dass sie erscheint, hat zunächst die freundliche Zuschrift eines wohlbekannten vorzüglichen Kenners der Goethe-Literatur veranlasst, dem ich meine Zweifel und Bedenken mitteilte und der darauf antwortete: „Wenn nicht endlich einmal jemand den Mut hat, eine Darstellung der ersten zehn Jahre von Karl Augusts und Goethes weimarischem Leben wenigstens zu versuchen, so ist zu befürchten, dass diese Lücke noch Jahrzehnte lang unausgefüllt bleiben wird, ja vielleicht so lange bis es ganz unmöglich geworden ist. …“ … Dass ich manche bisher unbekannten Dokumente, so wie andere Mitteilungen benutzen konnte, werden die Kenner bemerken; die ganze und volle Wahrheit über jene merkwürdige Zeit kann freilich erst geschrieben werden, wenn einst die Siegel von den Papieren fallen, die wohlverwahrt in Weimar, teils im Staatsarchiv, teils im Goethe’schen Archiv, liegen und deren so viele sind, dass selbst durch eine Auswahl mehrere Bände gefüllt werden könnten. Möge die Lösung jener Siegel nicht zu lange auf sich warten lassen und bis dahin die vorliegende Schrift wenigstens einiges zur Kenntnis zweier der größten Männer des Vaterlandes beitragen — Karl Augusts und seines Goethe.“
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 296
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Goethe und die lustige Zeit in Weimar.
Technische Anmerkungen
Vorwort.
Erstes Kapitel: Die Reise nach Weimar.
Zweites Kapitel: Weimar bei Goethes Ankunft.
Drittes Kapitel: Der Kreis, in welchen Goethe eintrat.
Viertes Kapitel: Goethe und das Leben am Hofe.
Fünftes Kapitel: Goethe und das fürstliche Privattheater.
Sechstes Kapitel: Goethe und Charlotte von Stein.
Siebentes Kapitel: Goethe als Minister Karl Augusts.
Nachtrag.
Nachricht von dem ilmenauischen Bergwesen, aufgesetzt im Mai 1781 von Goethe.
Digitale Neufassungen
Impressum
Goethe und die lustige Zeit in Weimar.
von August Diezmann
Mit einer bisher ungedruckten Abhandlung von Goethe.
Leipzig,
Verlag von Ernst Keil.
1857.
Digitale Neufassung des altdeutschen Originals
von Gerik Chirlek
Reihe: Auf historischen Spuren / Band 4
Technische Anmerkungen
Die vorliegende digitale Neufassung des altdeutschen Originals erfolgte im Hinblick auf eine möglichst komfortable Verwendbarkeit auf eBook Readern. Dabei wurde versucht, den Schreibstil des Verfassers möglichst unverändert zu übernehmen, um den Sprachgebrauch der damaligen Zeit zu erhalten.
Auf die Beigabe von Plänen und Karten, die möglicherweise dem Original beigefügt wurden, musste bei der digitalen Neufassung verzichtet werden.
Vorwort.
Der Abfassung der vorliegenden Schrift standen, wie sich leicht denken lässt, viele Schwierigkeiten und Hindernisse verschiedener Art entgegen und obwohl ich ihr viel Zeit und viel Liebe gewidmet habe, bin ich doch lange unentschlossen gewesen, ob ich sie so wie sie ist dem Publikum vorlegen dürfe oder nicht.
Dass sie erscheint, hat zunächst die freundliche Zuschrift eines wohlbekannten vorzüglichen Kenners der Goethe-Literatur veranlasst, dem ich meine Zweifel und Bedenken mitteilte und der darauf antwortete:
„Wenn nicht endlich einmal jemand den Mut hat, eine Darstellung der ersten zehn Jahre von Karl Augusts und Goethes weimarischem Leben wenigstens zu versuchen, so ist zu befürchten, dass diese Lücke noch Jahrzehnte lang unausgefüllt bleiben wird, ja vielleicht so lange bis es ganz unmöglich geworden ist. Jetzt, wo jene Zeit trotz den achtzig Jahren, die sie hinter uns liegt, uns doch noch so nahe erscheint, dass jeder Verehrer Goethes sich ein Bild derselben nach seinem Sinne machen zu können glaubt, steht zu erwarten, dass die erste ausführliche Darstellung überall großes Interesse erregen und vielfachen Widerspruch, mit diesem aber zugleich als Beweismittel noch unbekannte Schätze hervorrufen wird. Schon dies sollte alle Bedenken, mit Ihrer Schrift herauszutreten, beseitigen. Auch scheint die gegenwärtige Zeit ungemein günstig zu sein. Also heraus!“
So ermutigend diese Worte wirkten, wollte ich ihnen doch nicht allein vertrauen. Ich wendete mich also an eine hochgestellte hochbetagte Dame, welche die „lustige weimarische Zeit“ besser als jemand unter den Lebenden kennt, weil sie dieselbe durch die Beteiligten selbst schildern hörte, ja einen Teil selbst noch mit durchlebte. Ihr legte ich den betreffenden Teil des Manuskriptes vor. Sie hat die Güte gehabt, sich dasselbe vorlesen zu lassen und erst als sie ein nicht ungünstiges Urteil darüber abgab, glaubte ich die Herausgabe wagen zu dürfen. Sie schrieb mir u. a.: „die Wahrheit des Inhalts wirkte so mächtig auf meine Phantasie, dass ich mich plötzlich aus der traurigen Gegenwart in die heiterste Vergangenheit zurückversetzt wähnte, denn ich sah wie in einem Zauberspiegel längst entschlafene Gönner und Freunde so lebensfrisch und geistvoll wie ehemals in der Wirklichkeit an mir vorübergehen.“
Dass ich manche bisher unbekannten Dokumente, so wie andere Mitteilungen benutzen konnte, werden die Kenner bemerken; die ganze und volle Wahrheit über jene merkwürdige Zeit kann freilich erst geschrieben werden, wenn einst die Siegel von den Papieren fallen, die wohlverwahrt in Weimar, teils im Staatsarchiv, teils im Goethe’schen Archiv, liegen und deren so viele sind, dass selbst durch eine Auswahl mehrere Bände gefüllt werden könnten.
Möge die Lösung jener Siegel nicht zu lange auf sich warten lassen und bis dahin die vorliegende Schrift wenigstens einiges zur Kenntnis zweier der größten Männer des Vaterlandes beitragen – Karl Augusts und seines Goethe.
Leipzig, am 108. Geburtstag Goethes.
A. Diezmann.
Erstes Kapitel: Die Reise nach Weimar.
Zu Ende des Jahres 1774 hatte Goethe bereits „Götz von Berlichingen“, „Werthers Leiden“, „Clavigo“, das „Puppenspiel“, „Götter, Helden und Wieland“ usw. herausgegeben und er gesteht, „dass es dem jungen Autor gar nicht missfiel, als ein literarisches Meteor angestaunt zu werden.“ Von allen Seiten her kam man in der Tat nach Frankfurt, um ihn zu sehen und in Briefen, Zeitschriften und Büchern haben sich Urteile über ihn aus jener Zeit erhalten.
„Ich hatte“, schreibt z. B. ein „deutscher Gelehrter“ im „deutschen Museum“, „in Frankfurt das Vergnügen, des bereits in jungen Jahren durch verschiedene Schriften berühmt gewordenen Dr. Goethes Besuch zu genießen. Dieser junge Gelehrte ist ein wahres Original-Genie von ungebundener Freiheit im Denken, sowohl über politische als gelehrte Angelegenheiten. Er besitzt eine wirklich scharfe Beurteilungskraft, eine sehr feurige Einbildungskraft und sehr lebhafte Empfindsamkeit. Seine Urteile über Menschen, Sitten, Politik und Geschmack sind jedoch noch nicht durch hinlängliche Erfahrung unterstützt. In dem Umgange fand ich ihn angenehm und liebenswürdig.“ Es darf deshalb keine Verwunderung erregen, dass auch der junge Herzog Karl August von Weimar ihn persönlich kennenzulernen wünschte, als er mit seinem Gouverneur, dem Grafen von Görz, seinem Bruder Constantin und dessen Führer, von Knebel, auf seiner Reise nach Süddeutschland und Paris im Dezember des obengenannten Jahres nach Frankfurt kam. Knebel suchte den Dichter auf, fand ihn über Weimar, die dortigen Verhältnisse und Neigungen genau unterrichtet, teilte ihm den Wunsch der Prinzen mit und geleitete ihn zu denselben. Dieser Besuch Goethes entschied über seine Zukunft und ein Zufall dabei, dessen Bedeutsamkeit wir weiter unten mehr hervorheben werden, als es bisher geschehen ist, legte vielleicht schon damals den Grundstein zu seiner ganzen einflussreichen späteren Tätigkeit in Weimar. Er gefiel den jungen Prinzen, namentlich dem Erbprinzen Karl August, so sehr, dass sie ihm das Versprechen abnahmen, ihnen nach Mainz zu folgen, um dort noch einige Tage zuzubringen. Die in Frankfurt begonnenen Gespräche wurden in Mainz fortgesetzt und es folgte eine freundliche Einladung nach Weimar. Auch bewog man Goethe, einen Brief an Wieland wegen „Götter, Helden und Wieland“ zu schreiben. Im Sommer 1775 machte der Dichter mit den jungen Grafen Stollberg eine Reise in die Schweiz, und dass er schon damals auch zu der nach Weimar entschlossen war, zeigt sein Brief vom 28. September an die Schwester der Grafen: „ich erwarte den Herzog von Weimar und gehe mit ihm nach Weimar; deine Brüder kommen auch hin.“ Im Oktober sah er den Herzog Karl August wieder, der seine junge Gemahlin, die Prinzessin Louise von Darmstadt, mit welcher er eben in Karlsruhe getraut worden war, über Frankfurt nach seiner Residenz geleitete. Zu den Gründen, die ihn veranlassten der Einladung des Herzogs nachzukommen und die von der Art waren, „dass sie auch einen leidenschaftslosen Jüngling hätten aufregen und antreiben können“, kam seiner Überzeugung, dass er von Lili, seiner damaligen Geliebten, flüchten müsse, wie er früher seiner Leidenschaft zu Friederiken in Sesenheim, später seiner Liebe zu Lotten in Wetzlar entflohen war.
Ein in Karlsruhe zurückgebliebener Weimarischer Kavalier, der Kammerjunker von Kalb, welcher einen in Straßburg für Karl August verfertigten Landauer Wagen erwartete, sollte an einem bestimmten Tage in Frankfurt eintreffen und Goethe von da nach Weimar mitnehmen. Der Dichter nahm also von allen seinen Bekannten Abschied und packte ein, auch alle seine angefangenen literarischen Arbeiten, was jedenfalls zu der Annahme berechtigt, dass er einen ziemlich langen Aufenthalt in Weimar, wenn nicht gänzliches Verbleiben dort, für wahrscheinlich hielt. Es waren dies namentlich „Egmont“, „Faust“, „der ewige Jude“ und „Hanswursts Hochzeit“, die letztere, wie er selbst sich ausdrückt, von der „frechen Art“ wie „Götter, Helden und Wieland“, ein „tolles Fratzenwesen“, in dem sämtliches Personal aus lauter deutsch herkömmlichen Schimpf- und Ekelnamen bestand. Der zur Abreise bestimmte Tag kam, aber nicht der erwartete Kavalier mit dem Wagen. Es vergingen acht und mehr Tage. Der Vater Goethes hatte den Verkehr seines Sohnes mit den Prinzen immer ungern gesehen, weil er sich selbst, in seinen reichsbürgerlichen Gesinnungen, jederzeit von den Großen entfernt gehalten, und er erklärte nun die ganze Einladung und Verabredung für einen Hofstreich, den man der Unarten des Sohnes wegen habe ausgehen lassen, um ihn zu tränken und zu beschämen. Goethe selbst hielt zwar am Glauben fest, wollte sich aber, nachdem er einmal Abschied genommen hatte, nicht mehr zeigen, blieb also fortwährend zu Hause und schrieb, um sich die unangenehme Zeit des Wartens zu verkürzen, so fleißig an Egmont, dass er das Stück fast zu Stande brachte. Nur abends konnte er, der an das Herumschweifen im Freien gewöhnt war, zu Hause nicht aushalten; er schlich deshalb, in einen großen Mantel gehüllt, in der Stadt umher, namentlich auch an die Fenster der geliebten Lili, die in einem Erdgeschoß wohnte. Eines Abends hörte er sie da zum Klavier das Lied singen, das er vor nicht ganz einem Jahr ihr geschrieben hatte:
„Warum ziehst du mich unwiderstehlich.“ Das regte seine mit Mühe niedergehaltene Leidenschaft von neuem auf und es wurde ihm schwer „die so liebe Nähe zu verlassen.“
Der Weimarsche Kavalier mit dem Wagen kam auch in den nächstfolgenden Tagen nicht, nicht einmal ein Brief zur Erklärung des Ausbleibens und als der ungeduldig werdende Vater vorschlug, da der Koffer einmal gepackt sei, so möge er sofort nach Italien reisen, versprach er diese Reise anzutreten falls am nächsten Sonntag weder Wagen noch ein erklärender Brief erschienen sei. Er gesteht indes, dass er sich vorgenommen gehabt habe, auch wenn er die italienische Reise anträte, in Heidelberg noch eine Zeit lang zu bleiben, erstens weil er gewusst, dass der weimarische Wagen von Karlsruhe über Heidelberg kommen sollte, dann aber auch, weil in der letzteren Stadt Fräulein Delf, die Vertraute seines Liebesverhältnisses mit Lili, wohnte und er sich sehnte „mit einer werten, geduldigen und nachsichtigen Freundin die glücklichen Zeiten der Liebe noch einmal durchschwätzen zu können.“ Obgleich ihm der Vater jedenfalls mit Geld hinreichend ausstattete, lieh er doch auch von dem Freunde Merck noch zehn Carolin und als der als letzter Termin festgesetzte Tag wiederum den weimarischen Herrn nicht brachte, trat er die Reise – wie er meinte nach Italien – an.
Der Anfang des Tagebuchs, das er zu führen gedachte, hat sich erhalten und aus ihm lässt sich seine Stimmung deutlich erkennen:
„Ebersbach1, 30. Oktbr. 1775. – 'Bittet, dass Eure Flucht nicht geschehe im Winter, noch am Sabbat'2, ließ mir mein Vater zur Abschiedswarnung auf die Zukunft noch aus dem Bette zurufen. Diesmal, rief ich aus, ist's nun ohne mein Bitten und Zutun montags Morgen sechse, und was das Übrige betrifft, so fragt das liebe unsichtbare Ding3, das mich leitet und schult, nicht, ob und wann ich mag. Ich packte für Norden und ziehe nach Süden; ich sagte zu und komme nicht, ich sagte ab4 und komme. Frisch also! Die Torschließer klimpern vom Bürgermeister weg und ehe es tagt und mein Nachbar Schuhflicker seine Werkstätte und Laden öffnet, fort! Adieu, Mutter! Am Kornmarkte macht der Spenglerjunge rasselnd seinen Laden zurecht und begrüßt die Nachbarsmagd in dem dämmerigen Regen. Es war so was Ahndungsvolles auf den künftigen Tag in dem Gruß. Ach, dacht ich, wär doch ... – Nein, sagt‘ ich, es war auch eine Zeit... Wer Gedächtnis hat, sollte niemand beneiden... Lili, Adieu! Lili, zum zweiten Mal! Das erste Mal schied ich, noch hoffnungsvoll unser Schicksal zu verbinden. Es hat sich entschieden – wir müssen unsere Rollen einzeln ausspielen. Mir ist in dem Augenblicke weder bang für dich noch für mich, so verworren es aussieht. Adieu! Und du!5 wie soll ich dich nennen, dich, die ich wie eine Frühlingsblume im Herzen trage? Holde Blume sollst du heißen! Wie nehm' ich Abschied von dir? Getrost! Denn noch ist es Zeit, … noch die höchste Zeit! Einige Tage später – und schon – O lebe wohl! Bin ich denn nur in der Welt, mich in ewiger unschuldiger Schuld zu winden? – Und Merck, wenn Du wüsstest, dass ich hier der alten Burg so nahe sitze und sie herbeiflehe, der so oft das Ziel meiner Wanderung war! – Da läge denn der Grund meines Tagebuchs! Und das Weitere steht bei dem lieben Ding, das den Plan zu meiner Reise gemacht hat.“
In heiterer Weinlaune ist die einzige noch übrige Fortsetzung des Tagebuchs geschrieben:
„Weinheim, abends Sieben. Was nun aber der politische, moralische, epische oder dramatische Zweck von diesem allen? Der eigentliche Zweck der Sache, meine Herren, ist, dass sie gar keinen Zweck hat. So viel ist's gewiss, trefflich Wetter ist's, Stern und Halbmond leuchten und der Nachmittag war trefflich. Die Riesengebeine unserer Erzväter aufm Gebirg, Weinreben zu ihren Füßen Hügel ab gereiht, die Nussallee und das Tal den Rhein hin voll keimender frischer Wintersaat, das Laub noch ziemlich voll und da einen heitern Blick untergehender Sonne drein! – Wir fuhren um eine Ecke. „Ein malerischer Blick!“, wollt' ich rufen. Da fasst' ich mich zusammen und sprach: sieh, ein Fleckchen, wo die Natur in gedrungener Einfalt uns mit Lieb und Fülle sich um den Hals wirft. Ich hätte noch viel zu sagen, möcht ich mir den Kopf noch wärmer machen. Der Wirt entschuldigte sich wie ich eintrat, dass mir die Herbstbutten und Zuber im Weg ständen. Wir haben, sagt' er, eben dies Jahr, Gott sei Dank! reichlich eingebracht. Ich hieß ihn sich gar nicht stören, denn es sei sehr selten, dass einem der Segen Gottes inkommodiere. Heut Abend bin ich kommunikativ; mir ist als redet' ich mit Leuten, da ich das schreibe... Will doch allen Launen den Lauf lassen…“
Das hat er gewiss redlich getan, wie er auch später in Heidelberg sehr heiter war, wo ihn Demoiselle Delf in ihrem Hause aufnahm und in manche Familie einführte. Namentlich gefiel es ihm in dem Hause des Oberforstmeisters von Buchwitz, in Wahrheit und Dichtung mit W. bezeichnet, sehr wohl, denn eine Tochter desselben – ähnelte Friederiken, wie er sagt. „Es war die Zeit der Weinlese, das Wetter schön und die elsässischen Gefühle lebten wieder auf.“ Er fühlte sich gar bald heimisch und vergaß, dass er nach einem paar verschwatzten Abende die Reise fortsetzen sollte. Fräulein Delf bemerkte die neu aufkeimende Liebe Goethes zu Fräulein von Buchwitz, baute darauf ihre Pläne und wollte aus diesem Grunde von dem früheren Verhältnis zu Lilli nichts wissen, nicht reden. Sie gedachte nämlich Goethe, nach dessen Rückkehr von der angeblich beabsichtigten italienischen Reise, mit Fräulein von Buchwitz zu verheiraten und in den Dienst des Kurfürsten Karl Theodor von Mannheim zu bringen, um dem protestantischen Lande unter dem katholischen Fürsten einen hoffnungsvollen rüstigen Mann zuzuführen, Über diesen Plan hatte sie ihm eines Abends bis nach Mitternacht vorgeredet, Goethe war dann zu Bett gegangen, aber kaum eingeschlafen, als ihn die Hornklänge eines Postillions weckten, der an das Haus ritt. „Bald darauf“, erzählt er, „erschien Demoiselle Delf mit einem Licht und einem Brief in den Händen und trat an mein Bett. „Da haben wir's!“, rief sie aus. „Gewiss kommt es von den Weimarschen. Ist es eine Einladung, so folgen Sie ihr nicht und erinnern sich an unser Gespräch.“ Ich bat sie um das Licht und um eine Viertelstunde Einsamkeit. Sie verließ mich ungern. Die Stafette kam von Frankfurt: ich kannte Siegel und Hand; der Freund war dort angekommen. Ich eröffnete den Brief und alles war natürlich zugegangen. Der Ausgebliebene hatte auf den neuen Wagen Tag für Tag, Stunde für Stunde, wie wir auf ihn geharrt, war dann über Mannheim nach Frankfurt gegangen und hatte dort zu seinem Schreck mich nicht gefunden. Durch eine Stafette sendete er gleich das eilige Blatt ab, worin er voraussetzte, dass ich sofort nach aufgeklärtem Irrtum zurückkehren und ihm nicht die Beschämung bereiten wolle, ohne mich in Weimar anzukommen. Ich hatte mich unterdessen angezogen und ging in der Stube auf und ab. Meine ernste Wirtin trat herein und es gab eine heftige Szene, die ich dadurch endigte, dass ich meinen Burschen befahl Post zu bestellen. Sie wollte von nichts wissen und beunruhigte den Bewegten noch immer mehr. Der Wagen stand vor der Tür; aufgepackt war; der Postillion ließ das gewöhnliche Zeichen der Ungeduld erschallen; ich riss mich los; sie wollte mich noch nicht fahren lassen, sodass ich endlich leidenschaftlich und begeistert die Worte Egmonts ausrief: „nicht weiter! Wie von unsichtbaren Geistern gepeitscht, gehen die Sonnenpferde der Zeit mit unseres Schicksals leichtem Wagen durch und uns bleibt nichts als, mutig gefasst, die Zügel festzuhalten und bald rechts bald links, vom Steine hier, vom Sturze da die Räder abzuhalten. Wohin es geht, wer weiß es?“
Er fuhr nach Frankfurt zurück, sah die Mutter und den Vater wieder und setzte, trotz des Letzteren Verdrießlichkeit, die Reise mit dem weimarischen Kavalier fort. Am 7. Novbr. früh um fünf Uhr kamen sie in Weimar an und Herr von Kalb nahm den Gast seines Herzogs, bis derselbe eine passende eigene Wohnung gefunden haben würde, mit in das Haus seines Vaters, des alten Kammerpräsidenten, der ihm alle mögliche Gastfreundschaft und Aufmerksamkeit erwies, auch sofort die Gelegenheit zur völligen Aussöhnung mit Wieland herbeiführte und diesen deshalb noch denselben Tag zu Tische lud. Wieland kam und schrieb in einem Briefe am 10. Novbr. an Jacobi: „Goethe ist angelangt! Was soll ich sagen? Wie ganz der Mensch beim ersten Anblick nach meinem Herzen war! Wie verliebt ich in ihn wurde, da ich an der Seite des herrlichen Jünglings zu Tische saß! Alles was ich jetzt von der Sache sagen kann ist dies: seit dem heutigen Morgen ist meine Seele so voll von Goethe wie ein Tautropfen von der Morgensonne. Der göttliche Mensch wird, denk' ich, länger bei uns bleiben als er anfangs selbst dachte und wenn's möglich ist, dass aus Weimar etwas Gescheites werde, so wird es seine Gegenwart tun.“
„Wie ein Stern ging er in Weimar auf“, schreibt Knebel. „Er hatte noch die Werther-Montierung an und alle Welt musste bald im Werther-Frack gehen, in welchen sich auch der Herzog kleidete und wer sich keinen schaffen konnte, dem ließ der Herzog einen machen. Nur Wielanden nahm der Herzog aus, weil er zu alt zu diesen Mummereien wäre.“ Die „Werther-Montierung“ aber war die Kleidung, in welcher Werther sich erschossen hatte: blauer Frack mit Messingknöpfen, gelbe Weste, Lederbeinkleider und Stulpenstiefeln, welche letztere das Auffallendste waren, da in jener Zeit eigentlich kein Mann in anständiger Gesellschaft, namentlich vor Damen, anders als in seidenen Strümpfen und in Schuhen erschien und Stiefeln nur bei schlechtem Wetter getragen wurden. Dazu Zopf und Puder. Dieser Anzug war den Werther-Schwärmern darum so verehrungswürdig, weil Werther sagt: „in diesen Kleidern, Lotte, will ich begraben sein, denn du hast sie berührt, geheiligt.“
Eine Stunde von Darmstadt.
Matthäus XXIV. 20.
Ein damaliger Lieblingsausdruck Goethes.
Dem Fräulein Delf in Heidelberg, die ihn eingeladen hatte.
Gräfin Auguste von Stollberg. (S. Briefe an diese.)
Zweites Kapitel: Weimar bei Goethes Ankunft.
O Weimar, dir fiel ein besondres Loos.
Wie Bethlehem in Juda, klein und groß!
Goethe.
Die Stadt Weimar, welche der Schauplatz einer weitgreifenden und lang nachwirkenden Tätigkeit unseres Dichters werden sollte, war zur Zeit seiner Ankunft klein und arm. Sie zählte nur etwa sechstausend Einwohner. Zehn Jahre später nannte sie Schiller noch „das Dorf Weimar“ und ihm kam Jena im Vergleich mit ihr weit eher wie eine Stadt vor. Um dieselbe Zeit schreibt Herder: „das wüste Weimar, dieses Mittelding zwischen Dorf und Hofstadt.“ In einer geographischen Schrift „der Reisende“ heißt es: „Weimar ist ein mittelmäßiger Ort, dessen Gassen weder an Reinlichkeit und Anlage, noch an Bauart der Häuser dem heitern und luftigen Jena gleichkommen. Die Häuser sind meist alle dürftig gebaut, und es hat fast alles das armselige Ansehen einer nahrungslosen Landstadt. Man darf sich nicht weit von den Hauptstraßen entfernen, um in Winkel und Löcher zu kommen, welche noch mehr dieses Ansehen haben. Kein einziger Platz ist, der der Stadt eine residenzähnliche Ansicht gäbe. Unter den Bewohnern besteht bei weitem die größere Zahl aus kleinstädtischen Bürgern, welchen man weder die Verfeinerung einer Hofstadt, noch sonderlichen Wohlstand anmerkt. Alles lebt von dem Luxus eines eingeschränkten Hofes, dessen geringer Adel zum Teil arm ist, zum Teil aus Gelehrten oder schönen Geistern besteht, welche zu philosophisch denken, um des Hofes wegen Aufwand zu machen. Nur am Hofe ist Leben und Kultur. Die Übrigen, welche nicht dazu gehören, sind meistens Leute ohne Geschmack und Eleganz, welches man auch schon an ihrer Nachlässigkeit in der Aussprache merkt.“
Nach langem Suchen gelang es mir, einen Plan in ziemlich großem Maßstabe von Weimar in jener Zeit aufzufinden und mit Hilfe desselben versuche ich ein Bild der Stadt und ihrer nächsten Umgebung zu entwerfen, weil man sich keine ganz zutreffende Vorstellung von dem damaligen Leben dort machen kann, wenn man die Örtlichkeiten nicht genau kennt und weil vieles in den Briefen und Schilderungen aus jener Zeit ohne jene Kenntnis unverständlich bleiben muss.
Die eigentliche Stadt, die so ziemlich ein Viereck bildete, dessen östliche Seite das Schloss mit den dazu gehörigen Gebäuden einnahm, welche etwa ein Drittel des ganzen Stadtraumes bedeckten, war zunächst von Wasser umschlossen und zwar an der östlichen oder Schlossseite durch die Ilm, an der Südseite durch einen Arm der Lotte, den Schützengraben, an der westlichen durch einen zweiten, schmäleren Arm desselben Flüsschens und an der nördlichen durch eine Fortsetzung desselben, sowie durch eine Reihe lang gezogener Teiche. An der inneren oder Stadtseite dieser Wassergrenze zog sich eine Mauer hin, welche mehrere runde Türme, Überreste der ehemaligen Festungswerke, miteinander verband und durch die vier inneren Tore führten, das Frauentor, Erfurter-, Gerber- und Jacobstor. Nur an der Schlossseite fehlte diese Mauer.
Versuchen wir diese innere Stadt zu umgehen und wenden wir uns von der Stern- (sonst Schloss-) Brücke nach Norden zu, so kommen wir an der Burgmühle und dem Schlachthause (über den jetzigen Kegelplan) zum Gerbertor, die Gerbergasse hinauf zum Graben (jetzt „am untern und obern Graben“), dann an den Schweinemarkt (der zum Carlsplatze verschönert und umgewandelt ist), an dem Erfurter Tore hin (jetzt am Theater und über dem Theaterplatz) zur Esplanade an das (innere) Frauentor (sodass die jetzige Frauentorstraße, der Goetheplatz und Frauenstraße außerhalb beiden) und dem Schützengraben, der hinter dem Fürstenhause hin bis zu seiner Verbindung mit der Ilm hier die innere Stadt begrenzt.
Im Ganzen am wenigsten verändert hat sich die alte Jacobsvorstadt, die sonst wie jetzt im Süden an die innere Stadt, im Osten an die Ilm und einen Arm des Alsbachs, im Norden an diesen und im Westen an den Baumgarten und Schweinemarkt grenzte.
Das Schloss war im Jahre 1774 niedergebrannt und noch lagen die Trümmer da, die einen unheimlichen Anblick gewährten. Um das Schloss oder vielmehr den Trümmerhaufen rund herum lief der Burggraben, der nach der Brücke zu mit der Ilm durch einen Graben in Verbindung stand. Vor dem Schloss lag ein großer Teich, der Küchenteich, mit einer Insel in der Mitte, auf welcher das Kohlenmagazin stand. Aus diesem Teiche ist der jetzige grüne Platz vor dem Schloss nach dem Park zu geworden. Zwischen diesem Teich und der Ilm standen neben einander zunächst das Reithaus, die Hofschmiede und Hofwagnerei, das Schlossbrauhaus, weiterhin an dem Schützengraben, nach dem Fürstenhause, folgte das fürstliche Malzhaus und das Kammerarchiv, dem sich an der anderen Seite des Teiches hin die Bibliothek, das rote Schloss, der Gleich'sche Hof und das gelbe Schloss anreihten. Hinter dem Schützengraben und vor dem roten Schloss, der Bibliothek zur Seite, stand an einem freien Platze das Fürstenhaus.
Außerordentlich verändert ist die Ost-, Süd- und Westseite der Stadt und ihrer nächsten Umgebung. Vor dem Baumgarten standen, da wo jetzt die Bürgerschule steht, Magazinscheunen, welche die eine Seite des Schweinemarkts bildeten, während diesen nach Westen eine lange Doppelreihe von Bürgerscheunen einfasste und nach Osten der Ratsteich begrenzte. Von da an zog sich nach Süden bis zum Witthumspalais, dem gegenüber dann das Theater erbaut wurde, ein Weg mit wenigen Häusern von dem Erfurter Tore hin. Von dem Palais, innerhalb der Mauern bis zum inneren Frauentor, lief die Esplanade, ein mit Baumreihen bepflanzter Platz, an welchem später einzelne Häuser gebaut wurden, wie z. B. das, welches Schiller ankaufte. Vor dem (inneren) Frauentor ging rechts die Deinhardtsstraße ab, die an ein Gässchen führte, „an der Herzogin Vorwerk“ mit dem (Armbrust-) Schießhaus, jetzt Schützenstraße. Weiter hinauf vor dem Tore folgte der Frauenplan, wo das Haus schon stand, welches später Goethe gehörte, und von dem links die Seifengasse abführte, wie jetzt. Dann kam das äußere Frauentor, von dem aus fünf Wege strahlenförmig liefen, nämlich: nach Osten „an der Ackerwand“, nach Südosten die Straße nach Belvedere (jetzt Marienstraße), nach Süden der Weg nach Buffahrt, an dem vorn eine große Scheune stand (jetzt Friedhofsstraße), nach Südwesten der Weg nach Berka (jetzt Berkaer Straße) und westlich eine lange Baumallee, „am Junkerskirchhof“ (jetzt Brauhausstraße). An allen diesen Wegen vor dem Frauentor standen erst wenige Häuser, wie z. B. links an der Straße nach Belvedere und nach der Ackerwand zu das Koppenfelsische (das noch jetzt stehende Eckhaus) und neben ihm einige andere, auf deren Raume das jetzige große Haus des Buchhändler Voigt gebaut wurde. Ihnen folgten das große und kleine Jägerhaus und zuletzt das Schießhaus. Von diesem Schießhaus lief von der Chaussee (nach Belvedere) gerade nach Osten bis an das linke Ufer der Ilm eine Mauer, welche auf dieser Seite die Stadt abschloss. Den vierseitigen Raum zwischen dieser Mauer, den Jäger- und anderen Häusern an der Belvedere Straße, der Ackerwand und dem Exerzierplatze an der Ilm nahm der sogenannte Welsche Garten ein, der in altfranzösischem Geschmacke angelegt war. Im Sommer wurden Tänze und Spiele da gehalten, namentlich an der sogenannten Schnecke, einem turmartigen hölzernen Gebäude, um das herum in Schneckenwindungen ein Gang hinauf auf die Spitze führte, während sich unten eine Konditorei befand. Die ältesten Bewohner Weimars können sich dieser Schnecke noch erinnern, da sie erst im Anfange dieses Jahrhunderts abgetragen wurde. Sie befand sich an der Stelle des jetzigen großen Rondells im Parke. Vom Fürstenhause her führte ein etwas erhöhter Weg an dem linken Ufer der Ilm unter der Höhe weg (neben dem Exerzierplatz), zu einer Brücke, der Floßbrücke, auf der man an das rechte Ufer in den Stern gelangte. Ein wenig weiter (über die Brücke) hinauf, am linken Ufer, stand eine vom Fluss an bis an die Schießhausmauer vorgezogene Wand, wodurch der untere Raum nach der Stadt zu, nebst dem welschen Garten völlig abgeschlossen war. Vor dieser Wand lag ein wüster, unbetretener Platz, welcher um so weniger besucht war, als hier ein Türmchen sich an die Mauer lehnte, welches, zwar leer und unbenutzt, doch immer noch einige Furcht erregte, weil es früher dem Militär zur Aufbewahrung des Pulvers gedient hatte.
Am rechten Ufer der Ilm von der Schloss- oder Sternbrücke bis zu der oben erwähnten Floßbrücke war damals nur ein mit Bäumen und Büschen wohl ausgestatteter Raum, der Stern genannt. Es fanden sich da uralte geradlinige Gänge und Anlagen, hoch in die Luft sich erhebende stämmige Bäume, daher entspringende, mannigfaltige Alleen und breite Plätze zur Versammlung und Unterhaltung. Von der Floßbrücke aus zog sich im weiten Bogen ein Arm der Ilm, der Floßgraben genannt, bis ans Wasser am Schloss an der anderen Seite des Sterns herum, sodass derselbe, ganz von Wasser umgeben, eine Insel bildete. An der schmalsten Seite dieser Insel, in der Nähe der Schlossbrücke, befanden sich vier Teiche in einer Reihe und ihr spitzes Ende unten am Schloss bildete das Fischhaus.
Der Stern ist noch heutigen Tages fast genau so, wie er zu Goethes erster Zeit war, ziemlich mit denselben Wegen und Plätzen, nur ist unten das Fischhaus weggenommen und die Teiche sind ausgefüllt. Auch der Floßgraben existiert nicht mehr; der Floßholzplatz, der sich bis zu Goethes Garten hinauszog, ist beseitigt und zu dem Stern genommen worden. Ganz verschwunden ist dagegen der Welsche Garten. An seiner Stelle befindet sich der eigentlich sogenannte Park und der Küchengarten. Das Gärtnerhaus ist das ehemalige Schießhaus, das verlegt werden musste, da auch der Garten desselben zu den neuen Anlagen gezogen wurde.
An der Ackerwand, an welcher man jetzt eine Reihe eleganter Häuser sieht, befand sich damals nur die Gartenmauer des Hauses, das später Goethe angehörte, der Husarenstall und der fürstliche Stall (ehemaliges Sieden-Vorwerk, jetzt die griechische Kapelle) und ein Orangeriehaus, das lange verschwunden ist.
Die Häuser der Stadt waren meist alt und hässlich, mit der Giebelseite der Straße zugekehrt, ein, selten zwei Stock hoch, die Straßen eng, winklig und nicht alle, oder doch sehr schlecht gepflastert, sodass es namentlich in der Dunkelheit gefährlich war, in ihnen zu gehen, zumal die Beleuchtung noch nicht vorhanden. Bürger, die in der Nacht ausgingen, mussten eine Laterne bei sich haben; Vornehmere ließen sich eine solche vortragen, oder von Fackelträgern leuchten. Die Bürger trieben, wie in anderen kleinen Städten, die gewöhnlichen Handwerke in kleinlich beschränktem Maße und nebenbei zum größten Teile auch Ackerbau und Viehzucht. Ein Weimarscher Freund, dessen Erinnerungen bis an das Ende des vorigen Jahrhunderts reichen, weiß es noch aus seinen Kinderjahren recht wohl, dass der Hirt der Residenz das städtische Vieh zu bestimmten Stunden mit Horntönen zusammenberief, um es auf die Weide zu treiben. Es konnte also wohl geschehen, dass eine Gesellschaft Herren und Damen vom Hofe in der Stadt der grunzenden und blökenden Herde begegnete und vor derselben wohl gar flüchten musste. Die Wohnungen, die Möbel, die Lebensweise waren sehr einfach; in wenigen Zimmern gab es Vorhänge, am wenigsten weiße; die Tische und Stühle bestanden meist aus schlichtem Tannenholze; wenige Familien besaßen „Kanapees“; die Spiegel waren klein und schlecht. Sinn für Literatur und Kunst gab es eigentlich nur in den Hofkreisen. „So viele Familien, eben so viele abgesonderte Schneckenhäuser“, sagt Schiller noch später, „aus denen der Eigentümer kaum herausgeht, um sich zu sonnen.“ Diese Beschränkung auf sich selbst und das Nächste wurde durch die Abgeschlossenheit von der Welt unterstützt. Weimar hatte nur sehr wenige und seltene Postverbindungen; Zeitungen kamen in die Bürgerkreise fast gar nicht; das Reisen war beschwerlich und der Zustand der Wege ein trauriger. Man konnte fast nur zu Pferd reisen und so finden wir auch Goethe auf seinen vielfachen Wanderungen im Lande stets zu Pferde. Die Nachrichten von der Außenwelt kamen sehr spät in die kleine Stadt, die sich seltsamer Weise damals noch festungsartig abschloss. Wer im Wagen durch ein Tor ein- oder auspassierte, wurde angehalten und musste Namen und Stand angeben, damit es dem Herzog gemeldet werden könnte. Selbst der Günstling Goethe hatte darunter zu leiden. Eines Tages wollte er mit Frau von Stein eine Morgenspazierfahrt machen, er schrieb ihr aber: „wenn du am Tor nicht gemeldet sein willst, so ist das Sicherste, du steigst an der Sternbrücke aus und ein; bestelle den Wagen dorthin, ich hole dich ab. Sonst geht's nicht, man müsste es denn dem Torschreiber melden und das sieht kurios aus.“
Wie die Bildung, stand die Moral keineswegs auf hoher Stufe. Goethe wurde einst, auf dem Wege nach seinem Gartenhause, ganz in der Nähe des Tores, abends von zwei Männern angefallen. Vergehen gegen die eheliche Treue nahm man sehr leicht, namentlich in den höheren Kreisen. Schiller versichert 1787, fast jede Dame habe noch ein Verhältnis oder habe ein solches gehabt. Und allerdings kennen wir solche außerehelichen Verhältnisse in ziemlicher Anzahl. Wieland wurde wegen seiner ehelichen Treue vielfach verspottet, selbst von Karl August. Schiller rühmt es als zarte Aufmerksamkeit, sein offenkundiges Verhältnis zu Charlotte von Kalb werde selbst von den Herzoginnen so weit berücksichtigt, dass man ihn mit jener Frau zusammen einlade.
Die Damen trugen nicht bloß den Busen sehr entblößt, auch ihr Herz war sehr leicht zugänglich. Die überall hervortretende starke Sinnlichkeit erklärt, dass die zum Teil sehr schlüpfrigen Erzählungen Wielands nicht nur keinen Widerwillen erregten, sondern großen Beifall fanden, und in allen Kreisen, von Frauen und Mädchen, gelesen wurden. Es erklärt dies ferner, dass man Dinge, welche man in unseren Tagen kaum anzudeuten wagt, ungescheut, mit den ganz gemeinsten Worten bezeichnete und sie selbst in Frauenkreisen aussprach. Man lese z. B. nur die erste Ausgabe von Goethes „Puppenspiel“ und denke sich, dass dasselbe überall gelesen, ja in Ettersburg aufgeführt wurde. Es erscheint dies auf den ersten Blick um so auffallender, weil man gerade in den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts einer so schwärmerisch zarten Empfindelei verfallen war, dass man in den Tränen, die man bei jeder Gelegenheit zu vergießen suchte, einen süßen Genuss fand, aber „wer einen Gruß an das liebe Fleisch zu bestellen hat, braucht nur das gute Herz Boten gehen zu lassen.“
Zum Schluss nur noch einige Bemerkungen über einige Örtlichkeiten.
Als die Flammen 1774 das herzogliche Schloss verzehrt hatten, musste plötzlich das zu andern Zwecken bestimmte und noch nicht ganz fertige Fürstenhaus zur fürstlichen Wohnung eingerichtet werden. Die Räumlichkeiten darin waren weder groß noch glänzend, auch ziemlich einfach eingerichtet. Hierher brachte Karl August seine junge Gemahlin, hier war der Schauplatz der ersten heitern Feste, hierher kam Goethe zur Tafel, zu Konzert, Komödie und Ball, hier übernachtete er oft bei dem fürstlichen Freunde, besonders vor oder nach einer Jagd und hier fanden die Sitzungen des geheimen Conseils statt. Im Erdgeschosse befanden sich Kasten, Wohnungen für Hofbeamte und Gäste, sowie Gesellschaftsräume; im ersten Stocke waren die Gemächer der Herzogin Louise, im zweiten die Karl Augusts. Der linke Flügel war von dem rechten durch einen großen Saal im ersten Stocke getrennt, zu dem die in den Briefen aus jener Zeit oft genannte Galerie führte. Die Hofküche hatte man gegenüber an das sogenannte rote Haus angebaut. Weil die erste Einrichtung sehr übereilt gemacht worden war, musste viele Jahre hintereinander daran repariert werden und Karl August schreibt noch 1781 an Merck:
„Endlich sind auch vor der Hand die Reparaturen im Hause, das wir bewohnen, fertig geworden. Das Haus steht ungefähr 12 Jahre und schon 2 Jahre hintereinander haben wir die Köpfe der Hauptbalken ausschneiden müssen, die verfault waren. Dieses Jahr fiel eine Decke ein und der große Saal musste erst jetzt berohrt werden, da er vordem bloß mit geweihtem Lehm bedeckt war. Die Decke ist 74 Fuß lang, auf etliche und vierzig breit und bloß mit Lehm beworfen und drohte auch schon den Einsturz. In dem Zimmer, wo die Decke einfiel, fanden sich alle Balken gesenkt und gebogen; der eine war von einem Kamin, der auf ihm, ohne weiteren Halt stand, 9 Zoll gesenkt worden. Fast alle Monate bekamen die Schiedmauern neue Risse. Das ganze Haus ist nicht anders als ein viereckiger Kasten gebaut, in welchem die inneren Mauern, ohne einzugreifen, noch durch Klammern verbunden zu sein, stecken. So sind wir mit diesem Hause geplagt.“
Dem Fürstenhause gegenüber und von diesem durch den Stadtgraben getrennt, aber, wenn ich nicht irre, damals durch einen bedeckten Gang mit ihm verbunden, stand das schon erwähnte fürstliche Stallgebäude, in dem sich jetzt die griechische Kapelle befindet. Hier im linken Flügel wohnte der Oberforstmeister v. Wedel, im rechten der Oberstallmeister v. Stein und hierher wanderte Goethe fast täglich, die geliebte Freundin, die Frau von Stein, zu besuchen, zu der er von seinem Garten aus gerade 10 Minuten zu gehen hatte.
Die verwitwete Herzogin Amalie bewohnte, wenn sie sich nicht in Schloss Ettersburg oder in Tiefurt aufhielt, das Haus, welches das Palais heißt, von dem Geheimen Rat v. Fritsch 1767 gebaut und ihr nach dem Schlossbrande überlassen worden war. Es war damals von einem Garten umgeben, welchen ein Bach durchströmte, der ein Bassin darin bildete. An der einen Seite reichte dieser Garten bis an die Erfurter Straße und an der andern bis in den jetzigen Theaterplatz hinein. Rundherum wurde er durch eine lebendige Hecke begrenzt. Im Garten stand ein Lusthaus mit Malereien von Oeser, der auch mehrere Zimmer im Palais selbst mit Deckengemälden versehen hatte. In diesen Räumen versammelte die geistvolle Fürstin die Sterne Weimars um sich; hier hielt sie ihre wissenschaftlichen Abende, an denen Goethe, Herder und andere Vorträge hielten; hier hauchte sie ihre edle Seele aus, und hier hielt Goethe die Rede zum Andenken Wielands, denn ein Saal in dem Gebäude wies Karl August nach dem Tode seiner Mutter für immer der Amalienloge zu.
Drittes Kapitel: Der Kreis, in welchen Goethe eintrat.
Auf einem so kleinen Flecke, wie in einer Familie,
findet sich's so nicht wieder.
Goethe.
Der Hof, auf welchen Goethe so außerordentlich einwirken sollte, war den Hauptpersonen nach ein jugendlicher und also schon deshalb der Heiterkeit und dem Genuss zugeneigt, denn 1775, als der Dichter da erschien,
war die verwitwete Herzogin Amalie (geb. 20. Oktbr. 1739) 36 Jahre alt;
der regierende Herzog Karl August (geb. 3. Sept. 1757) 18 Jahre alt;
die regierende Herzogin Louise (geb. 31. Jan. 1757) 18 Jahre alt;
der Prinz Constantin (geb. 8. Sept. 1758) 17 Jahre alt;
die Frau von Stein (geb. 25. Sept. 1742) 33 Jahre alt;
von Einsiedel (geb. 30. April 1750) 25 Jahre alt;
von Knebel (geb. 30. Nov. 1744) 31 Jahre alt;
Bertuch (geb. 30. Sept. 1748) 27 Jahre alt;
Wieland (geb. 5. Sept. 1733) 42 Jahre alt usw.
Ehe wir aber, der Wahrheit so getreu als möglich, das Leben und Streben an diesem Hofe in jener Zeit zu schildern versuchen, von welcher sich mehr Traditionen und Klatschereien als beglaubigte Erzählungen von Tatsachen erhalten haben, müssen wir eine kurze Charakterisierung derjenigen Personen vorausschicken, welche eine Hauptrolle spielten.
Karl August
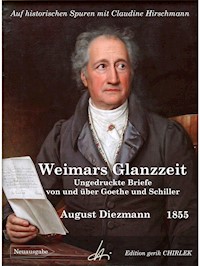


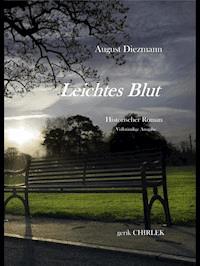
![Leipzig. Skizzen aus Vergangenheit und Gegenwart. [1856] - August Diezmann - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/9fb6152dc13ed5276813a47898198dbe/w200_u90.jpg)
























