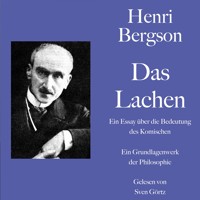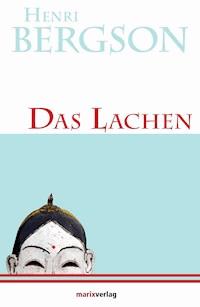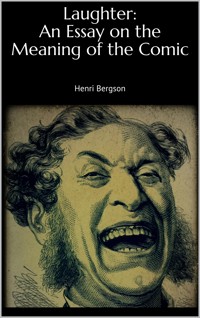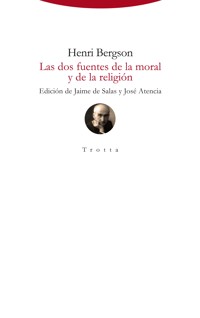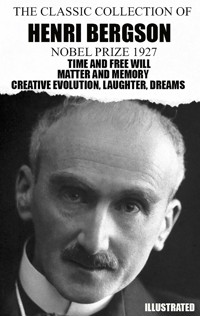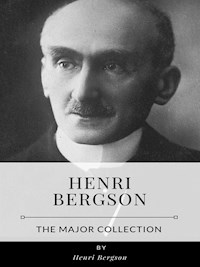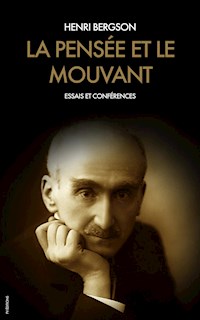3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: apebook Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
“Materie und Gedächtnis” (Französisch: “Matière et mémoire”, 1896) ist ein Buch des französischen Philosophen Henri Bergson. Sein Untertitel lautet “Essai sur la relation du corps à l’esprit” (Abhandlung über die Beziehung zwischen Körper und Geist). Das Werk stellt eine Analyse der klassischen philosophischen Probleme bezüglich dieser Beziehung dar. Innerhalb dieses Rahmens dient die Analyse des Gedächtnisses dazu, das Problem zu klären. “Materie und Gedächtnis” wurde als Reaktion auf das 1881 erschienene Buch “Les maladies de la mémoire” von Théodule Ribot geschrieben. Ribot behauptete, dass die Erkenntnisse der Hirnforschung bewiesen, dass das Gedächtnis in einem bestimmten Teil des Nervensystems angesiedelt sei, nämlich im Gehirn, und dass es daher materieller Natur sei. Bergson war gegen diese Reduktion von Geist auf Materie. Er vertrat eine klare antireduktionistische Position und vertrat die Auffassung, dass das Gedächtnis eine zutiefst spirituelle Natur hat und das Gehirn dem Bedürfnis dient, das gegenwärtige Handeln zu orientieren, indem es relevante Erinnerungen einfügt. Da das Gehirn also praktischer Natur ist, neigen bestimmte Läsionen dazu, diese praktische Funktion zu stören, ohne jedoch die Erinnerung als solche zu löschen. Die Erinnerungen sind stattdessen einfach nicht ‘inkarniert’ und können ihren Zweck nicht erfüllen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 419
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
HENRI BERGSON
MATERIE UND GEDÄCHTNIS
EINE ABHANDLUNG ÜBER DIE
BEZIEHUNG ZWISCHEN
KÖRPER UND GEIST
ÜBERSETZT
VON
JULIUS FRANKENBERGER
MATERIE UND GEDÄCHTNIS wurde zuerst veröffentlicht vom Eugen Diederichs Verlag, Jena 1919.
Diese Ausgabe wurde aufbereitet und herausgegeben von
© apebook Verlag, Essen (Germany)
www.apebook.de
2023
V 1.0
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-96130-596-4
Buchgestaltung: SKRIPTART, www.skriptart.de
Books made in Germany with
Bleibe auf dem Laufenden über Angebote und Neuheiten aus dem Verlag mit dem lesenden Affen und
abonniere den kostenlosen apebook Newsletter!
Du kannst auch unsere eBook Flatrate abonnieren.
Dann erhältst Du alle neuen eBooks aus unserem Verlag (Klassiker und Gegenwartsliteratur)
für einen kleinen monatlichen Beitrag (Zahlung per Paypal oder Bankeinzug).
Hier erhältst Du mehr Informationen dazu.
Follow apebook!
ROMANE von JANE AUSTEN
im apebook Verlag
Verstand und Gefühl
Stolz und Vorurteil
Mansfield Park
Northanger Abbey
Emma
*
* *
HISTORISCHE ROMANREIHEN
Der erste Band jeder Reihe ist kostenlos!
Die Geheimnisse von Paris. Band 1
Mit Feuer und Schwert. Band 1: Der Aufstand
Quo Vadis? Band 1
Bleak House. Band 1
Am Ende des Buches findest du weitere Buchtipps und kostenlose eBooks.
Und falls unsere Bücher mal nicht bei dem Online-Händler deiner Wahl verfügbar sein sollten: Auf unserer Website sind natürlich alle eBooks aus unserem Verlag (auch die kostenlosen) in den gängigen Formaten EPUB (Tolino etc.) und MOBI (Kindle) erhältlich!
Inhaltsverzeichnis
Materie und Gedächtnis
Impressum
Vorwort zur 7. Auflage
I. Von der Auswahl der Bilder bei der Vorstellung. Die Funktion des Leibes
II. Vom Wiedererkennen der Bilder. Gedächtnis und Gehirn
III. Allmählicher Übergang von den Erinnerungen zu den Bewegungen. Wiedererkennung und Aufmerksamkeit.
IV. Von der Abgrenzung und Fixierung der Bilder. Wahrnehmung und Materie. Seele und Leib
Zusammenfassung und Schluß
Eine kleine Bitte
Buchtipps für dich
Kostenlose eBooks
A p e B o o k C l a s s i c s
N e w s l e t t e r
F l a t r a t e
F o l l o w
A p e C l u b
Links
ApePoints sammeln
Zu guter Letzt
Vorwort zur 7. Auflage
Dieses Buch bejaht die Realität des Geistes und die Realität der Materie und versucht die Beziehung zwischen beiden klarzulegen an dem speziellen Beispiel des Gedächtnisses. Es ist also ausgesprochen dualistisch. Aber andrerseits betrachtet es Körper und Geist auf eine solche Art, daß es viel zur Milderung wenn nicht Hebung der theoretischen Schwierigkeiten beizutragen hofft, die immer aus dem Dualismus erwachsen sind und die daran Schuld sind, daß er, den doch das unmittelbare Bewußtsein nahelegt und der gesunde Menschenverstand annimmt, bei den Philosophen in sehr geringem Ansehen steht.
Diese Schwierigkeiten stammen größtenteils aus dem bald realistischen, bald idealistischen Begriffe, den man sich von der Materie macht. Unser erstes Kapitel will zeigen, daß beide, Idealismus und Realismus, gleich übertriebene Theorien sind, daß es falsch ist, die Materie auf die Vorstellung zu reduzieren, die wir von ihr haben, und ebenso falsch, ein Ding aus ihr zu machen, das in uns Vorstellungen erzeugt, das aber von anderer Natur wäre als diese Vorstellungen. Für uns ist die Materie eine Gesamtheit von »Bildern«. Und unter »Bild« verstehen wir eine Art der Existenz, die mehr ist als was der Idealist »Vorstellung« nennt, aber weniger als was der Realist »Ding« nennt – eine Existenz, die halbwegs zwischen dem »Ding« und der »Vorstellung« liegt. Diese Auffassung der Materie ist ganz einfach die des gesunden Menschenverstandes. Ein Mensch, dem philosophische Spekulationen fremd sind, würde sehr erstaunt sein, wenn man ihm sagte, daß der Gegenstand, den er vor sich hat, den er sieht und fühlt, nur in seinem Geiste und nur für seinen Geist existiert oder gar, allgemeiner, nur für einen Geist existiert, wie Berkeley es wollte. Unser Mann würde immer behaupten, daß der Gegenstand unabhängig von dem Bewußtsein existiert, das ihn wahrnimmt. Aber andrerseits würden wir ihn ebenso erstaunen, wenn wir ihm sagten, daß der Gegenstand ganz verschieden ist von dem, was man an ihm wahrnimmt, daß er weder die Farbe hat, die das Auge ihm verleiht, noch die Festigkeit, die die Hand an ihm findet. Für ihn sind Farbe und Festigkeit am Gegenstand: keine Zustände unseres Geistes, sondern die konstitutiven Elemente einer von der unseren unabhängigen Existenz. Für den gesunden Menschenverstand existiert also der Gegenstand an sich, und andrerseits ist der Gegenstand an sich farbig, wie wir ihn wahrnehmen: er ist ein Bild, aber ein Bild, das an sich existiert.
Ganz in diesem Sinne fassen wir das Wort »Bild« in unserm ersten Kapitel. Wir stellen uns auf den Standpunkt eines Geistes, der vom Streit der Philosophen nichts weiß. Dieser Geist glaubt von Haus aus, daß die Materie so existiert, wie er sie wahrnimmt; und da er sie als Bild wahrnimmt, macht er sie zum Bild an sich. Mit einem Worte, wir betrachten die Materie vor der Scheidung, die Idealismus und Realismus zwischen ihrer Existenz und ihrer Erscheinung vollzogen haben. Ohne Zweifel ist es schwer geworden, diese Scheidung zu vermeiden, seit die Philosophen sie einmal gemacht haben. Wir verlangen indessen vom Leser, daß er sie vergißt. Wenn sich im Laufe dieses ersten Kapitels seinem Geiste Einwände gegen diese oder jene unsrer Thesen aufdrängen, so prüfe er, ob diese Einwände nicht immer daher kommen, daß er sich wieder auf den einen oder den andern der beiden Standpunkte stellt, über die sich zu erheben wir ihn einladen.
Ein großer Fortschritt in der Philosophie wurde an dem Tage geleistet, wo Berkeley gegen die »mechanical philosophers« feststellte, daß die sekundären Qualitäten mindestens ebensoviel Realität haben wie die primären. Sein Irrtum war, daß er glaubte, man müsse dazu die Materie in das Innere des Geistes versetzen und aus ihr eine reine Idee machen. Zweifellos hat Descartes die Materie zu weit von uns weggeschoben, als er sie mit der geometrischen Ausdehnung zusammenwarf. Aber um sie uns wieder näher zu bringen, war es keineswegs nötig, so weit zu gehen, daß sie mit unserm Geiste selbst zusammenfiel. Weil Berkeley soweit ging, sah er sich unfähig, den Erfolg der Physik zu erklären, und gezwungen, wo Descartes aus den mathematischen Relationen zwischen den Erscheinungen ihr eigentliches Wesen gemacht hatte, die mathematische Ordnung des Weltalls für einen reinen Zufall zu halten. Die Kantische Kritik wurde dadurch nötig, um dieser mathematischen Ordnung ihr Recht und unsrer Physik eine feste Grundlage zu geben – was ihr übrigens nur so gelang, daß sie die Tragweite unsrer Sinne und unsres Verstandes einschränkte. Die Kantische Kritik wäre, wenigstens in diesem Punkte, nicht nötig gewesen, der menschliche Geist hätte, wenigstens in dieser Richtung, seine eigene Tragweite nicht einzuschränken brauchen, die Metaphysik wäre der Physik nicht geopfert worden, wenn man sich dazu entschlossen hätte, die Materie halbwegs zwischen dem Punkt zu lassen, wo Descartes sie hinschob, und dem, wohin Berkeley sie zog – das heißt am Ende da, wo der gesunde Menschenverstand sie sieht. Unser erstes Kapitel definiert diese Weise, die Materie zu betrachten; unser viertes zieht daraus die Konsequenzen.
Aber wir behandeln, wie wir es eingangs angekündigt haben, die Frage der Materie nur in dem Maße wie sie das Problem des zweiten und dritten Kapitels dieses Buches angeht, das Problem, welches der Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist: das Problem der Beziehung des Geistes zum Körper.
Obwohl von dieser Beziehung in der Geschichte der Philosophie beständig die Rede ist, ist sie doch in Wirklichkeit sehr wenig studiert worden. Läßt man die Theorien beiseite, die lediglich die »Verbindung von Seele und Leib« als eine unauflösliche und unerklärbare Tatsache feststellen, und jene, die obenhin vom Körper als vom Werkzeug der Seele sprechen, so bleibt kaum eine andere Auffassung der psychologischen Beziehung als die »epiphänomenistische« oder die »parallelistische« Hypothese, die beide in der Praxis – ich meine in der Erklärung der einzelnen Tatsachen – auf dieselben Schlüsse hinauslaufen. In der Tat, ob man nun das Denken als eine einfache Funktion des Gehirns und den Bewußtseinszustand als ein Epiphänomenon des Gehirnzustandes ansieht oder ob man die Denkzustände und die Gehirnzustände für zwei Übersetzungen desselben Originals in zwei verschiedene Sprachen hält, in beiden Fällen macht man die grundsätzliche Voraussetzung, daß wir, könnten wir nur in das Innere eines arbeitenden Gehirnes eindringen und dem Tanz der Atome, aus denen die Hirnrinde besteht, beiwohnen und besäßen wir andrerseits den Schlüssel der Psychophysiologie, bis ins Einzelne wissen würden, was in dem entsprechenden Bewußtsein vor sich geht.
Dies ist wirklich ganz allgemein die Meinung der Philosophen sowohl als der Gelehrten. Trotzdem bestünde Anlaß zu der Frage, ob die Tatsachen, wenn man sie unvoreingenommen prüft, wirklich zu einer derartigen Hypothese führen. Daß zwischen dem Bewußtseinszustand und dem Gehirn ein Zusammenhang besteht, ist unbestreitbar. Es besteht aber auch ein Zusammenhang zwischen dem Kleid und dem Nagel, an dem es aufgehängt ist, denn wenn der Nagel herausgezogen wird, fällt das Kleid herunter. Kann man deshalb sagen, daß die Form des Nagels die Form des Kleides andeute oder uns irgendeinen Schluß auf sie erlaube? Ebensowenig kann man daraus, daß die psychologische Tatsache an einen Gehirnzustand angehängt ist, auf den »Parallelismus« der beiden Reihen, der psychologischen und der physiologischen, schließen. Wenn die Philosophie diese parallelistische These auf die Tatsachen der Wissenschaft zu stützen vorgibt, so begeht sie einen wahrhaften circulus vitiosus: denn wenn die Wissenschaft den Zusammenhang, der eine Tatsache ist, im Sinne des Parallelismus erklärt, der eine Hypothese ist (und eine recht wenig verständliche Hypothese), F1 so geschieht das, bewußt oder unbewußt, aus Gründen philosophischen Ranges. Es geschieht, weil sie durch eine gewisse Philosophie an den Glauben gewöhnt ist, es gäbe keine einleuchtendere Hypothese, keine, die den Interessen der positiven Wissenschaft besser entspräche.
Wenn man sich nun an die Tatsachen um bestimmte Angaben zur Lösung des Problems wendet, findet man sich auf das Gebiet des Gedächtnisses versetzt. Das war zu erwarten, denn das Gedächtnis stellt – wie wir im vorliegenden Werke zu zeigen versuchen – den Schnittpunkt zwischen Geist und Materie dar. Aber diese Überlegung braucht es gar nicht: niemand wird, glaube ich, bezweifeln, daß in der Summe der Tatsachen, die einiges Licht auf die psychophysiologische Beziehung werfen können, diejenigen, die das Gedächtnis angehen, sei es im normalen, sei es im pathologischen Zustande, einen bevorzugten Platz einnehmen. Nicht allein liegt hier eine außerordentliche Fülle von Dokumenten vor (man denke nur an die erstaunliche Masse von Beobachtungen über die verschiedenen Sprachstörungen!), sondern nirgends auch haben so glücklich wie hier Anatomie, Physiologie und Psychologie zusammengearbeitet. Wer ohne vorgefaßte Meinung auf dem Boden der Tatsachen an das alte Problem der Beziehungen zwischen Seele und Leib herangeht, dem verdichtet sich sehr bald dieses Problem um die Frage des Gedächtnisses, ja noch enger des Wortgedächtnisses: von daher wird ohne Zweifel das Licht kommen, das die dunkleren Seiten des Problems erhellen kann.
Man wird sehen, wie wir es zu lösen versuchen. Allgemein gesprochen: der psychische Zustand scheint uns in den meisten Fällen weit über den Gehirnzustand hinauszugehen. Ich meine, daß der Gehirnzustand nur einen kleinen Teil davon bezeichnet und zwar jenen, der sich in örtliche Bewegungen übersetzen läßt. Man nehme einen komplexen Gedanken, der sich in einer Reihe abstrakter Überlegungen entfaltet. Dieser Gedanke ist begleitet von der Vorstellung von Bildern, zum mindesten in Ansätzen. Und diese Bilder werden im Bewußtsein nicht vorgestellt, ohne daß, wenn auch nur skizzenhaft oder der Tendenz nach, die Bewegungen angedeutet werden, in denen die Bilder sich selbst im Raume abspielen würden – ich meine, dem Körper diese oder jene Haltungen aufprägen, all das freisetzen würden, was sie implizite an räumlicher Bewegung enthalten. Nun, von dem sich entfaltenden komplexen Gedanken ist das unsrer Meinung nach alles, was der Gehirnzustand jeweils anzeigt. Wer ins Innere eines Hirnes dringen und dem, was da vorgeht, zusehen könnte, würde wahrscheinlich über diese skizzierten oder vorbereiteten Bewegungen Aufschluß bekommen; nichts weist daraufhin, daß er über irgend etwas anderes Aufschluß bekäme. Und wäre er auch mit übermenschlicher Intelligenz begabt, besäße er auch den Schlüssel der Psychophysiologie, er würde über das, was in dem entsprechenden Bewußtsein vor sich geht, nicht mehr und nicht minder aufgeklärt werden, als wir es über ein Theaterstück würden durch das Gehen und Kommen der Schauspieler auf der Bühne.
Das heißt, daß die Beziehung des Geistigen zum Zerebralen nicht eine konstante und ebensowenig eine einfache Beziehung ist. Je nach der Natur des Stückes, das gespielt wird, sagen die Bewegungen der Schauspieler mehr oder weniger darüber aus: fast alles, wenn es sich um eine Pantomime, fast nichts wenn es sich um eine geistreiche Komödie handelt. So enthält unser zerebraler Zustand mehr oder weniger von unserem geistigen Zustand, je nachdem ob wir unser seelisches Leben mehr in Tätigkeit veräußerlichen oder mehr in reine Erkenntnis verinnerlichen.
Kurzum, es gibt verschiedene Tonarten geistigen Lebens, und unser seelisches Leben kann sich in verschiedener Höhe abspielen, bald näher, bald ferner der Tätigkeit, je nach dem Grade unserer Aufmerksamkeit auf das Leben. Das ist eine der Leitideen des vorliegenden Werkes, sie hat unsrer Arbeit als Ausgangspunkt gedient. Was man gewöhnlich für eine größere Komplikation des seelischen Zustandes hält, erscheint uns von unserm Standpunkt aus als eine größere Ausweitung unsrer gesamten Persönlichkeit, die, normalerweise durch ihre Tätigkeit zusammengepreßt, sich um so mehr ausbreitet, je mehr sich der Schraubstock, in den sie sich einspannen läßt, lockert, und sich, immer ungeteilt, über eine um so größere Fläche erstreckt. Was man gewöhnlich für eine Störung des seelischen Lebens selber, eine innere Unordnung, eine Erkrankung der Persönlichkeit hält, erscheint uns von unserm Standpunkt aus als ein Nachlassen oder Verderben des Bandes, das das seelische Leben mit seiner motorischen Begleitung verbindet, als eine Stockung oder Schwächung unsrer Aufmerksamkeit auf das äußere Leben. Diese Anschauung, wie übrigens auch jene andere, die die Lokalisation der Worterinnerungen leugnet und die Aphasien ganz anders als durch diese Lokalisation erklärt, wurde bei der ersten Veröffentlichung dieses Werkes (1896) für paradox gehalten. Heute wird sie das viel weniger scheinen. Die damals klassische, allgemein angenommene und für unangreifbar gehaltene Auffassung der Aphasie ist in den letzten Jahren sehr erschüttert worden, besonders von der Anatomie her, zum Teil aber auch aus psychologischen Gründen gleicher Gattung, wie wir sie damals dargelegt haben. Und die gründliche und originelle Untersuchung der Neurosen durch Pierre Janet F2 hat diesen Forscher letzthin auf ganz anderen Wegen, über das Studium der »psychasthenischen« Formen der Krankheit, dazu geführt, jene selben Begriffe der psychologischen »Spannung« und der »Aufmerksamkeit auf die Wirklichkeit« anzuwenden, die zuerst als metaphysisch qualifiziert worden waren. F3
In Wahrheit hatte man nicht ganz unrecht, sie so zu bezeichnen. Ohne der Psychologie sowenig wie der Metaphysik das Recht zu bestreiten, sich als selbständige Wissenschaft zu etablieren, halten wir doch dafür, daß eine jede der beiden Wissenschaften der andern Probleme stellen soll und bis zu einem gewissen Maße zu deren Lösung beitragen kann. Wie sollte das auch anders sein, wenn der Gegenstand der Psychologie das Studium des menschlichen Geistes ist, insofern er nützlich für die Praxis funktioniert, und wenn die Metaphysik nur der Versuch dieses selben menschlichen Geistes ist, sich von den Bedingungen der nutzhaften Tätigkeit zu befreien und sich wieder als reine schöpferische Kraft zu erfassen? Sehr viele Probleme, die nichts miteinander zu tun zu haben scheinen, wenn man sich an den Buchstaben der Begriffe hält, in denen die beiden Wissenschaften sie formulieren, erscheinen als sehr benachbart und der gegenseitigen Auflösung fähig, wenn man so ihre innere Bedeutung tiefer faßt. Wir hätten beim Beginn unserer Untersuchungen nicht geglaubt, daß irgendein Zusammenhang bestehen könne zwischen der Analyse des Gedächtnisses und den Fragen, die zwischen Realisten und Idealisten oder zwischen Mechanisten und Dynamisten über Existenz oder Wesen der Materie im Schwange sind. Und doch ist dieser Zusammenhang wirklich, ja er ist innig, und wenn man sich das klar vor Augen hält, so sieht man ein metaphysisches Hauptproblem auf das Gebiet der Beobachtung verpflanzt, wo es fortschreitend gelöst werden kann, anstatt daß es dem ewigen Streit der Schulen auf dem eingehegten Felde der reinen Dialektik immer neue Nahrung gibt. Die Kompliziertheit gewisser Teile des vorliegenden Werkes liegt an der unvermeidlichen Verschlungenheit der Probleme, die sich einstellt, wenn man die Philosophie von dieser Ecke aus anfaßt. Aber wir glauben, man wird sich durch diese Kompliziertheit, die aus der Kompliziertheit der Wirklichkeit selber herstammt, ohne Mühe hindurchfinden, wenn man immer die beiden Prinzipien festhält, die uns selbst als Leitfaden in unsern Untersuchungen gedient haben. Das erste ist, daß die psychologische Analyse sich immer an dem utilitarischen Charakter unsrer geistigen Funktionen, die wesentlich auf die Tätigkeit gerichtet sind, orientieren muß. Das zweite, daß die im Verlaufe der Tätigkeit gebildeten Gewohnheiten, wenn sie in die Sphäre der Spekulation hinaufsteigen, dort künstliche Probleme schaffen und daß die Metaphysik damit beginnen muß, dieses künstliche Dunkel zu zerstreuen.
Henri Bergson
Über diesen Punkt haben wir uns in einem Aufsatz näher verbreitet: Le paralogisme psycho-physiologique (Revue de Méthaphysique et de Morale, November 1914).
Siehe die Arbeiten von Pierre Marie und das Werk von F. Moutier, L'Aphasie de Broca, Paris 1908 (besonders Kapitel VII). Wir können auf die Einzelheiten der diesbezüglichen Untersuchungen und Kontroversen nicht eingehen. Wir zitieren hier nur den Aufsatz von J. Dagnan-Bouveret, L'Aphasie motrice sous-corticale (Journal de Psychologie normale et pathologique, Januar-Februar 1911).
P. Janet, Les Obsessions et la Psychasthénie, Paris, F. Alcan 1903 (besonders S. 474–502).
I. Von der Auswahl der Bilder bei der Vorstellung. Die Funktion des Leibes
Wir wollen uns einen Augenblick vorstellen, daß wir weder von den Theorien über die Materie, noch von den Theorien über den Geist, noch von den Streitigkeiten über die Realität oder Idealität der Außenwelt irgendetwas wüßten. Da sehe ich mich denn umgeben von Bildern – das Wort im unbestimmtesten Sinne verstanden –, Bildern, die ich wahrnehme, wenn ich meine Sinne öffne, und nicht wahrnehme, wenn ich sie schließe. All diese Bilder stehen mit allen ihren elementaren Bestandteilen in Wechselwirkung, nach konstanten Gesetzen, die wir die Naturgesetze nennen, und da die vollkommene Wissenschaft dieser Gesetze uns zweifellos in den Stand setzen würde, das künftige Geschehen in einem jeden dieser Bilder vorauszusehen und zu berechnen, so muß die Zukunft der Bilder in ihrer Gegenwart enthalten sein und ihr nichts mehr hinzuzufügen haben. Jedoch ist eines unter ihnen, das sich von allen anderen dadurch abhebt, daß ich es nicht nur von außen durch Wahrnehmungen, sondern auch von innen durch Affektionen kenne: mein Leib. Wenn ich nun frage, unter welchen Bedingungen diese Affektionen auftreten, so finde ich, daß sie sich immer zwischen Reizungen, die ich von außen erhalte, und Bewegungen, die ich daraufhin ausführe, einschalten, als ob sie einen gewissen, an sich nicht bestimmten Einfluß auf die endgültige Entscheidung auszuüben berufen wären. Ich mustere die verschiedenen Affektionen, und da scheint mir, daß eine jede in ihrer Art eine Aufforderung zum Handeln enthält, mir aber gleichzeitig die Möglichkeit freistellt, abzuwarten oder auch gar nichts zu tun. Ich sehe näher zu und finde da begonnene, aber nicht ausgeführte Bewegungen, Hinweise auf eine mehr oder weniger nützliche Entscheidung, aber nicht einen Zwang, der die Wahl ausschlösse. Ich wecke und vergleiche meine Erinnerungen und besinne mich, daß ich überall in der organischen Welt diese selbe Fähigkeit der Empfindlichkeit genau in dem Augenblick habe auftauchen sehen, wo die Natur dem Lebewesen die Fähigkeit räumlicher Fortbewegung gegeben hat und nun der Gattung auf dem Wege der Empfindung die ihr drohenden allgemeinen Gefahren anzeigt, es aber übrigens den Individuen anheimstellt, mit Hilfe welcher Maßregeln sie den Gefahren entgehen wollen. Ich frage endlich mein Bewußtsein, welche Funktion es sich bei der Affektion zuschreibt, und es sagt mir, daß es tatsächlich als Gefühl oder Empfindung alle Schritte begleitet, bei denen ich mich als aus eigenem Willen handelnd empfinde, daß es dagegen auslöscht und verschwindet, wenn mein Tun automatisch wird und dadurch seiner entraten zu können erklärt. Entweder also der subjektive Befund trügt oder aber die Tat, in die der Empfindungszustand ausläuft, ist nicht von der Art, daß sie sich aus den vorhergehenden Erscheinungen streng ableiten ließe, wie sich eine Bewegung aus einer anderen Bewegung ableiten läßt; und wenn dem so ist, so tritt mit ihr wirklich etwas Neues in die Welt und ihre Geschichte ein. Halten wir uns doch an den Befund; ich formuliere einfach und schlicht, was ich fühle und sehe: In der Welt der Bilder, die ich das Universum nenne, geht alles so vor sich, als ob etwas wirklich Neues nur durch die Vermittlung gewisser eigentümlicher Bilder entstehen könne, deren Typus mir in meinem Leibe gegeben ist.
Und nun prüfe ich an Körpern, die dem meinen ähnlich sind, die Gestaltung dieses besonderen Bildes, das ich meinen Leib nenne. Da bemerke ich zentripetale Nerven, die den Nervenzentren Reizungen zuleiten, und zentrifugale Nerven, die zentrale Reizungen zur Peripherie leiten und den Körper teilweise oder ganz in Bewegung setzen. Ich befrage den Physiologen und den Psychologen über die Bestimmung dieser beiden Nervenarten. Sie antworten, daß die zentrifugal verlaufenden Prozesse im Nervensystem die Bewegung des Körpers oder einzelner Organe hervorzurufen vermögen, die zentripetal verlaufenden aber, oder wenigstens gewisse von ihnen, die Vorstellung der Außenwelt erzeugen. Wie ist das zu verstehen?
Die zentripetalen Nerven sind Bilder, das Gehirn ist ein Bild, die Reizungen, welche durch die sensorischen Nerven ins Gehirn fortgepflanzt werden, sind wiederum Bilder. Wenn jenes Bild, das ich Gehirnreiz nenne, die äußeren Bilder erzeugen soll, so müßten diese Bilder in irgendeiner Weise in ihm selbst enthalten sein, und die Vorstellung vom Ganzen der materiellen Welt müßte in der Vorstellung vom molekularen Prozesse mit einbegriffen sein. Eine solche Behauptung braucht man aber nur auszusprechen, um sofort ihre Absurdität einzusehen. Nicht die materielle Welt bildet einen Teil des Gehirns, sondern das Gehirn bildet einen Teil der materiellen Welt. Man denke das Bild der materiellen Welt weg; damit vernichtet man zugleich das Gehirn und die Reizung im Gehirn, welche Teile dieser Welt sind. Stellt man sich dagegen vor, diese beiden Bilder, das Gehirn und die Gehirnreizung verschwinden, so sind eben nur sie ausgelöscht, und das ist wenig genug, eine unbedeutende Einzelheit in einem ungeheuren Gemälde. Dieses Gemälde als Ganzes, das Universum, besteht vollständig weiter. Das Gehirn zur Bedingung des Gesamtbildes machen wollen, heißt sich selbst widersprechen, da das Gehirn laut Hypothese ein Teil dieses Bildes ist. Also: weder die Nerven noch die Nervenzentren können das Bild des Universums bedingen.
Bleiben wir bei diesem letzten Punkte. Da sind also die äußeren Bilder, alsdann mein Leib und endlich die Modifikationen, die mein Leib an den ihn umgebenden Bildern bewirkt. Ich verstehe die Art des Einflusses, den die äußeren Bilder auf das Bild, welches ich meinen Leib nenne, ausüben: sie übertragen Bewegung auf ihn. Ebenso verstehe ich den Einfluß meines Leibes auf die äußeren Bilder: er gibt ihnen Bewegung zurück. Mein Leib ist also in der Gesamtheit der materiellen Welt ein Bild, das sich wie die anderen Bilder betätigt: Bewegung aufnimmt und abgibt, mit dem einzigen Unterschiede vielleicht, daß mein Leib bis zu einem gewissen Grade die Wahl zu haben scheint, in welcher Form er das Empfangene zurückgeben will. Aber wie soll mein Leib im allgemeinen und mein Nervensystem im besonderen die Vorstellung des Universums ganz oder teilweise erzeugen können? Man nenne meinen Leib Materie oder man nenne ihn Bild, auf das Wort kommt es mir nicht an. Ist er Materie, dann ist er ein Teil der materiellen Welt und folglich existiert die materielle Welt um ihn und außer ihm. Ist er Bild, dann kann dieses Bild nur das geben, was es darstellt, und da es laut Hypothese nur das Bild meines Leibes ist, wäre es unsinnig, das Bild des ganzen Universums aus ihm auswickeln zu wollen. So ist mein Leib ein Gegenstand, bestimmt, andere Gegenstände zu bewegen, also ein Zentrum von Handlung; er ist nicht imstande, eine Vorstellung zu erzeugen.
Aber wenn mein Leib ein Gegenstand ist, der auf die ihn umgebenden Gegenstände reale und neue Wirkungen ausüben kann, muß er wohl ihnen gegenüber eine bevorzugte Stellung einnehmen. Im allgemeinen beeinflußt jedwedes Bild die anderen Bilder in bestimmter, ja berechenbarer Weise, dem gemäß, was wir die Naturgesetze nennen. Da ihm keine Wahl bleibt, hat es weder nötig seine Umgebung zu erforschen, noch sich vorläufig an bloßen Wirkungsmöglichkeiten zu versuchen. Die Wirkung, die notwendig ist, wird sich ganz von selbst vollziehen, wenn ihre Stunde gekommen ist. Ich habe aber nun angenommen, daß die Funktion des Bildes, das ich meinen Leib nenne, in der Ausübung eines wirklichen Einflusses auf andere Bilder bestehe, was eine Wahl zwischen verschiedenen materiell möglichen Akten voraussetzt. Und da es nun diese Akte nach dem größeren oder geringeren Vorteil, der aus den umgebenden Bildern zu ziehen ist, richten wird, so ist es nötig, daß die Bilder selbst in dem Gesicht, das sie mir zeigen, irgendwie den Vorteil andeuten, den ich aus ihnen ziehen könnte. In der Tat beobachte ich, daß die Größe, die Form, ja selbst die Farbe der äußeren Gegenstände sich verändert, je nachdem sich mein Körper ihnen nähert oder von ihnen entfernt, daß die Intensität der Gerüche, die Stärke der Töne sich mit dem Grade der Entfernung erhöht oder vermindert, kurz, daß diese Entfernung selber das Maß ist, in dem die Dinge der Umwelt gegen die unmittelbare Wirkung meines Leibes sozusagen versichert sind. Je mehr sich mein Horizont erweitert, desto gleichförmiger wird der Hintergrund, von dem sich die Bilder meiner Umgebung abheben, und desto gleichgültiger werden mir diese selbst. Je mehr ich meinen Horizont einenge, um so deutlicher stufen sich mir die Gegenstände ab, je nach der größeren oder geringeren Leichtigkeit, mit der mein Körper sie berühren und bewegen kann. Sie sind also wie ein Spiegel und zeigen meinem Leibe seinen eventuellen Einfluß; sie ordnen sich meinem Körper unter in dem Maße wie seine Macht zu- oder abnimmt. Die Gegenstände, welche meinen Körper umgeben, reflektieren die mögliche Wirkung meines Körpers auf sie.
Ich will jetzt einmal, ohne an die anderen Bilder zu rühren, an dem, was ich meinen Leib nenne, eine kleine Änderung vornehmen. Ich denke mir an diesem Bilde alle zentripetalen Nerven des zerebrospinalen Systems durchgeschnitten. Was wird geschehen? Das Messer hat einige Faserbündel zerschnitten: die übrige Welt und sogar der übrige Leib sind geblieben, was sie waren. Die verursachte Veränderung erscheint also unbedeutend. Tatsächlich aber ist »meine Wahrnehmung« total verschwunden. Sehen wir genauer zu, was eigentlich geschehen ist. Da sind einmal die Bilder, welche die Gesamtheit des Universums ausmachen, dann jene, welche unmittelbar an meinen Leib grenzen, und endlich mein Leib selbst. In diesem letzten Bilde haben die zentripetalen Nerven die spezifische Funktion, Bewegungen auf das Gehirn und das Rückenmark zu übertragen; die zentrifugalen Nerven geben diese Bewegung an die Peripherie zurück. Der Schnitt durch die zentripetalen Nerven kann nur eine einzige wirklich begreifliche Folge haben: er unterbricht den Strom, der von Peripherie zu Peripherie läuft und dabei durch das Zentrum geht; damit nimmt er meinem Körper die Möglichkeit, aus den Dingen, die ihn umgeben, Bewegung von der Art und in der Menge zu schöpfen, wie er sie braucht, um auf die Dinge zu wirken. Also um Wirken handelt es sich und bloß um Wirken. Und doch erlischt meine Wahrnehmung. Was kann das anderes heißen, als daß meine Wahrnehmung die Wirkungsmöglichkeiten meines Körpers in die Gesamtheit der Bilder wie einen Schatten, wie einen Reflex einzeichnet? Nun, das System der Bilder, in dem das Messer nur eine geringe Veränderung bewirkt hat, ist das, was man gemeinhin die materielle Welt nennt; und andererseits ist das, was dabei erlischt, »meine Wahrnehmung« der Materie. Daraus ergeben sich vorläufig die beiden Definitionen: Materie nenne ich die Gesamtheit der Bilder, und Wahrnehmung der Materie diese selben Bilder bezogen auf die mögliche Wirkung eines bestimmten Bildes, meines Leibes.
Vertiefen wir diese letzte Beziehung. Ich betrachte meinen Körper mit den zentripetalen und zentrifugalen Nerven und den Nervenzentren. Ich weiß, daß die äußeren Gegenstände auf die zentripetalen Nerven Reizungen ausüben, die sich zu den Zentren fortpflanzen, daß die Zentren der Schauplatz von sehr mannigfaltigen molekularen Bewegungen sind und daß diese Bewegungen von der Beschaffenheit und der Lage der Gegenstände abhängen. Man ändere die Gegenstände, modifiziere ihre Beziehung zu meinem Körper, und die inneren Bewegungen meiner Wahrnehmungszentren sind durchaus verändert. Aber auch »meine Wahrnehmung« ist völlig verändert. Meine Wahrnehmung ist also Funktion dieser molekularen Bewegungen, sie hängt von ihnen ab. Aber wie hängt sie von ihnen ab? Man antwortet mir vielleicht, daß sie sie einfach übersetzt und daß ich mir letzten Endes nichts anderes vorstelle als die molekularen Bewegungen der Gehirnsubstanz. Aber dieser Satz hätte nicht den geringsten Sinn, da das Bild des Nervensystems und seiner inneren Bewegung, laut Hypothese, nur das eines einzelnen materiellen Gegenstands ist und ich mir doch das Universum in seiner Totalität vorstelle. Man versucht allerdings hier die Schwierigkeit zu umgehen. Man zeigt uns ein Gehirn, das in seinem Wesen dem übrigen Universum gleicht, folglich ein Bild ist, wenn das Universum eines ist. Nun will man ja aber beweisen, daß die inneren Bewegungen dieses Gehirns die Vorstellung der gesamten materiellen Welt – also eines Bildes, das unendlich viel mehr umfaßt als das Bild der Gehirnschwingungen – hervorbringen oder bestimmen: man tut also auf einmal, als sähe man weder in diesen molekularen Bewegungen noch in der Bewegung überhaupt Bilder wie alle anderen, sondern habe in ihnen ein Etwas, das mehr oder weniger als ein Bild, jedenfalls von anderer Art als ein Bild wäre und aus dem die Vorstellung durch ein wahres Wunder hervorginge. Die Materie wird dadurch ein von der Vorstellung radikal Verschiedenes, das folglich für uns nie Bild werden kann; man stellt ihr ein Bewußtsein gegenüber, in dem es gar keine Bilder gibt, was eine mögliche Vorstellung ist; und um dieses Bewußtsein auszufüllen, erfindet man schließlich eine unbegreifliche Wirkung dieser Materie ohne Form auf dieses Denken ohne Materie. In Wirklichkeit aber enthalten die Bewegungen der Materie überhaupt kein Problem, solange man in ihnen Bilder sieht, und es ist kein Grund, in ihnen etwas anderes zu sehen, als was der Augenschein lehrt. Die einzige Schwierigkeit wäre, aus jener einen ganz besonderen Klasse von Bildern die unendliche Mannigfaltigkeit der Vorstellungen abzuleiten; aber warum dieses wollen, da doch nach der Ansicht aller die Gehirnschwingungen einen Teil der materiellen Welt bilden und folglich diese besonderen Bilder nur eine sehr kleine Ecke der Vorstellung sind. Was sind denn nun aber eigentlich diese Bewegungen, und welche Funktion haben diese besonderen Bilder bei der Vorstellung des Ganzen? – Zweifellos verhält es sich so: sie sind Bewegungen im Innern meines Leibes, die die Rückwirkung meines Leibes auf die Wirkung der äußeren Gegenstände in die Wege leiten und derart die erste Phase dieser Rückwirkung darstellen. Da sie selbst Bilder sind, können sie keine Bilder erzeugen; aber sie zeigen jeden Augenblick, wie ein unter der Nadel verschobener Kompaß, die Lage eines bestimmten Bildes, meines Körpers, in bezug auf die umgebenden Bilder an. In der Gesamtvorstellung sind sie von geringer Bedeutung; aber sie sind von größter Wichtigkeit für jenen Teil der Vorstellung, den ich meinen Leib nenne, dessen mögliches Verhalten sie jeden Augenblick in Umrissen festlegen. Es ist also zwischen dem sogenannten Wahrnehmungsvermögen des Gehirnes und den Reflexfunktionen des Rückenmarks nur ein gradueller und durchaus kein wesentlicher Unterschied. Das Rückenmark setzt die empfangenen Reize auf der Stelle in ausgeführte Bewegungen um; das Gehirn verlängert sie erst einmal in bloße Anfangsstadien von Reaktionen, aber in beiden Fällen ist es die Funktion der Nervensubstanz, Bewegungen zu leiten, zu kombinieren oder zu hemmen. Wie kommt es nun, daß »meine Wahrnehmung des Universums« von den inneren Bewegungen der Gehirnsubstanz abzuhängen scheint, daß sie sich verändert, wenn diese sich verändern, daß sie erlischt, wenn diese zerstört werden?
Die Schwierigkeit dieses Problems liegt darin, daß man sich die graue Substanz und ihre Modifikationen als etwas aus sich selbst Existierendes vorstellt, als etwas, das sich von dem übrigen Universum isolieren könnte. Materialisten und Dualisten stimmen im Grunde in diesem Punkte überein. Sie betrachten die fraglichen molekularen Bewegungen der Gehirnsubstanz ganz für sich, und so sehen die einen in unserer bewußten Wahrnehmung eine Phosphoreszenz, welche die Gehirnbewegungen begleitet und ihren Gang beleuchtet; die anderen lassen unsere Wahrnehmungen in einem Bewußtsein vor sich gehen, welches die molekularen Vorgänge der Rindensubstanz beständig in seine eigene Sprache übersetzt: in einem Falle wie im andern aber wird angenommen, daß in der Wahrnehmung Zustände unseres Nervensystems abgebildet oder übersetzt zum Ausdruck gebracht werden. Aber kann das Nervensystem lebend gedacht werden ohne den Organismus, der es ernährt, ohne die Atmosphäre, in welcher der Organismus atmet, ohne die Erde, welche von dieser Atmosphäre umweht wird, ohne die Sonne, um welche die Erde gravitiert? Allgemeiner gesprochen: die Fiktion eines materiellen Gegenstandes, der isoliert für sich bestünde, enthält, kann man sagen, eine Absurdität; denn der Gegenstand verdankt ja seine physikalischen Qualitäten den Relationen, in denen er mit allen anderen Gegenständen steht, und hängt mit allen seinen Bestimmtheiten und somit seiner ganzen Existenz von seinem Platze in der Gesamtheit des Universums ab. Wir können also nicht sagen, daß unsere Wahrnehmungen einfach von den molekularen Bewegungen der Gehirnmasse abhängen. Sondern: sie verändern sich zwar mit ihnen, aber die Bewegungen selbst bleiben unzertrennlich an die übrige materielle Welt gebunden. Also es handelt sich nicht mehr bloß um die Frage, wie unsere Wahrnehmungen mit den Modifikationen der grauen Substanz verknüpft sind; das Problem erweitert sich jetzt und kann nun in viel klareren Begriffen formuliert werden. Da ist einmal ein System von Bildern, das nenne ich meine Wahrnehmung des Universums; in ihm ändert sich alles von Grund auf, wenn sich an einem bevorzugten Bilde, meinem Leib, leichte Veränderungen vollziehen. Dieses Bild befindet sich im Mittelpunkte; nach ihm richten sich alle anderen; bei jeder seiner Bewegungen verändert sich alles, wie wenn man ein Kaleidoskop dreht. Und da sind andererseits dieselben Bilder, aber jedes nur auf sich selbst bezogen; zweifellos einander beeinflussend, aber doch so, daß die Wirkung immer im genauen Verhältnis zur Ursache steht: das nenne ich das Universum, Wie ist es zu erklären, daß diese beiden Systeme nebeneinander bestehen und daß dieselben Bilder im Universum relativ unveränderlich, in der Wahrnehmung dagegen unendlich veränderlich sind? Das Problem, das dem Streit zwischen Realismus und Idealismus, ja vielleicht auch dem zwischen Materialismus und Spiritualismus zugrunde liegt, würden wir also so formulieren: Wie geht es zu, daß dieselben Bilder zu gleicher Zeit zwei verschiedenen Systemen angehören können, einem System, in dem jedes Bild für sich selbst variiert und zwar genau nach Maßgabe der realen Wirkungen, die es von den andern Bildern erfährt, und einem anderen System, in dem alle Bilder für ein einziges variieren und zwar verschieden je nach der Weise, in der sie die virtuelle Wirkung des einen bevorzugten Bildes reflektieren?
Jedes Bild ist für gewisse Bilder innen und für andere außen, aber von der Gesamtheit der Bilder kann man nicht sagen, daß sie in uns, und ebensowenig, daß sie außer uns sei, da ja Innen und Außen nur Beziehungen zwischen Bildern sind. Fragen, ob das Universum nur in unseren Gedanken oder draußen für sich existiere, heißt das Problem in schiefen, wenn nicht überhaupt unverständlichen Begriffen stellen; es heißt, sich zu einer unfruchtbaren Diskussion verdammen, wo die Begriffe Gedanke, Sein, Universum von beiden Seiten notgedrungen in ganz verschiedenem Sinn gebraucht werden. Um den Streit zu Ende zu bringen, muß zuerst einmal ein gemeinsamer Boden gefunden werden, wo der Kampf stattfinden kann, und da beide Parteien darin einig sind, daß wir die Dinge nur in der Form von Bildern erfassen, so müssen wir unser Problem für Bilder, und nur für Bilder, stellen. Nun, keine philosophische Lehre bestreitet, daß dieselben Bilder gleichzeitig in zwei deutlich unterschiedene Systeme eingehen können: in eines, das der Wissenschaft (science) zugehört, wo jedes Bild, nur auf sich selbst bezogen, seinen absoluten Wert behält, und in ein anderes, in die Welt des Bewußtseins (conscience), wo sich alle Bilder nach einem zentralen Bilde, unserem Leibe, richten, von dessen Veränderungen sie abhängen. Die Frage zwischen Realismus und Idealismus wird nun ganz klar: welche Beziehung besteht zwischen diesen beiden Systemen von Bildern? Und es ist leicht zu ersehen, daß der subjektive Idealismus sich dadurch kennzeichnet, daß er das erste System aus dem zweiten herleitet, während der materialistische Realismus das zweite auf das erste zurückführt.
Der Realist geht in der Tat vom Universum aus, d. h. von einer Gesamtheit von Bildern, die in ihren gegenseitigen Beziehungen von unwandelbaren Gesetzen beherrscht werden, nach denen die Wirkungen den Ursachen entsprechen; das Charakteristikum dieses Universums ist, daß es kein Zentrum hat, daß alle Bilder sich in einer und derselben Ebene ins Unendliche aneinanderreihen. Aber der Realist ist gezwungen zu konstatieren, daß es außer diesem Systeme noch Wahrnehmungen gibt, d. h. Systeme, in welchen diese selben Bilder auf ein einziges Bild bezogen sind, sich in verschiedenen Ebenen um dieses gruppieren und sich bei jeder leichten Änderung dieses zentralen Bildes in ihrer Gesamtheit verändern. Von dieser Wahrnehmung geht nun gerade der Idealist aus: in seinem System von Bildern gibt es in der Tat ein bevorzugtes Bild, seinen Leib, und nach dem ordnen sich die anderen Bilder. Aber sobald er die Gegenwart an die Vergangenheit knüpfen und die Zukunft voraussehen will, ist er sofort gezwungen, diesen seinen Ausgangspunkt aufzugeben, alle Bilder wieder in eine Ebene zu verlegen, anzunehmen, daß sie nicht für ihn, sondern für sich selbst variieren, und sie so zu behandeln, als gehörten sie einem Systeme an, wo jede Veränderung gewissermaßen die Größe ihrer Ursache genau mißt. Nur unter dieser Voraussetzung wird die Wissenschaft vom Universum möglich; und da diese Wissenschaft existiert und da es ihr in der Tat gelingt, die Zukunft vorauszusehen, so kann die Hypothese, auf der sie beruht, keine willkürliche sein. Das erste System allein ist in der gegenwärtigen Erfahrung gegeben, an das zweite aber glauben wir, sobald wir die Kontinuität von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft annehmen. So wird sowohl im Idealismus als im Realismus das eine der beiden Systeme gesetzt und dann versucht, das andere daraus abzuleiten.
Aber in dieser Ableitung kann weder der Realismus noch der Idealismus zum Ziele kommen, da keines der beiden Bildersysteme in dem andern enthalten ist und jedes sich selbst genügt. Geht man von jenem Bildersystem ohne Mittelpunkt aus, in dem jedes Element seine absolute Größe und seinen bestimmten Wert hat, dann ist nicht einzusehen, warum dieses System ein zweites hinzuzieht, in dem jedes Bild einen veränderlichen Wert bekommt, der allen Wechselfällen des zentralen Bildes unterworfen ist. So ist man, um die Wahrnehmung entstehen zu lassen, genötigt, einen deus ex machina einzuführen, wie es die materialistische Hypothese vom Bewußtsein als Epiphänomenon tut. Man wählt dann unter all den sich absolut verändernden Bildern, von denen man ausgegangen ist, das eine Bild, das wir unser Gehirn nennen, und verleiht dessen inneren Zuständen das eigentümliche Vorrecht, sich – man weiß zwar nicht wie – durch die (jetzt relative und variable) Reproduktion aller anderen Bilder zu verdoppeln. Zwar wird man sich hinterher den Anschein geben, als legte man gar kein Gewicht auf diese Vorstellung und sähe darin nur eine Phosphoreszenz, welche die Gehirnschwingungen hinterließen; als ob die Gehirnsubstanz, die Gehirnschwingungen, verflochten wie sie sind in die Bilder, aus denen jene Vorstellung besteht, von anderem Wesen sein könnten als diese Bilder selbst! Der Realismus wird also immer aus der Wahrnehmung einen Zufall und damit ein Mysterium machen. Aber geht man umgekehrt von einem System veränderlicher Bilder aus, die um ein bevorzugtes Zentrum gruppiert sind und durch leichte Verschiebungen dieses Zentrums beträchtlich modifiziert werden, dann wird man von vornherein der Ordnung der Natur nicht gerecht, jener Ordnung, der es ganz gleichgültig ist, welchen Standpunkt man einnimmt und an welchem Ende man anfängt. Um dann diese Ordnung überhaupt wieder einzuführen, wird man ebenfalls zu einem deus ex machina greifen müssen, indem man durch eine willkürliche Hypothese irgendeine prästabilierte Harmonie zwischen den Dingen und dem Geiste, oder wenigstens, um mit Kant zu reden, zwischen der Sinnlichkeit und dem Verstand annimmt. Damit wird die Wissenschaft zum Zufall und ihr Erfolg zum Mysterium. – Man kann also weder das erste System der Bilder aus dem zweiten, noch das zweite aus dem ersten ableiten, und wenn die beiden gegensätzlichen Lehren, Realismus und Idealismus, sich endlich auf demselben Boden begegnen, dann stürzen sie beide, von verschiedenen Seiten kommend, an demselben Hindernis.
Wenn wir nun den Grundlagen dieser beiden Lehren nachgraben, so decken wir ein gemeinsames Postulat auf, das sich folgendermaßen formulieren läßt: die Wahrnehmung hat ein rein spekulatives Interesse; sie ist reine Erkenntnis. Und ihr ganzer Streit läuft darauf hinaus, welcher Wert dieser Erkenntnis gegenüber der wissenschaftlichen Erkenntnis zukommt. Die einen bestehen auf der von der Wissenschaft geforderten Ordnung und sehen in der Wahrnehmung nichts als eine verworrene und vorläufige Wissenschaft. Die anderen setzen die Wahrnehmung an die erste Stelle, erheben sie zum Absoluten und halten dann die Wissenschaft für einen symbolischen Ausdruck der Realität. Aber für die einen wie für die anderen bedeutet Wahrnehmen vor allem Erkennen.
Nun, dieses Postulat fechten wir an. Es wird schon durch die oberflächlichste Prüfung der Struktur des Nervensystems im Tierreich widerlegt, und man kann es nicht gelten lassen, ohne das dreifache Problem der Materie, des Bewußtseins und ihres Zusammenhangs hoffnungslos zu verwirren.
Verfolgt man nämlich die Entwicklung der äußeren Wahrnehmung Schritt für Schritt von der Monere an bis zu den höchsten Wirbeltieren, so findet man, daß die lebende Materie schon im Zustand des einfachen Protoplasmaklümpchens reizbar und zusammenziehbar ist, daß sie dem Einfluß äußerer Reize untersteht und mit mechanischen, physikalischen und chemischen Reaktionen auf sie antwortet. Je weiter man in der Reihe der Organismen aufsteigt, desto differenzierter gestaltet sich die physiologische Arbeit. Nervenzellen treten auf, differenzieren sich und zeigen die Tendenz, sich zu Systemen zu vereinigen. Gleichzeitig werden die Bewegungen, mit denen das Lebewesen auf den äußeren Reiz reagiert, mannigfaltiger entwickelt. Aber wenn sich auch der empfangene Reiz nicht mehr sofort in eine ausgeführte Bewegung verlängert, so scheint er doch immer auf eine Gelegenheit dazu zu warten, und derselbe Eindruck, der dem Organismus die Veränderungen der Umgebung übermittelt, bestimmt ihn auch oder disponiert ihn, sich ihnen anzupassen. Bei den höheren Wirbeltieren bildet sich zweifellos ein radikaler Unterschied heraus zwischen dem reinen Automatismus, der seinen Sitz vor allem im Rückenmark hat, und der willkürlichen Tätigkeit, welche der Vermittlung des Gehirns bedarf. Es könnte scheinen, als ob sich der empfangene Eindruck, statt sich wie früher zu Bewegungen auszuwachsen, zur Erkenntnis vergeistigte. Aber man braucht nur die Struktur des Gehirns mit der des Rückenmarks zu vergleichen, um sich zu überzeugen, daß die Funktion des Gehirns und die Reflextätigkeit des Rückenmarksystems nicht in ihrem Wesen, sondern nur in ihrer Kompliziertheit verschieden sind. Denn was geht denn eigentlich bei einer Reflexwirkung vor sich? Die zentripetale, durch den Reiz vermittelte Bewegung wird durch die Vermittlung der Nervenzellen des Rückenmarks sofort in eine zentrifugale Bewegung umgesetzt, die eine Muskelkontraktion hervorruft. Und worin besteht andererseits die Funktion des Gehirnsystems? Statt sich direkt zu den motorischen Zellen des Rückenmarks fortzupflanzen und dem Muskel die jeweils nötige Kontraktion mitzuteilen, steigt die peripherische Reizung erst zum Gehirn auf und läuft dann von da zu jenen motorischen Zellen des Rückenmarks, die schon die Reflexbewegung vermittelten. Was hat sie nun auf diesem Umwege gewonnen und was hat sie in den sogenannten sensorischen Nervenzellen der Hirnrinde zu suchen gehabt? Ich verstehe nicht und werde nie verstehen, daß sie dort die wunderbare Kraft schöpfen soll, sich in eine Vorstellung von Dingen zu verwandeln; ich halte zudem diese Hypothese für unnütz, wie man sofort sehen wird. Dies aber ist mir sehr deutlich: daß die Zellen der verschiedenen sogenannten sensorischen Regionen der Hirnrinde, die zwischen die verästelten Enden der zentripetalen Fasern und die motorischen Zellen der Rolandischen Furche eingeschaltet sind, der Reizung die Möglichkeit geben, diesen oder jenen motorischen Mechanismus des Rückenmarks nach Belieben zu erreichen und so die Art ihrer Wirksamkeit zu wählen. Je mehr solche Zellen zwischengeschaltet sind, je mehr sie solche amöboiden Fortsätze aussenden, die zweifellos fähig sind, verschiedene Verbindungen zu schlagen, desto zahlreicher und verschiedener werden die Bahnen sein, welche sich vor ein und demselben peripherischen Reiz auftun können, desto zahlreicher werden folglich auch die Bewegungskomplexe sein, unter welchen ein und dieselbe Reizung die Wahl läßt. Das Gehirn ist also nach unserer Ansicht nichts anderes als eine Telephonzentrale: seine Aufgabe ist, »die Verbindung herzustellen« – oder aufzuschieben. Es fügt dem, was es empfängt, nichts hinzu; aber da alle Wahrnehmungsorgane mit ihren letzten Enden in ihm münden und alle motorischen Mechanismen des Rückenmarks und des verlängerten Marks ihre befugte Vertretung in ihm haben, so ist es in Wahrheit eine Zentralstelle, wo der peripherische Reiz Anschluß an diesen oder jenen motorischen Mechanismus gewinnt, den er sich jetzt wählt und nicht mehr aufdrängen läßt. Da sich aber in dieser Substanz eine ungeheure Menge motorischer Bahnen auftun können und zwar alle zugleich für ein und denselben peripherischen Reiz, so hat dieser Reiz die Fähigkeit, sich ins Unendliche zu teilen und sich folglich in unzähligen bloßen Ansätzen zu motorischen Reaktionen zu verlieren. Somit ist die Aufgabe des Gehirns, einesteils die aufgenommene Bewegung zum Zwecke der Reaktion dem gewählten Organe zuzuführen, andernteils vor dieser Bewegung die Totalität der motorischen Bahnen aufzutun, damit sie ihnen alle erdenklichen Reaktionen, mit denen sie geladen ist, einzeichnen und sich selbst in dieser Zerstreuung analysieren kann. Mit anderen Worten: das Gehirn erscheint inbezug auf die aufgenommene Bewegung als ein Werkzeug der Analyse und inbezug auf die ausgeführte Bewegung als ein Werkzeug der Auswahl. Aber in dem einen wie dem andern Falle besteht seine Funktion nur in der Vermittlung und Zerteilung von Bewegung. Und in den höheren Zentren der Hirnrinde arbeiten die Nervenzellen ebensowenig wie im Rückenmark mit irgendwelcher Abzweckung auf Erkenntnis, sie zeigen nur entweder eine Menge möglicher Wirkungen auf einmal auf oder bringen eine einzige von ihnen zur Ausführung.
Damit ist gesagt, daß das Nervensystem schlechterdings nichts von einem Apparate hat, der zur Fabrikation, ja auch nur zur Zubereitung von Vorstellungen dienen könnte. Seine Funktion ist, Reize aufzunehmen, motorische Apparate zusammenzusetzen und einem gegebenen Reize die größtmögliche Zahl dieser Apparate zur Verfügung zu stellen. Je mehr es sich entwickelt, desto zahlreichere und fernere Punkte des Raumes setzt es zu seinen immer komplizierter werdenden motorischen Mechanismen in Beziehung: damit vergrößert sich der Spielraum, den es unserer Tätigkeit erschließt, und gerade hierin besteht seine wachsende Vervollkommnung. Aber wenn im Aufstieg des Tierreiches das Nervensystem auf ein allmähliches Freierwerden der Tätigkeit abzielt, muß man da nicht annehmen, daß auch die Wahrnehmung, deren Fortschritt von dem des Nervensystems abhängt, ganz und gar auf Tätigkeit und nicht auf die reine Erkenntnis gerichtet ist? Und wenn dem so ist, sollte dann nicht die wachsende Fülle dieser Wahrnehmung einfach die Versinnbildlichung der wachsenden Indeterminiertheit sein, die dem Lebewesen den Dingen gegenüber eine immer freiere Wahl läßt? Gehen wir also von dieser Indeterminiertheit als dem eigentlichen Prinzip aus. Untersuchen wir, ob sich nicht aus ihr die bewußte Wahrnehmung als möglich oder gar notwendig deduzieren läßt. Mit anderen Worten, setzen wir dieses System engverbundener Bilder, die wir die materielle Welt nennen, und denken wir uns hier und dort in diesem System Zentren wirklicher Tätigkeit, durch die lebende Materie repräsentiert: wir wollen beweisen, daß sich um jedes dieser Zentren Bilder gruppieren müssen, die von seiner Lage abhängen und sich mit ihr verändern; daß sich die bewußte Wahrnehmung ergeben muß, und noch mehr, daß es möglich ist zu begreifen, wie diese Wahrnehmung entsteht.
Beachten wir zunächst, daß ein strenges Gesetz die Weite der bewußten Wahrnehmung an die Stärke der Aktivität bindet, über die das Lebewesen verfügt. Wenn unsere Hypothese begründet ist, dann müssen wir annehmen, daß die Wahrnehmung genau in dem Moment auftritt, in dem ein von der Materie empfangener Reiz sich nicht in eine notwendige Reaktion verlängert. Handelt es sich um einen Organismus niederer Art, so bedarf es allerdings eines unmittelbaren Kontaktes mit dem Reizobjekt, wenn ein Reiz ausgelöst werden soll, und da kann denn die Reaktion nicht gut verzögert werden. So ist bei den niederen Lebewesen der Gefühlssinn passiv und aktiv zugleich; er dient zugleich zum Erkennen und zum Ergreifen des Raubes, zur Empfindung und zur Abwehr der Gefahr. Die verschiedenen Fortsätze der Protozoen, die Ambulakralfüßchen der Echinodermen fungieren sowohl als Bewegungsorgane wie als Organe des Tastsinns; der Nesselapparat der Coelenteraten ist gleichzeitig ein Sinneswerkzeug und eine Verteidigungswaffe. Mit einem Wort: je unmittelbarer die Reaktion sein muß, um so mehr muß die Wahrnehmung einer bloßen Berührung gleichen, und der ganze Vorgang von Wahrnehmung und Reaktion unterscheidet sich dann kaum von einem mechanischen Anstoß mit notwendig darauffolgender Bewegung. Aber je ungewisser die Reaktion wird und je mehr sie ein Abwarten zuläßt, desto mehr nimmt auch die Entfernung zu, in der das Lebewesen die Wirkung des Gegenstandes, der es beschäftigt, empfindet. Durch das Gesicht, durch das Gehör setzt es sich zu einer immer größer werdenden Zahl von Dingen in Beziehung und unterliegt ihren Einflüssen auf immer größere Entfernungen; und ob ihm nun diese Dinge Vorteil versprechen oder Gefahr drohen, gerade weil sie nur versprechen und drohen, ist der kritische Moment hinausgeschoben. Aus dem Grade der Unabhängigkeit, über die ein Lebewesen verfügt, oder, wie wir sagen wollen, aus der Größe der Zone von Indeterminiertheit, die seine Aktivität umgibt, läßt sich a priori auf die Zahl und Entfernung der Dinge, mit denen es in Beziehung steht, schließen. Welcher Art diese Beziehung und die eigentliche Beschaffenheit der Wahrnehmung auch sei, jedenfalls kann behauptet werden, daß die Weite der Wahrnehmung in genauem Verhältnis zur Indeterminiertheit der nachfolgenden Tat steht. Wir können also folgendes Gesetz formulieren: Die Wahrnehmung beherrscht den Raum genau in dem Verhältnis, in dem die Tat die Zeit beherrscht.
Aber warum nimmt diese Beziehung des Organismus zu mehr oder weniger fernen Dingen gerade die Form der bewußten Wahrnehmung an? Wir haben untersucht, was im organischen Körper vor sich geht; wir fanden weitergeführte oder gehemmte Bewegungen, umgesetzt in vollzogene Handlungen oder in bloße Ansätze zu Handlungen zersplittert. Diese Bewegungen gingen, so schien es, einzig und allein die Aktivität an; sie blieben dem Vorstellungsprozesse absolut fremd. Dann betrachteten wir die Aktivität selbst und die Indeterminiertheit, von der sie umgeben ist, eine Indeterminiertheit, die in der Struktur des Nervensystems gegeben ist und auf die dieses System in seiner Einrichtung viel eher abzuzwecken scheint als auf die Vorstellung. Diese Indeterminiertheit einmal als Tatsache angenommen, konnten wir zu dem Schlusse kommen, daß es Wahrnehmungen geben muß, d. h. eine variable Beziehung zwischen dem Lebewesen und den mehr oder minder fernen Einflüssen der Gegenstände, die es beschäftigen. Wie kommt es nun, daß diese Wahrnehmung Bewußtsein ist, und warum geht alles so vor sich, als ob das Bewußtsein aus den inneren Bewegungen der Gehirnsubstanz geboren würde?