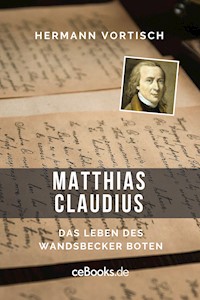
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Folgen Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Biografien bei ceBooks.de
- Sprache: Deutsch
Am 15. August 1740 erblickt Matthias Claudius als viertes Kind eines Pastors in Reinfeld (Holstein) das Licht der Welt. Er beginnt seine Laufbahn als Redakteur der *Hamburger Adreß-Comptoir-Nachrichten*, doch schon bald zieht es ihn nach Wandsbeck, wo er sich 1770 niederlässt. Dort gründet er gemeinsam mit Johann Bode den *Wandsbecker Boten*, mit dem Ziel, das Volk aufzuklären und die Sitten zu verbessern. Trotz namhafter Unterstützer wie Goethe, Klopstock und Lessing bleibt der große finanzielle Erfolg aus, und die Zeitung wird nach wenigen Jahren eingestellt. 1772 heiratet Claudius die 17-jährige Rebekka Behn, mit der er zehn Kinder bekommt. Sein literarisches Schaffen umfasst zahlreiche Erzählungen und Gedichte – unvergessen bleibt vor allem sein *Abendlied* („Der Mond ist aufgegangen“), das bis heute Menschen berührt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 201
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Matthias Claudius
Das Leben des Wandsbecker Boten
Hermann Vortisch
Impressum
© 1. Auflage 2019 ceBooks.de im Folgen Verlag, Langerwehe
Autor: Hermann Vortisch
Cover: Caspar Kaufmann
ISBN: 978-3-95893-216-6
Verlags-Seite: www.folgenverlag.de
Kontakt: [email protected]
Shop: www.ceBooks.de
Dieses eBook darf ausschließlich auf einem Endgerät (Computer, eReader, etc.) des jeweiligen Kunden verwendet werden, der das eBook selbst, im von uns autorisierten eBook-Shop, gekauft hat. Jede Weitergabe an andere Personen entspricht nicht mehr der von uns erlaubten Nutzung, ist strafbar und schadet dem Autor und dem Verlagswesen.
Dank
Herzlichen Dank, dass Sie dieses eBook aus dem Verlag ceBooks.de erworben haben.
Haben Sie Anregungen oder finden Sie einen Fehler, dann schreiben Sie uns bitte.
ceBooks.de, [email protected]
Newsletter
Abonnieren Sie unseren Newsletter und bleiben Sie informiert über:
Neuerscheinungen von ceBooks.de und anderen christlichen Verlagen
Neuigkeiten zu unseren Autoren
Angebote und mehr
http://www.cebooks.de/newsletter
Inhalt
Titelblatt
Impressum
Vom Vorfahren, der in Matthias die Sehnsucht auslöste, ein Glöckner Gottes zu werden
Matthias wird und bleibt ewig Student
Der Eislauf in Kopenhagen
Der Adress-comptoir-nachrichten-schreiber
Wandsbeck, eine Art Romanze
Eine Lenzfeier
Zweifaches Leid, aber dann umso mehr Leben und Lieben
Würklicher-Cammer-Rat in Darmstadt
Lob und Liebe und Lieder im Sommer und Winter
Soviel vom Herbstling
Im Umgang mit Kegeln, Menschen und Sternen
Claudius als Nachkomme von Bileams Esel
Pyrmont und Claudius, zwei Gesundbrunnen
Das letzte Leid und letzte Lied
Unsere Empfehlungen
Vom Vorfahren, der in Matthias die Sehnsucht auslöste, ein Glöckner Gottes zu werden
Der alte Pastor zu Reinfeld, einem holsteinischen Flecken unweit Lübeck, hatte nach der Geburt seines zehnten Kindes – im Juni 1754 – einen besonders guten Tag: er ließ die Unterrichtsstunden an seine drei ältesten Söhne ausfallen und wanderte mit ihnen an den kleinen See hinaus, der vor dem Dorf lag.
Sie lagerten sich in den Schatten etlicher Eichen dicht am Wasser, und der Vater zog ein Heft aus der Tasche.
„Ich habe“, sagte er, „kürzlich das Tagebuch eines unserer Vorfahren, des letzten Pastors Claudius zu Emmerlev, gefunden und es mir, etwas gekürzt und in heutiges Deutsch übertragen, abgeschrieben. Ich will es euch vorlesen.
„Als ich, so lautete die Schrift, das Amt meines seligen Herrn Vaters, des ehrwürdigen Pastors von Emmerlev, nach seinem Hinscheiden überkam, fand ich die Kirche in sehr bedauerlichem Zustand. Sie war im dreißig-jährigen Krieg beschossen und beraubt und seitdem nur so notdürftig ausgebessert worden, dass dann und wann während des Gottesdienstes bei Sturm und Regen Ziegel unter die Pfarrkinder fielen. Die Gemeinde war ja wohl arm; aber ich schämte mich und es betrübte mich, als ich die Kirche wieder aufbauen lassen wollte und kaum ein paar Groschen im Dorf dafür zusammenbrachte und als auch das Stift Ripen, dem wir unterstehen, seinen Säckel zuhielt. Gott sei's geklagt.
Eines Tages nun schickten mir die Leute eine Abordnung in mein Pfarrhaus. Sie fingerten zuerst verlegen an ihren Hüten herum und wussten nicht recht, wie sie ihr Anliegen vorbringen sollten. Endlich stupsten sie den Kantor vor.
„Unsere Weiber“, fing er an, „haben uns … nein, wir alle haben beschlossen und genehmigt, dass Sie sich verheiraten, Herr Pastor!“
„So, so“, sagte ich und verbiss mein Lachen, „so, so, ihr alle habt's beschlossen und genehmigt! Habt ihr mir auch schon eine Frau ausgewählt?“
„Da wollen wir nicht hineinreden. Aber eine Pastorin muss her. Wir sind nicht katholisch. Im Kirchenbuch steht, dass bisher jeder Pastor sich gleich verehelicht hat, wenn er das Emmerlever Amt antrat.“
Mir kam die Sache nicht uneben; denn eine Pastorin hätte ich auch gerne neben mir gehabt und ich wusste auch eine fromme Jungfrau, die ich gern drum angefragt hätte. Aber bevor nicht mein ärmliches Pfarrhaus, in dem nicht mehr ein ganzer Ofen zu finden war, ausgebessert und bevor nicht die Kirche christenmäßig wieder hergestellt wäre, konnte ich nicht daran denken, mich zu verehelichen. Drum sagte ich zu den Leuten:
„Soll ich mich in einer Räuberhöhle, so unsere Kirche gegenwärtig ist, trauen lassen? Ich habe gelobt und geschworen, nicht früher eine Frau heimzuführen, als bis ich ihr wirklich in Kirche und Pfarrhaus ein rechtes Heim bieten kann! Da ihr selber aber keinen Finger dafür rührt, so will ich wenigstens mein Hab und Gut dafür einsetzen. Erst muss das Gotteshaus wieder neu werden, dann kommt das Pfarrhaus an die Reihe und dann zum guten Ende die Pastorin!“
Damit entließ ich sie und stöberte gleich am nächsten Tag in der Kirche herum, alle Schäden aufzudecken und mir zu notieren.
Mein kleines Vermögen an Geld und der Erlös aus dem Verkauf von etlichem altem Familienschmuck, den ich geerbt, ward zusammengetan und zum Baufonds bestimmt, und ich bat Gott, mir die Hände zu füllen, dass ich sein Haus und seine Kirche sowohl äußerlich wie innerlich, in den Herzen der Leute neu aufbauen dürfe.
Doch der Sorgen, des Kummers und der Nöte waren immer viel. Eines Tages stieg ich den Kirchturm hinauf. Die Treppe war so morsch, dass ich mich öfters am Gebälk emporschwingen musste, wenn ich nicht samt hölzerner Stiege in die Tiefe stürzen wollte. Endlich, ganz verstaubt und beschmutzt, erreichte ich die Glockenstube. Sie war leer bis auf eine einzige große Glocke und unzählige Fledermäuse. Ich wollte an den vier Fenstern die mit Schaulöchern versehenen Läden aufmachen, um Luft und Licht hereinzulassen. Aber als ich fest rüttelte, zersplitterten sie und fielen außen am Turm in Trümmern auf den Kirchhof.
Der Blick ging über gesegnete Äcker, Weiden und Wälder, bis ans Meer. Sie Menschen da unten mit all ihrer Mühsal und Sünde schienen so klein, so klein und unbedeutend. Der Himmel darüber aber ohne Grenzen! Ich atmete auf und fühlte mich Gottes Sonne und Gnade viel näher gerückt als unten auf dem Erdboden.
An drei Drehbalken fehlten die Glocken. Die vierte war voll Staub und Fledermausdreck. Immerhin sah ich, dass eine Inschrift vorhanden war, und als ich den ärgsten Schmutz weggekratzt hatte, las ich einen lateinischen Spruch, der sich so verdeutschen lässt:
Mein Name lautet Babette.Ich ruf' zur Vesper und Mette;Mein Kleid ist irdisch, mein Rock aus Erz,Doch himmlisch die Stimme und göttlich das Herz;Drum wahr' ich vor Blitz und Brand das HausTreib Tod und Teufel zum Tempel hinaus.
Während ich wischte und kratzte, ging ein leises, heimliches Tönen durch den Glockenleib, als ob diese liebe alte Babette mit mir Zwiesprache halten und mir erzählen wollte, was sie seit 1483, Luthers Geburtsjahr, erlebt habe. Wie manchmal habe ich sie noch zum stillen Reden mit mir gebracht. Und sie ist mir zum herzlieben Kamerad, ja zur Braut geworden, deren glockenhelles Stimmlein mich hoch erfreute, wie es vom Bräutigam Joh. 3, 29 geschrieben steht.
Da oben gefiel's mir über die Maßen gut. Von hoher Warte die Welt besehen! Fern von irdischem Getümmel! Nahe den Wolken und der Sonne und Gott! Als Türmer hier leben und herabsteigen dann und wann zu den Menschen und ihnen sagen:
„Vom Himmel hoch, da komm ich her Und bring' euch gute, neue Mär.“
„Solch' ein Himmelstürmer und Erdentürmer möchte ich auch einmal werden“, unterbrach Matthias die Vorlesung.
„Ja, Pfarrer sollt ihr Söhne alle werden, wenn ihr mir Freude machen wollt“, entgegnete der Vater und fuhr dann fort vorzulesen:
„Der Spruch der Glocke lockte mich, mit ihr zusammenzuleben. Denn sie versprach ja, nicht nur Blitz und Brand, sondern auch Tod und Teufel verscheuchen zu können. Nun wäre ich schon lange gern des Teufels los gewesen, da er mich oft narrte wie weiland Herrn Luther. Da und dort trat er leibhaftig gegen mich auf und einmal, als er mir nachts in die Sakristei folgte, wo ich für eine Nottaufe das silberne Becken holen wollte, griff er mir an den Talar. Da warf ich ihm die Silberschlüssel ins Gesicht. Aber nach etlichen Tagen störte er mich wieder, als ich über einer Predigt nachsann.
Und dann der Tod! Der geheimnisvolle Bruder aller Lebenden! Er ist mir auch schon begegnet bei mir daheim wie in Häusern und Hütten meiner Pfarrkinder. Schon als Student suchte ich sein Wesen zu ergründen und unverhofft stand er einst an meinem Lager, als ich einmal schwer krank lag. Mit wachen Sinnen verhandelte ich mit ihm. Ich verstand so ziemlich alles, was er mir über sein Wesen und seine Bestimmung auseinandersetzte und ich kam auf du und du mit ihm und betitelte ihn fortan Freund Hein!
Seitdem ich aber eine gewisse Jungfer kennen gelernt und zudem gelobt habe, sie nicht eher heimzuführen, als bis Kirche und Pfarrhaus hochzeitlich aussehen – seitdem scheue ich mich, mit ihm allzu enge Freundschaft zu halten und ihn mir zu nahe kommen zu lassen …
Nun hat diese Glocke versprochen, mir Tod und Teufel vom Halse zu schaffen! Ergo, will ich mich an sie halten und sie zu meiner Lebensgenossin machen, bis ich eine andere lebendige, deren glockenhelles Lachen ich so gerne höre und deren Herz noch viel frömmer ist als das der Glocke, zu mir heimholen darf.
So ließ ich denn vor allem den Turm instand setzen, bewilligte eine neue Treppe und sorgte dafür, dass gute Fensterlein mit Läden an der Glockenstube angebracht wurden. Denn sie sollte mein Türmerheim, mein Studierzimmer und mein Betkämmerlein werden. Ja, ich ließ nicht nur Stuhl und Tisch und Bücher hinaufbringen, sondern sogar ein Feldbett, und zwei Sommer lang wohnte ich da, in der Stille und Höhe, bei Tag und Nacht.
Unruhe vom Stundenschlag hatte ich nicht; denn die Turmuhr hatten die Schweden gründlich verdorben und das ganze Werk war verrostet.
Die Glocke aber habe ich gleich zu Anfang geputzt und gescheuert, so dass ich sie gar als Spiegel meiner selbst benützen konnte und täglich, wenn ich mein Stüblein reinigte, wurde auch ihr Röcklein abgebürstet.
Sie hing dicht neben mir, wenn ich am Tische saß; und wenn ich etwa den Stuhl rückte oder mich stark bewegte, kam ich in Berührung mit ihr und ein leises Singen war die Antwort. Oder ich strich sie zärtlich, wenn ich bei den Menschenkindern unten schwere Schicksale erfahren und mit Sünde und Schmutz in Berührung gekommen war; dann ging ein leises Wallen und Wogen durch ihren Leib. Ein leises sanftes Klingen füllte mein Stübchen und mir war oft, als ob himmlische Heere ein Gloria sängen. Und Teufel und Tod sind mir auch nie in mein Turmzimmer gekommen.
Jetzt ist Winter, wir schreiben den 1. Januar. Ich wohne im Pfarrhaus und friere, denn der neue Ofen, den ich mir einbauen ließ, gibt kaum welche Wärme ab. Draußen schnaubt Schneesturm. O dass bald der Frühling käme und mich die Sonne wieder zum Türmer berufen wollte.
Wenn nur meine liebe Glocke nicht krank wird. Ich meine, nicht von der Seuche, die von Lübeck her übers Land kam und auch in unserm Dorf Einzug hielt. Ich meine, krank und wund von Frost und Eis. Sie tönt nicht mehr seit Weihnachten.
Ich kletterte gestern hinauf, die Stiege war mit Eiskrusten überzogen, so dass ich mehrmals abrutschte und fast ein Bein gebrochen hätte. Oben fand ich vom Sturm die Fenster eingedrückt; die ganze Glocke, sogar der Schwengel, mit Reif überzogen, und als ich sie anstieß und mit ihr plaudern wollte, hörte ich nur ein mattes Wimmern …“
„Hier bricht die Erzählung unseres Vorfahren ab“, erklärte der Vater. „Er hat seine Geschichte nie zu Ende geführt; hat sie Gott wohl einem Nachkommen aufgespart? Etwa dir Matthias, der du in so vielem nach deinem Charakter und nach deinen Idealen jenem Vorfahr gleichst. Die Ahnen geben uns ja mit, was wir haben, und bereiten vor, was sich in uns vollendet.
Vier Tage nachher hat unseren Vorfahr sein geheimnisvoller Freund Hein besucht, ihn an der Hand genommen und nimmer losgelassen.
Und nun geschah noch etwas Wunderbares. Am Begräbnistage sammelten sich natürlich die Leute vom ganzen Dorf, soweit die Seuche sie nicht weggerafft hatte, und viel Volk aus der Nachbarschaft und die Amtsbrüder von nah und fern. Um drei Uhr nachmittags sollte geläutet werden. Man dachte nicht mehr dran, dass die Glocke ja seit Weihnachten ihren Klang verloren, oder man hatte gehofft, dass das Eis in der Glockenstube wieder aufgetaut sei … Die Knaben kamen und ergriffen unten im Turme das kaltstarre Seil – es ließ nicht nach! Alles eingefroren! Die Glocke unbeweglich.
Sie holen Männer zu Hilfe. Zu sechst ziehen und zerren sie. Da plötzlich ein Ruck. Die Männer stürzen zu Boden, in einziger lauter Glockenschlag und dann ein erschütterndes wehes Wimmern … Die Glocke war zersprungen!“
Matthias wird und bleibt ewig Student
Anfang April 1759 zogen zwei frohe Wanderer aus dem Reinfelder Pfarrhaus nach Jena auf die Hochschule: Matthias Claudius und sein älterer Bruder Josias. Sie zielten auf einem Umweg über Plön, wo sie ihrem alten Rektor E. I. Alberti einen Abschiedsbesuch machen wollten, nach Hamburg und hofften dort auf der Elbe Schiffsgelegenheit bis etwa Magdeburg zu finden. Der Abschied von der Mutter war ohne besondere Rührung vor sich gegangen. Der Vater dagegen hatte sie zwei Stunden Weges begleitet und ihnen noch lange, lange nachgeblickt, nachdem er jedem einen Abschiedskuss gegeben und dann ein kleines Büchlein überreicht hatte, worin sie ihre Erlebnisse schreiben sollten und auf dessen ersten Seiten er in Deutsch und Lateinisch gute Ratschläge für ihr Studentenleben aufgezeichnet hatte.
Noch einmal schwenkten die zwei Brüder ihren Hut gegen den Vater, dessen Silhouette sich so eindrücklich auf dem kleinen Hügel vor dem blauen sonnigen Morgenhimmel abhob; dann ging's frisch und frei in die weite, weite Welt und dem schönen Mai des Jahres wie des Lebens entgegen.
Lang genug, schien es ihnen, waren sie beide im Joche gegangen! Erst acht Jahre als Schüler des strengen, gelehrten Vaters, dann vier Jahre auf der Lateinschule in Plön. Übermütig und stolz fühlten sie sich heute, so ganz anders, als wenn sie früher diesen Weg vom Vaterhaus nach Plön unter den Füßen hatten. Es kam ihnen auch vor, als ob die weite Strecke von zehn Stunden sich gekürzt habe, so schnell näherten sie sich ihrem Ziel.
Etwa um drei Uhr hatten sie eine Anhöhe erreicht, von wo sie in Dunst und Nebel die Giebel und Türme von Plön erblickten. Sie machten ein letztes Mal Halt und verzehrten vollends, was ihnen die Mutter als Reisekost mitgegeben hatte. Als sie weiter marschierten, entstand eine merkwürdige Stille unter ihnen. Jeder ging schweigsam, in Gedanken versunken, weiter.
„Was sinnst du so tief?“ unterbrach endlich Matthias die Stille.
„Vielleicht was du sinnst“, entgegnete Josias.
„Das wäre?“
„Was wohl Alberti zu uns sagt und was wir ihm entgegnen wollen, dem gelehrten Huhn!“
„Du hast es getroffen“, lachte Matthias. „Aber er ist kein Huhn, sondern ein streitbarer Hahn! Haben wir nicht noch in letzter Stunde von ihm empfohlen bekommen, richtig und schön in Figuren und Proben zu denken und zu reden und zu schreiben, so wie ein Hahn stetig sein Kikeriki schreit?“
„Ja, gerade das ist es, was mich so schweigsam macht. Ich besinne mich hin und her, wie ich ihm, ganz in seinem Stil, halb um ihm wohlzutun, halb um ihn zu foppen, antworten soll, wenn er uns fragt, was wir in Jena studieren wollen!“
„Hinc illae lacrimae!“1 versetzte Matthias. „Vor allem müssen wir uns mit ein paar lateinischen Sentenzen rüsten. Bildung ohne Latein ist Unbildung, hat er doch einmal behauptet. Für Figuren und Proben lasst nur mich sorgen, sorge du fürs Latein!“
Das Geburtshaus in Reinfeld
„Aber etwas, zum Anfang, muss ich doch auch Deutsch hersagen!“ behauptete Josias.
„Gut“, meinte Matthias. „Ich hab' was für mich und dich. Wenn er mich oder dich ausfragt, was wir studieren wollen, sagt der erste: „Ich will versuchen in den rechten Rockärmel der Stola zu schlüpfen und darüber den Mantel des Philosophen zu stülpen.“ – Der andere ergänzt dann: „Und ich schlüpfe ins linke Hosenbein der Stola und lege mir die Gesetzbinde auf Hand und Stirn!“ – Die Stola war doch das Kleid der Priester im alten Rom, nicht wahr?“
„Ich glaube ja“, sagte etwas zweifelnd der Bruder. „Was soll ich ihm aber als lateinischen Brocken hinwerfen?“
„Nur nichts alltägliches!“ meinte Matthias. „Mindestens etwas aus Horaz! Vielleicht findest du Verwendung für die melancholisch-melodramatische Ode: „Eheu, fugaces Postume, Postume, labuntur anni.“2
Sie erwogen noch dies und das, womit sie den Abschied vom Gymnasium und ihrem Rektor würzen könnten, und ehe sie sich's recht versahen, hatten sie Plön erreicht.
„Wird er wohl noch in Pantoffeln und Schlafrock stecken wie in der letzten Stunde, die er uns gab?“ fragte Josias, als sie die Treppen hochstiegen.
Richtig, als sie läuteten, hörten sie den schlürfenden Schritt des alten unbeweibten Herrn. Er öffnete selbst und stand dann vor ihnen, wie sie ihn vermutet und im Gedächtnis behalten hatten.
Er schien sich sehr über den Besuch seiner Schüler zu freuen und führte sie in sein Zimmer. Endlich nach längerer ungekünstelter und lebhafter Unterredung kam er auch darauf zu sprechen, was seine Schüler nun vorhätten. Matthias begann sein Sprüchlein und Josias vollendete es. Die Mienen des Rektors verfinsterten sich, Form und Inhalt der schönen Sätze waren wohl nicht ganz einwandfrei.
„Meine Herren“, sagte er in etwas spöttischem Tone, „meine Herren, haben Sie wirklich in meiner Geschichtsstunde gelernt, dass die Stola mit Hosen begabt war? – Es freut mich ja, dass Sie in die Stola, das Priestergewand, schlüpfen wollen; aber wissen Sie nicht, dass sie nur dem katholischen Geistlichen zukommt. Und Sie sind doch evangelisch?“
Matthias begriff sofort, welchen Schnitzer er begangen und wollte wieder gut Wetter machen.
„Ach, Herr Rektor, ich habe wohl Stola mit Toga verwechselt?“
Der Zorn des alten Herrn wurde dadurch nur noch größer. „Quos ego!“3 rief er ganz entrüstet. „Ich habe von Euch mehr erwartet! Ihr macht mir Schande! Matthias Claudius, haben Sie wirklich ganz vergessen, dass die Toga kein geistliches Gewand bedeutet, sondern das gewöhnliche Oberkleid der Römer in Friedenszeiten war? Haben wir nicht miteinander im Livius Kapitel 21 gelesen, wie der römische Gesandte vor dem Senat von Karthago seine Toga zusammenbauschte und die Frage tat: bellum aut pacem, Krieg oder Frieden? Wann war das, meine Herren? – 218 v. Chr.!“
„Ihr habt gewiss auch die lateinische Grammatik in Eurem Ränzel vergessen! O tempora, o moros!“4 Ihr habt das fundamentum vitae5 vergessen! … O möchtet ihr dennoch Männer werden! Und nun lebt wohl. Dominus vobiscum!“6
Damit reichte er jedem der Scholaren die Hand und ließ, betrübt über ihre lateinischen und historischen Unkenntnisse, sie zur alma mater abziehen.
*
In Jena fanden die Brüder bald eine freundliche Bude und gewissenhaft besuchten sie ihre theologischen Vorlesungen. Sie hatten Mühe, sich den keilenden Verbindungen zu entziehen. Aber sie wollten vorerst ihre Freiheit brüderlich miteinander auskosten, und nicht einmal ihrer Landsmannschaft, der sonst jeder Holsteiner beitrat, gelang es, die Gebrüder an sich zu fesseln. Ihr Pauken und Saufen, Faulenzen und liederliches Leben stieß sie von vornherein ab. Dagegen waren sie dankbar und froh, einem Kreis anderer Freunde ohne gesellschaftliche Verpflichtungen sich verbinden zu dürfen, der „Deutschen Gesellschaft“, die nur je am Sonnabendnachmittag auf einige Stunden zusammenkam und ähnlich anderen gelehrten Vereinen, wie der später gegründete Hainbund in Göttingen, die Pflege deutscher Sprache und Dichtkunst auf ihre Fahne geschrieben hatte. Mag es auch oft nach dem Geist jener Zeit recht trocken und pedantisch bei diesen Zusammenkünften zugegangen sein, so hat doch wohl Matthias hier die ersten Anregungen zu dichterischen Versuchen bekommen und sich geübt, in logischer, klarer Weise deutsche Aufsätze zu schreiben, Reime zu machen und Reden zu halten. Bald sollte er ja auch Gelegenheit haben, in der Öffentlichkeit sich als würdiges Mitglied der Deutschen Gesellschaft zu beweisen, denn er musste seinem geliebten Bruder Josias die Grabrede halten. Und das kam so.
Es war damals die Zeit des Siebenjährigen Krieges und nicht selten wurde die Stadt von Truppen durchzogen oder bekam den Besuch hoher Herren und berühmter Feldherren. Als es gar hieß, Friedrich der Große werde in Jena absteigen, strömte eine Menge Volk in die Stadt. Friederitus Rex kam dann allerdings nicht – erst zwei Jahre später begrüßte ihn mit hoher Begeisterung die Jenenser Studentschaft – aber dafür hatten die Zulaufenden einen bösen Gast mitgebracht, die Pocken! Die Seuche griff wütend um sich, Alte und Junge wurden hingerafft. Auch Matthias und Josias wurden von ihr ergriffen, während aber Matthias wieder genas, wurde es mit Josias immer schlimmer und am 19. November 1760 trat der Tod ein. Professoren und Studenten nahmen am Leichenzuge teil und draußen am Grabe hatte Matthias dem Bruder und Mitglied der Teutschen Gesellschaft eine philosophisch-religiöse Abschiedsrede zu halten. So vergilbt und verstaubt wie dies Erstlingswerk unseres Dichters noch heute, als Büchlein gedruckt, auf der Universitätsbibliothek zu Jena liegt, so trocken und vernunft-bestaubt war es eigentlich schon damals! Er gab Antwort auf das Thema: „Inwiefern bestimmt Gott den Tod eines Menschen?“
Und er begann seine Grabrede mit den unglaublich profanen Sätzen: „Unser Körper ist ein Gewebe von Kanälen, durch welche gewisse Säfte sich beständig auf eine bestimmte Art bewegen. Wenn diese Bewegungen ganz und gar aufhören, so nennt man den Körper tot! Wir können nach diesen Begriffen die Ursache des Todes überhaupt in zwei Klassen teilen …“ – Und am Schlusse rief er pathetisch: „Woher diese schreckliche Krankheit bei meinem geliebten Bruder? Von eben dem, der ihm den Trieb zum Leben gab? Ferne sei es von uns, dies von dem gütigsten Vater zu glauben. Gott, du bist unschuldig; es war dein Wille nicht. Nein, du bist väterlich gegen mich gestimmt, und wenn es möglich wäre, dass ein Gott weinen könnte, du weintest, ja du weintest eine mitleidige Träne! …
Nun ruhe, ruhe sanft, toter Bruder! Noch oft will ich in der Stunde der Mitternacht bei blassem Mondschein zu deinem Grabe hinschleichen und weinen. Dann lispele dein Geist mir zu, dass du mich noch liebst, so will ich zufrieden sein, dass ich mich deiner süßen Umarmungen erinnere und den künftigen froh entgegensehe.“
Form der Sprache und Ausdruck der Gefühle vortrefflich; das war erlernte Kunst aus der Deutschen Gesellschaft! Inhalt unbedeutend, geschmacklos, gottlos! Daran war sein theologisches Studium schuld!
Als er seine Rede nach etlichen Monaten wieder las, erschrak er selbst, dass der Glaube seines Vaterhauses schon so sehr in die Brüche gegangen war und dass die Vernunft sein religiöses Leben ganz übertüncht hatte. Konnte ihn eigentlich das, was er in den theologischen Fächern zu hören bekam, ihn, der das innerste Verlangen trug, ein rechter Gottesgelehrter und doch auch ein einfältiges Gotteskind zu sein, begeistern? Die orthodoxen Herren waren buchstabenreitende Pharisäer und die liberalen nicht schlechter als geistlose Sadduzäer. Bei beiden ging's langweilig, geist- und gemütlos zu. Sollte er nicht lieber umsatteln und Jurisprudenz nebst Philosophie treiben?
Eines Abends war er allein auf seinem Zimmer und übte mit lauter Stimme eine Predigt, die er im Seminar halten sollte. Da wird es ihm plötzlich übel und er sinkt um. Ein Freund findet ihn ohnmächtig in einer Blutlache. Der herbeigerufene Arzt steht es als eine Lungenblutung an und verordnet mehrwöchige Bettruhe und verbietet alles laute Sprechen!
Schwere Tage! Ein Prediger auf der Kanzel konnte er nie werden! Was war ihm als Beruf bestimmt? Fragen, Antworten, Einwendungen, Überschläge bestürmten ihn, als er so ruhig an das Lager gebannt war. Endlich fand er Trost, als er in einer Morgenandacht an die Geschichte von Johannes dem Täufer kam in Matthäus 11, wo Jesus von ihm rühmend spricht: „Er ist mehr als ein Prophet; denn von ihm steht geschrieben: siehe, ich sende meinen Engel vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll“ und er im nächsten Kapitel über Jesus selbst die Worte fand: „Man wird sein Geschrei nicht hören auf den Gassen.“
Galt das etwa auch ihm und seinem Berufe? Konnte er nicht ein „Prediger in der Wüste“ werden, auch ohne laute Stimme? Muss und kann nur von der Kanzel herab über Gott und Göttliches geredet werden? O, es gibt noch andere Wege, das Volk das Höchste zu lehren und ihm Gott lieb zu machen und es auf rechte Wege zu weisen!





























