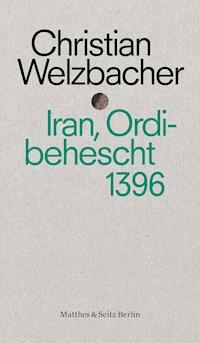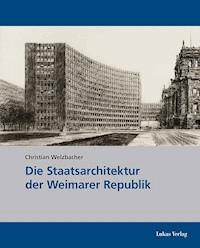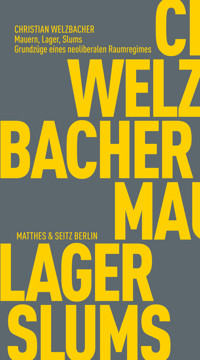
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wo immer man hinblickt – kein anderes Thema hat die politischen Auseinandersetzungen des globalen Nordens in den letzten Jahrzehnten so beherrscht wie Flucht und Migration. Doch anstatt schlüssige Gesetze und Verordnungen zu erlassen und umzusetzen, anstatt sich auf die Würde des Menschen auch über Staatsgrenzen hinweg zu besinnen, werden radikale Forderungen nach Verschärfung des Asylrechts, nach Abschiebung und Abschottung laut, werden stark normierte Strategien der Exklusion, Selektion und »Lagerung« implementiert. Welchen Kalkülen aber folgen Camps, Mauern, Flüchtlingsunterkünfte und Grenzsicherungsanlagen? Wer schlägt Profit daraus? Und vor allem: Wer schafft die Strukturen und Rahmenbedingungen, die den Profit aus dem Umgang mit Geflüchteten ermöglichen? Christian Welzbacher nähert sich mit detektivischem Gespür den Infrastrukturen der Abschreckung, die mit nüchterner Kosten-Nutzen-Rechnung noch die letzten Werte einer kritischen demokratischen Gesellschaft untergraben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 154
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mauern, Lager, Slums.
Grundzüge eines neoliberalen Raumregimes
Fröhliche Wissenschaft 252
Christian Welzbacher
Mauern, Lager, Slums
Grundzüge eines neoliberalen Raumregimes
Inhalt
Politik statt Moral
Provisorien auf Dauer
Gentrifizierung durch Bomben
Transitzonen, Profitzonen
Im Niemandsland
Geheime Vergabe
Ausgelagerte Verantwortung
Freigesetztes Humankapital
Eine eigene Assetklasse
Containerisierung des Bauwesens
Aus der Vogelperspektive
Cordon sanitaire
Moral statt Politik
Anmerkungen
Foto: © Reuters.
Foto: © AFP.
Foto: © Getty Images.
Foto: © Doğan News Agency.
Foto: © EPA.
2. September 2015, unweit von Bodrum, Türkei.
Ein kleiner Junge, rotes Shirt, blaue Hose. Bäuchlings liegend am Gestade.
Sand. Himmel.
Wellen.
Politik statt Moral
Bis weit in die 1960er-Jahre hinein waren die Vororte großer europäischer Städte von sozialem Elend geprägt. Die Bidonvilles und Borgate, die Nissenhütten und Slums standen in eigenartigem Kontrast zum wirtschaftlichen Aufschwung der Nachkriegszeit.1 Sie hielten sich hartnäckig, wurden stets umgemodelt, erneuert und erweitert, und während manch ein Bewohner mit seiner Familie aus den Armenquartieren wegzog, weil er durch Fleiß, Geschick und gute Kontakte Aussicht auf kleinbürgerliches Glück mit festem Einkommen und dauerhafter Bleibe bekam, rückten neue Menschen nach, einstige Landarbeiter, Kriegsheimkehrer, Vertriebene. Mittlerweile lief der Siedlungsbau auf Hochtouren. Überall Newtowns, Banlieues und Trabantenstädte, in gigantischem Ausmaß wuchsen die Blocks, Punkt- und Scheibenhochhäuser des sozialen Wohnungsbaus in die Höhe.2
Hoffnung, Enttäuschung und Betrug sind die großen Themen rund um den erhofften sozialen Aufstieg der Slumbewohner. Der italienische Regisseur Federico Fellini griff sie in seinem 1955 entstandenen Film noir Il bidone (Die Schwindler) auf. Die titelgebenden Kriminellen suchen eine Gruppe von Bewohnern improvisierter Notunterkünfte am Rand von Rom auf und verkünden ihnen großspurig, im Auftrag der städtischen Wohnungsbehörde Vorverträge für bald fertiggestellte Neubauwohnungen mitgebracht zu haben: Diese müssten nur unterschrieben werden, freilich verbunden mit der sofortigen Anzahlung einer ersten Monatsmiete.3 Statt den Betrügern auf den Zahn zu fühlen, überschlagen sich die Subproletarier regelrecht, das Geld einzuhändigen. Einige müssen erst improvisieren, bitten die Nachbarn um Vorschuss, um bald aus dem Elend herauszukommen, in das sie sich verstoßen fühlen. Die Sequenz endet damit, dass die Hasardeure nach ihrem Beutezug in die Dancehall fahren, um das erbeutete Geld in Schaumwein umzusetzen.
Zurückblickend auf meine Kindheit in den westdeutschen 1970er-Jahren kann ich mich erinnern, dass nicht alle Menschen darauf erpicht waren, das wilde Leben am Rande der wellblechernen Illegalität aufzugeben. Offiziell war dauerhaftes Residieren in einem Schrebergarten verboten. Doch während wir gut behüteten Kinder in einer biederen Reihenhaussiedlung in Offenbach aufwuchsen, lernten wir einen Mann kennen, der unweit unserer Wohnstraße genau dies tat. Warum es eigentlich dazu gekommen war, haben wir uns nie zu fragen getraut. Aber dass es so war, wussten wir von seinem mit uns etwa gleichaltrigen Enkel, der uns den Zugang in das improvisierte Refugium aus Paletten, Eisenrosten, Ytongsteinen und Bauabfällen eröffnete und uns an kläffenden Schäferhunden vorbei ins Innere der verrauchten Hütte lotste. Der Mann selbst zog regelmäßig durch die Offenbacher Vororte. Er sammelte Treibgut vom Straßenrand auf, kaufte und verkaufte Wertstoffe, Altmetall, Mobiliar und konnte als »Schrottler« wohl einigermaßen leben. Ein kleinbürgerliches Dasein mit festen Arbeitszeiten, Ratenkredit und Neckermann-Urlaub konnten wir Kinder uns bei dieser Type von Mensch unmöglich vorstellen: Mit seinem tabakgelben Schnurrbart, dem schmutzig weißen Cowboyhut und dem immer verwegenen Grinsen in seinem von feinen Falten zerfurchten Gesicht war er für uns der Inbegriff eines freien, unabhängigen Mannes, der sich nicht von allzu wohlfeilen Verlockungen des Konsums irritieren ließ. Er war so etwas wie ein Aussteiger. Freilich ohne je eingestiegen zu sein.
Während all der Jahre, die der Mann dank routinierter Unauffälligkeit von den Behörden unbehelligt blieb, spielte sich ein paar Kilometer weiter ein soziales Drama ab. Abseits des Bieberer Berges, auf dem der Offenbacher Fußballclub »Kickers« legendäre Erfolge feiern sollte, um bald darauf wieder vergessen zu werden, hatte um 1900 ein lokaler Kaufmann Land erworben, auf dem er Kleinstwohnungen nach dem Modell der Gartenstadtbewegung errichten wollte: winzige Häuschen für die unterste Mittelschicht, deren Gärten der Selbstversorgung dienen sollten.4 Nachdem er das Projekt aufgegeben und das Terrain mit dem merkwürdigen Namen »Marioth Gelände« an die Stadt verkauft hatte, siedelten auf dem aufgelassenen Baugrund obdachlose Familien. Straßen gab es keine, Wasseranschluss und Strom fehlten. Aber es gelang den Menschen, ausrangierte Waggons vom nahegelegenen Güterbahnhof hierherzubringen, darin sie ihre Wohnungen einrichteten.
»Waggonhausen« überlebte die Weimarer Republik, das Dritte Reich, den Zweiten Weltkrieg und das Wirtschaftswunder – und wuchs stetig. In den 1960er-Jahren galt der nunmehr in »Lohwald« umbenannte Bereich irgendwo zwischen Gleisanlagen, Stadtwalddickicht und Schnellstraße als No-go-Area mit hoher Kriminalitätsrate. Das Problem verschärfte sich, als die Stadt Offenbach Ende des Jahrzehnts die zentrale Obdachlosenunterkunft dorthin verlegte. Zwar wurden in den 1970er-Jahren die Waggons fortgeschafft, Straßen angelegt und feste Behausungen errichtet, die zumindest Minimalstandard aufwiesen. Aber das soziale Problem blieb, da man die Menschen weiterhin perspektivlos zurückließ.
Fast vier Generationen lang existierte der Offenbacher Slum, zuletzt aufgrund regelmäßiger Brandstiftungen, Schießereien und Prostitution permanent bewacht durch eine eigene Außenstelle der Polizei. Ende der 1990er-Jahre beschloss der Magistrat, das Gelände räumen zu lassen. Aber noch 2002, ein Jahr vor dem Abriss, lebten hier rund 1500 Siedler. Danach rückten die Bagger an. Ich kann mich gut erinnern, welch verstörenden Eindruck das bereinigte Terrain hinterließ: Die Straßen, ja selbst Verkehrsschilder waren noch vorhanden, aber wo die Häuser gestanden hatten, regierte das Nichts. Aus den Ritzen krauchte Unkraut. Die Luft stand, die Stille war, als würde jeden Moment eine Horde Wilder aus dem Dickicht ringsum hervorbrechen, um den Ort in Piratenmanier neu zu besetzen. Lohwald sah jetzt aus wie Pompeji. Nur dass die Touristen fehlten, um sich dieses Monument des Scheiterns europäischer Sozial- und Wohnungspolitik anzusehen. Der Geist des Ortes jedenfalls war lebendig und suchte neue Betätigungsfelder. So kam es mir zumindest vor.
Den vorliegenden Essay habe ich nicht aus Sentimentalität geschrieben. Während meiner Recherchen über Mauern, Lager und Slums aber erinnerte ich mich an meine merkwürdigen Kindheitsbegegnungen mit »informellen Strukturen« – Strukturen, die es in einem juristisch durchregulierten und engmaschig verwalteten System wie dem unseren offiziell gar nicht geben kann, nicht geben darf. Wahrscheinlich war es dieses »Jenseitige«, das uns Heranwachsende magisch anzog: das Verwegene des Unerklärlichen, das Fantomhafte. Und natürlich der Reiz des Verbotenen. So war bald einem meiner Kumpel von seinen Eltern untersagt worden, die Hütte des Schrottlers aufzusuchen, was die Attraktivität noch weiter steigerte. »Marioth«, von uns aus jenseits einer gefährlichen Hauptverkehrsstraße gelegen, war ohnehin tabu. Offiziell zumindest. Denn es bestand natürlich keinerlei Zwang, den Eltern jeden unserer Ausflüge minutiös zu rapportieren.
Mauern, Lager, Slums ist aus einem anderen Impuls entstanden, der seinen Ursprung in der Berichterstattung über den Krieg in Syrien und die sich anschließenden Flüchtlingsbewegungen hat. Mich interessierten weniger die gelenkten Narrative von Politik und politischer Berichterstattung, die systematische Instrumentalisierung von Fotografien und Videos, die fliehende, ertrunkene, wandernde, ankommende Menschen zeigten. Die Medien legten den Fokus auf die Flucht, als handele es sich um eine moderne Neuauflage mittelalterlicher Aventure oder um ein Wirklichkeit gewordenes Roadmovie; die Schwundstufe dieser Perspektive trieben dann Filme wie Io Capitano von Matteo Garrone ins Extrem. Natürlich hat mich diese Form der unterhaltsamen Ausbeutung von Migration befremdet. Aber weit relevanter war es für mich, zu erfahren, was mit den Flüchtlingen passiert, wenn sie in die bürokratische Maschinerie der Ankunftsstaaten eingespannt werden. Auf was für einen »Apparat« treffen sie bei uns? Wie werden sie von diesem Apparat »verarbeitet«? Was sagt dieser angesichts globaler Flüchtlingsbewegungen immer weiter angepasste Apparat über die »Ankunftsgesellschaft« des sogenannten Globalen Nordens aus?
In Ergänzung zu den gleichzeitig geführten soziologischen, planerischen und ethischen Debatten wollte ich versuchen, aus einem veränderten Blickwinkel auf Phänomene wie Flucht, Illegalität, Migration, Obdachlosigkeit zu schauen, indem ich exemplarisch deren »Verwaltung« in den Blick nehme. Das brachte mich zur Sozial- und Raumplanung, denn offensichtlich reagieren westliche Staaten auf Massenzuwanderung – wie schon nach dem Zweiten Weltkrieg – restriktiv, angstgetrieben und abweisend, implementieren stark normierte Strategien der Exklusion, Selektion und »Lagerung«. Dies wiederum erfordert Infrastrukturen, deren einprägsamste Form selbstverständlich die Flüchtlingsunterkunft darstellt. Eine dieser Einrichtungen, für die frühere Generationen durchaus das Wort »Konzentrationslager« verwendet hätten, ist 2016/17 unweit meiner eigenen Wohnung entstanden. Neben aller Irritation über die Zustände, in denen Menschen dort leben müssen, weil ihnen die wirtschaftliche, soziale und edukative Teilhabe an der Mehrheitsgesellschaft verwehrt wird, drängte sich mir eine weitere Frage nach dem bewährten Prinzip »Follow the Money« auf: Wer profitiert von der Art und Weise, wie unsere Gesellschaft mit den Erniedrigten und Beleidigten dieser Erde umgeht?
Da die Behausungen der Unbehausten nicht von ihnen selbst, sondern von anderen gebaut und zur Verfügung gestellt werden, wollte ich mir also die »Immobilien« der Besitzlosen anschauen, um mehr zu verstehen. Ich stellte fest, dass die Staaten, Länder und Kommunen kaum mehr selbst als Bauherren agieren. Um geltende Rechtsverordnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen durchzusetzen, wenden sich die Verwaltungen mithilfe des Ausschreibungs- und Vergaberechts an private Projektentwickler: Diese bauen und managen Auffanglager in Krisengebieten, errichten Asylunterkünfte in den Ländern, in die die Schutzbedürftigen flüchten, planen Abschreckungsanlagen wie Mauern und Zäune an Grenzen, um die weltweiten Migrationsströme zu kanalisieren, zu stauen, umzuleiten. Hinter den Infrastrukturen der Abschreckung, die am Übergang zwischen den »Welten« – der »Ersten« und der »Dritten Welt« – existieren, stehen professionelle Geschäftsleute. Sie betrachten das Problem als Dienstleister, aus nüchterner Kosten-Nutzen-Perspektive, wie anderswo den Bau einer Einfamilienhaussiedlung, einer Shoppingmall, eines Bürokomplexes oder eines Autobahnkreuzes.
Angesichts der Heftigkeit, mit der die »Erste Welt« auf das globale Flüchtlingsproblem reagiert hat, fasziniert mich dieser nüchterne Pragmatismus, weil er jenseits aller moralischen Skrupel das offenbart, was man einen Riecher fürs Geschäft nennen könnte. Offenbar sind hier die richtigen Leute zur richtigen Zeit am richtigen Ort, halten richtige Lösungen für aufgelaufene Probleme bereit und bekommen von anderen richtigen Leuten lukrative Aufträge. Was die Sache unschön macht, ist die Tatsache, dass hier eine Notsituation ausgenutzt wird, und zwar nicht nur in Bezug auf den handelnden Staat, sondern auch in Bezug auf die betroffenen Menschen. Wie bei den sogenannten Maskendeals hat das Geschäft mit den Flüchtlingen wenig mit menschlichen, humanitären Impulsen zu tun: Die meisten Berichte über die Infrastrukturen der Abschreckung, die meinen Recherchen zugrunde liegen, zeugen entweder von Kalkül und Berechnung oder dokumentieren Skandale: Überteuerung, Erpressung, Verwahrlosung, Outsourcing, Steueroptimierung, Briefkastenfirmen, organisierte Verantwortungslosigkeit, politische Geheimhaltung sind ständig wiederkehrende Themen.
Mauern, Lager, Slums ist als Folge von thematischen Essays aufgebaut, die sich beispielhaft den Infrastrukturen der Abschreckung annähern. Dabei folge ich der Fluchtbewegung nach Europa oder in die USA von deren Ursachen im Herkunftsland der Menschen über den langen Weg durch die Fremde bis zum erhofften Ziel. Es geht um Besatzungspolitik und »Krieg gegen den Terror«, um Camps und Sicherungsanlagen an den Außengrenzen Europas und der USA, um Flüchtlingsunterkünfte im Inland oder um Praktiken der »Integration«. Der Text präsentiert Bruchstücke eines Kaleidoskops, dem weitere Facetten hinzugefügt werden müssen, um eine schlüssige Antwort auf die zentrale Frage hinter den hier verhandelten Phänomenen zu finden: Wer schafft die Strukturen und Rahmenbedingungen, die ermöglichen, mit geflüchteten Menschen Profit zu machen?
Die naheliegende Antwort ist sicherlich: »die Politik«. Doch wenn dem so ist, warum löst »die Politik« das vermeintliche Problem nicht, indem sie schlüssige Gesetze und Verordnungen erlässt und umsetzt – im Interesse der Flüchtlinge und damit auch im Interesse der Mehrheitsbevölkerung in den Ankunftsländern? Statt angeblichen Verschwörungsnarrativen zu folgen, habe ich mich bei der Suche nach einer Erklärung ausschließlich auf Material gestützt, das jedermann zugänglich ist: Quellen der politischen Parteien und Institutionen, der Hilfsorganisationen, der universitären Forschung, der statistischen Erhebungen, der Rüstungs- und Bauunternehmen, der Investoren oder der beteiligten Planer. Gleichzeitig zeigte sich, dass gerade »Mainstream-Medien« immer wieder gut recherchierte, kritische Berichte veröffentlicht haben, die in ihrer Gesamtheit den unmissverständlichen Eindruck vermitteln, dass Staaten, Parteien und Verwaltungen mithilfe ihrer Outsourcing-Strategien an die private Planungs- und Bauwirtschaft das »Flüchtlingsproblem« dauerhaft am Köcheln halten, just um die Gruppe der Profiteure zu begünstigen. Systematisch? Das wird nicht deutlich und ist auch nie untersucht worden. Aber die großen europäischen Zeitungen und Zeitschriften erwähnen immer wieder, dass etwa private Geschäftsleute in Sachen »Flüchtlingsdeals« über gute Kontakte in die Politik verfügen.
Bringen wir zunächst noch einmal die politische Dimension des Themas Flucht und Migration in Erinnerung: In den letzten 25 Jahren hat es sich in sämtlichen Ländern des Globalen Nordens zur Kernfrage der innen- wie außenpolitischen Auseinandersetzung entwickelt.5 Das große Potenzial lag dabei offenbar in der Möglichkeit, das Thema jenseits aller Fakten, Zahlen6 und realen Zusammenhänge von Ursache und Wirkung emotional aufzuladen und entsprechend im politischen Diskurs zu bespielen. Die Folgen sind evident. Wo im Rahmen neoliberaler Wirtschaftspolitik autokratische Denk- und Handlungsmuster nicht bereits zur Staatsräson avanciert sind, wie in den USA, in Ungarn, Italien, den Niederlanden, der Türkei und schon sehr früh in Österreich, gerieten die sogenannten bürgerlichen Parteien durch den rechtspopulistischen Druck innerhalb und außerhalb der Parlamente in Zugzwang. Sie setzten nun ihrerseits die radikalen Forderungen nach einer Abschottungspolitik um und entwickelten dabei eine Dynamik, die sich nicht nur rhetorisch, sondern auch in symbolischen und realen Handlungen gegenüber geflüchteten Menschen immer weiter steigerte, bis hin zur totalen Verweigerung, ein Asylrecht überhaupt anzuerkennen.
In Artikel 16a Absatz 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland wird mit dem allgemeinen Satz »Politisch Verfolgte genießen Asylrecht« auf die rechtliche Möglichkeit für den Schutz vor Verfolgung hingewiesen. Die Formulierung aus dem Jahr 1949 ist vom Geist einer Vorstellung von allgemeinen Menschen- und Völkerrechten durchdrungen, die das hehre Ziel einer Erde als Habitat von freien und gleichen Bürgern verfolgt, deren Würde über staatliche Grenzziehungen hinwegreicht. Doch »in Fragen der Ethik empfiehlt sich größte Wachsamkeit; man möchte erlebt haben, wie sie funktioniert, wenn sie auf die Probe gestellt wird«, wusste der Psychologe Alexander Mitscherlich schon 1965.7 So haben die deutschen Bundesregierungen mit Zustimmung der jeweiligen Parlamente und der Bundesräte allein zwischen 2014 und 2019 das Asylrecht rund achtmal verschärft.8 Die bis 2025 amtierende Ampelkoalition nahm weitere Anpassungen vor. In den Niederlanden stürzte das vierte Kabinett von Premierminister Mark Rutte 2023 über die Einwanderungsfrage. Die 2024 ins Amt gewählte konservativ-nationalistische Regierung unter dem Rechtspopulisten Geert Wilders hat das Thema Asyl an die erste Stelle der politischen Agenda gesetzt und versuchte zu seiner Lösung nicht nur den Ausnahmezustand auszurufen, sondern auch aus den geltenden Regelungen der EU auszusteigen.9
In Großbritannien bestimmen Asyldebatten seit Jahren die Politik, auch und gerade im Zusammenhang mit dem »Brexit« genannten Austritt aus der Europäischen Union. Nach dem faschistisch regierten Italien und seiner 2023 durch Premierministerin Giorgia Meloni lancierten »Albanien-Lösung« war Großbritannien das zweite europäische Land, das die bürokratische Abwicklung von Flüchtlingsfragen in eine Exklave außerhalb der EU oder gar des Kontinents auslagern wollte. Die heiß umkämpfte »Ruanda-Lösung« des britischen Premierministers Rishi Sunak fand Anfang 2024 eine Mehrheit im Unterhaus. Nach Sunaks Abwahl setzte der neue Premier Keir Starmer die Regelung aus – um erneut massive Ausweisungen von »illegalen« Migranten und die Reaktivierung von »Abschiebezentren« genannten Lagern anzukündigen.10 Die französische Regierung unter Präsident Emmanuel Macron verschärfte im Dezember 2022 mit Unterstützung rechtsextremer Kräfte des Rassemblement National das Einwanderungsrecht – aus taktischen Erwägungen, um genau jene Kräfte politisch zu schwächen. In Dänemark, dessen »Hygge«-Kultur gerne als eleganter Wohlfühl-Lifestyle gefeiert wird, lancierte die Regierung 2024 einen »Ghettoplan«,11 um Ausländer systematisch aus sozial prekären Wohngebieten zu vertreiben und in Lagern zu konzentrieren. Von hier aus sollen sie ausgewiesen werden.
Bei all diesen teilweise dramatisch und medienwirksam inszenierten »Entscheidungskämpfen« geht es allerdings nicht um die Flüchtlinge selbst. Es geht um politischen Einfluss. Flüchtlinge werden als Mittel zum Zweck benutzt, ideologische Grabenkämpfe auszutragen, die mediale Aufmerksamkeit und Wählerstimmen versprechen. Sie sind ein ungemein wertvolles »Kapital«, mit dem die Politik Machtfragen aushandelt. Das mag auch ein Grund dafür sein, dass sich 2015/16 die Regierungen der EU-Staaten auf europäischer Ebene in Auseinandersetzungen über die Verantwortung der Einzelstaaten für die Aufnahme von Menschen und die Bearbeitung von Asylanträgen verhakten, die im sogenannten Dublin-Abkommen12 zwar geregelt, in der Praxis aber nicht umgesetzt oder absichtlich unterlaufen werden. Trotz zahlreicher Krisengipfel gelang keine tragfähige Einigung. Die Frage wurde vertagt, sie ist bis heute ungelöst – und der darin schlummernde Sprengstoff, das politische Kapital, ist nicht entschärft. Und wie wir in der täglichen Berichterstattung sehen, wird er immer wieder neu aktiviert.13 Selbst wenn man nicht in jedem Fall gleich Absicht oder diabolische Strategie vermuten muss, wäre es naiv, anzunehmen, dass den Politikern in Washington, Brüssel und vielen Hauptstädten der »Ersten Welt« die machiavellistisch-pragmatische Scheidung von politischem Kalkül und moralischer Verantwortung unbekannt wäre. Ihr tatsächliches Handeln (oder Nichthandeln) hat freilich Folgen für die Wahrnehmung ihrer Tätigkeit insgesamt, denn es ist evident, dass die politischen Institutionen in der Flüchtlingsfrage »europäische Werte« verteidigt haben, indem sie sie preisgaben.14
Liest man im 1964 herausgegebenen Sammelband Die politische Verantwortung der Nichtpolitiker, so stellt man verblüfft fest, dass die vermeintlich neuartigen Erosionsprozesse geradezu eine Tradition haben. Korruption, Machtspielchen, Abgehobenheit gehörten bereits in den Jahren der »Spiegel-Affäre« zum Alltag der Bonner Republik. Entsprechend ausgeprägt war der Verdruss der Bürger, dem die Autoren des Buchs entgegenwirken wollten. Ihre Themenwahl wirkt noch heute frisch und aktuell: Welche Mitverantwortung am Verfall der politischen Kultur muss den Medien zugeschrieben werden? Braucht Politik einen anderen »Stil« als den herrschenden? Müsste sie generell zu erlernen sein beziehungsweise erlernt werden müssen? Welche moralischen Doppelstandards gelten hier? Welches Verhältnis besteht tatsächlich zwischen der Meinung der Bürger und den Entscheidungen der Politiker? Erschöpft sich Demokratie darin, das Wahlvolk alle paar Jahre an die Urnen zu bitten, um eine Partei zu wählen? Wie stark ist einerseits die Macht der Lobby, andererseits die der Experten, und was kann unternommen werden, um dies transparent zu machen? Können außerparlamentarische Organisationen der Bürger innerparlamentarische Prozesse verändern, und wenn ja, wie? Den Abschluss des Bandes bildete Hannah Arendts legendärer Vortrag »Wahrheit und Politik«. In ihm wird bekanntermaßen denn auch zuvörderst von der Lüge gesprochen.
Offenbar stellt jede Generation für sich fest, dass Systeme, die sich Demokratie nennen, nicht unbedingt ein »Volk« benötigen. Abseits der Eigendynamiken des Machtkalküls kämpfen die Staatsbürger dann mit den Folgen der moralischen Verwerfungen, die auch sie betreffen. Das mag bei staatsrechtlichen Grundsatzfragen anfangen, die bereits Wilhelm von Humboldt umtrieben,15 über die leicht auf Asylfragen anwendbare Doppelfeststellung »Freiheit bedarf der Sicherheit. […] Sicherheit kostet Freiheit«16 und weiter bis hin zum wirtschafts- oder kulturpolitischen Umgang mit Flüchtlingen führen, wie wir ihn heute überall sehen: Was leistet Politik? Welchen Stellenwert hat die Moral? Und: Wer ist in diesem ganzen Spiel eigentlich zynisch?