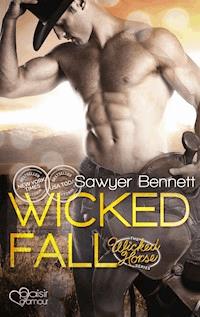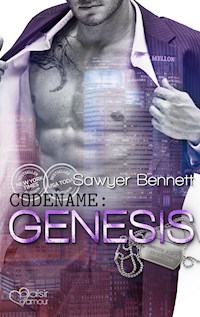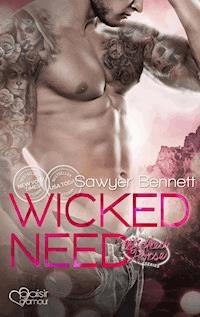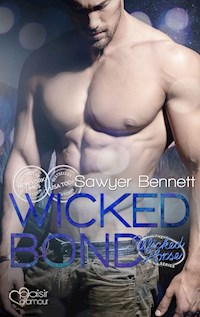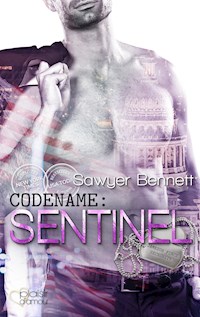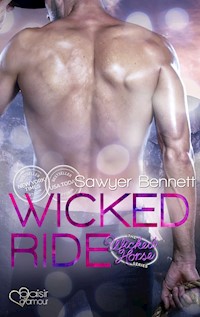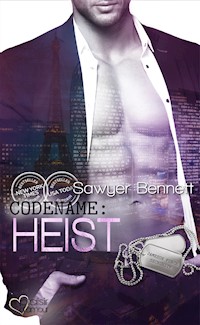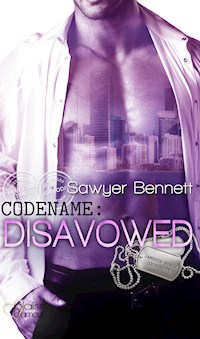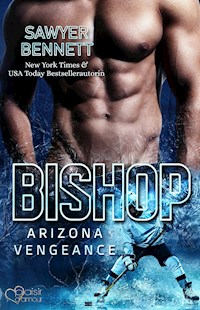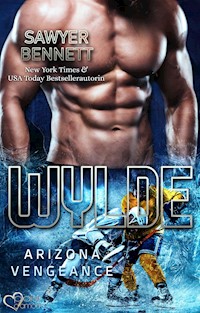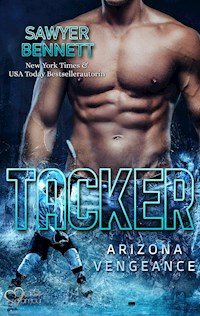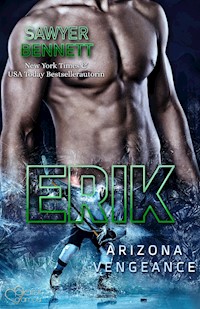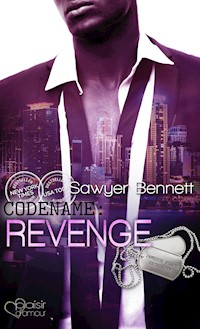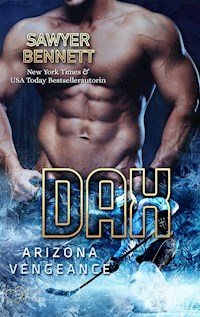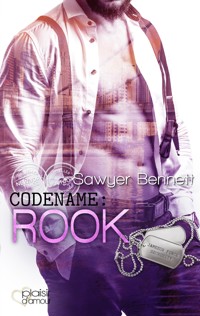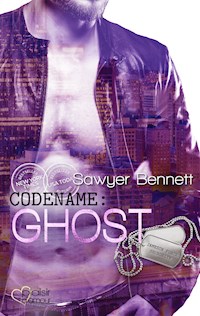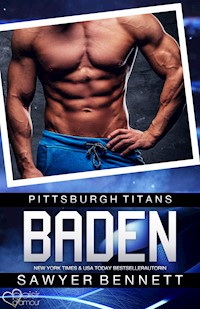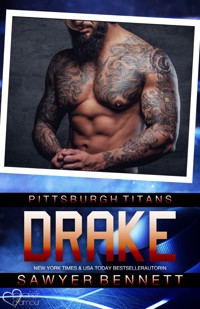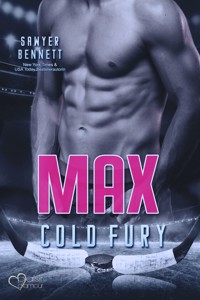
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Plaisir d'Amour Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Carolina Cold Fury
- Sprache: Deutsch
Der neue Star der Carolina Cold Fury zeigt seinen Bad Boy-Teamkameraden, dass auch nette Jungs ganz groß rauskommen können. Das Eis ist eine kalte Geliebte. Als dem begehrtesten Goalie der Liga steht Max Fournier eine ganze Schar williger Puckbunnies zur Verfügung. Aber im Moment interessiert ihn statt One-Night-Stands nur der nächste Meistertitel. Max ist im Grunde seines Herzens ein Romantiker und glaubt an die große Liebe, er ist nur nicht gut in Beziehungen. Als er endlich ein nettes Mädchen kennenlernt, das nicht von seiner Berühmtheit geblendet ist, spürt er das Prickeln zwischen ihnen - und den Wunsch, dieses nette Mädchen vor sich selbst zu retten. Zwischen zwei Jobs und der Erziehung der Kinder ihrer Schwester hat Julianne Bradley keine Zeit für Sport - oder für Männer. Alles, was sie über Max weiß, ist, dass er der sexieste Kunde der Tankstelle ist, an der sie arbeitet. Max ignoriert ihren müden Blick und weckt in Jules die Sehnsucht nach unerreichbaren Dingen: eine glamouröse Affäre, einen leidenschaftlichen Liebhaber und die Zeit, beides zu genießen. Max gibt ihr das Gefühl, Aschenputtel zu sein, obwohl Jules genug Ballast mit sich herumträgt, um den Glaspantoffel zu zerquetschen. Zum Glück ist Max jedoch gar kein Prinz, sondern ein harter Kämpfer, der ihr Herz gewinnen will. Teil 6 der Reihe rund um das Eishockey Team der Carolina Cold Fury von New York Times-Bestsellerautorin Sawyer Bennett.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 391
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sawyer Bennett
Carolina Cold Fury-Team Teil 6: Max
Aus dem Amerikanischen ins Deutsche übertragen von Oliver Hoffmann
© 2016 by Sawyer Bennett unter dem Originaltitel „Max: A Cold Fury Hockey Novel“
© 2024 der deutschsprachigen Ausgabe und Übersetzung by Plaisir d’Amour Verlag, D-64678 Lindenfels
www.plaisirdamour.de
© Covergestaltung: Sabrina Dahlenburg
(www.art-for-your-book.de)
ISBN Print: 978-3-86495-688-1
ISBN eBook: 978-3-86495-689-8
Alle Rechte vorbehalten. Dies ist ein Werk der Fiktion. Namen, Darsteller, Orte und Handlung entspringen entweder der Fantasie der Autorin oder werden fiktiv eingesetzt. Jegliche Ähnlichkeit mit tatsächlichen Vorkommnissen, Schauplätzen oder Personen, lebend oder verstorben, ist rein zufällig.
Dieses Buch darf ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Autorin weder in seiner Gesamtheit noch in Auszügen auf keinerlei Art mithilfe elektronischer oder mechanischer Mittel vervielfältigt oder weitergegeben werden. Ausgenommen hiervon sind kurze Zitate in Buchrezensionen.
Anmerkung der Autorin
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Epilog
Autorin
Anmerkung der Autorin
Liebe Cold-Fury-Fans,
wenn Sie mit dem Buch über Max anfangen, werden Sie schnell feststellen, dass einige Dinge ein wenig „vertraut“ klingen. Das liegt daran, dass es parallel zu den Geschehnissen um Hawke spielt. Der Bonus: Sie bekommen beim Lesen ein bisschen mehr Einblick in Hawkes und Vales Geschichte.
Viel Spaß dabei!
Kapitel 1
Max
Ich stecke den Zapfhahn in den Tank, drücke den Griff herunter und klappe zum Fixieren den Arretierhaken nach unten. So kann das Benzin von allein fließen. Ich gehe derweil über den fast leeren Parkplatz zum Tankstellen-Minisupermarkt, der hier draußen an der Possum Track Road wie ein Leuchtfeuer strahlt. Weil ich einen Bärenhunger habe und weiß, dass mein Kühlschrank zu Hause leer ist, werde ich mir etwas Junkfood zum Abendessen kaufen. Vale darf davon nichts erfahren, denn ich habe keine Lust, mir ihr Gemecker anzuhören.
Vale Campbell … verdammt hübsch und nett anzuschauen, aber ich fürchte mich davor, mit ihr abhängen zu müssen. Das liegt daran, dass sie eine der stellvertretenden Athletiktrainerinnen bei Cold Fury ist und mit mir vor allem an meiner Kraft und Kondition arbeitet. Sie würde mit Sicherheit sagen, dass Snickers, Käsecracker und Mountain Dew nicht auf meinem Speiseplan stehen und dann würde sie mich Liegestützsprünge, Bergsteiger und Boxsprünge machen lassen bis ich kotze.
Ich werde ihr also nichts von diesem kleinen Fehltritt erzählen und nehme gern alles mit, was sie mir im Trainingslager mitgibt. Schließlich habe ich mir vorgenommen, in dieser Saison so stark wie nie zuvor zu sein und ich werde den begehrten Posten des Stammtorwarts bekommen, der frei wurde, als Ryker Evans im Sommer seinen Rücktritt bekannt gegeben hat. Die Cold Fury haben die Meisterschaft schon letztes Jahr geholt und ich rieche förmlich, dass das diese Saison wieder drin ist. Da werde ich mich von zwei schweren Verletzungen in ebenso vielen Jahren nicht unterkriegen lassen.
Nein, ich kehre mit aller Macht zurück und werde mich vor meiner Mannschaft und meinen Fans beweisen.
Aufgepasst, Eishockey-Welt … Max Fournier ist zurück.
Als ich die Tür des Tankstellen-Minisupermarkts öffne, sehe ich zwei Männer an der Kühltheke, die den Biervorrat abchecken. Beide tragen ölverschmierte Feinrippunterhemden und verblichene Baseballkappen. Ich ziehe meine Mütze noch weiter herunter, um mein Gesicht zu verbergen, denn ich habe heute Abend keine Lust, erkannt zu werden. Es ist spät, ich will mein Junkfood kaufen und verschwinden. Wir haben morgen früh Training.
Ich wende mich nach rechts in den ersten Gang mit den Chips und sonstigen Knabbersachen, wohl wissend, dass die beiden anderen Kunden auf dem Weg zur Kasse sind, um zu bezahlen. Sicherheitshalber kehre ich ihnen den Rücken zu und schaue mir das Angebot an.
Zwiebelringe.
Kartoffelchips.
Tortilla-Chips.
Gerösteter Mais.
Als ich nach einer Tüte Kartoffelchips mit Salz und Essig greife, höre ich, wie einer der Kerle mit dem typischen Akzent eines North-Carolina-Hinterwäldlers sagt: „He, Süße. Eine Packung Marlboro Red und eine Schachtel Kondome. Die extra großen.“
Der Begleiter des Hinterwäldlers lacht und schnaubt dann. Ich drehe mich halb um und sehe, wie die beiden einander verschwörerisch angrinsen und der eine den anderen anstupst, um ihn anzustacheln. Während die Verkäuferin sich umdreht, um die Kondome zu holen, lehnt sich der Hinterwäldler über den Tresen und starrt ihr unverhohlen auf den Hintern. Der andere Kerl sagt laut genug, dass ich es höre – und ich weiß, dass die Frau es auch hört: „Mmm … schöner Arsch.“
Ich wende mich der Theke zu und sehe, wie sich der Rücken der Frau versteift und sie ihr Gesicht nach links wendet, zu einer geschlossenen Tür neben dem Zigarettenregal. Ist dort drin vielleicht ein Manager oder ein anderer Angestellter und sie hofft auf Hilfe?
Aber sie dreht sich zu den beiden Arschlöchern um und strafft die Schultern.
Gottverdammt … sie ist atemberaubend. Sieht man einmal von ihrer rot-goldenen Polyesterweste mit Namensschild – eindeutig eine Uniform – ab, ist ihr Gesicht makellos. Weiche, strahlende Haut, hohe Wangenknochen, eine gerade Nase, die sich am Ende leicht neigt, und ein verdammt sexy Mund, der bestimmt voll und üppig wäre, wenn ihre Lippen nicht zu einer Grimasse verzogen wären. Ihr Haar ist nicht blond, aber auch nicht brünett. Ich würde es als karamellfarben mit honigfarbenen Strähnen beschreiben. Es ist zu einem Pferdeschwanz zusammengefasst und sie hat einen langen Pony, der von links nach rechts in ihre Stirn fällt.
Während sie den beiden Männern entschlossen gegenübertritt, sehe ich in ihren Augen eine gewisse Vorsicht, als sie die Zigaretten und die Kondome auf den Tresen legt. „Wäre das alles?“
Ihre Stimme hat einen dezenten Südstaatenakzent. Sie schaut zwischen den Typen hin und her, ohne den Blick zu senken.
Prolet Nummer eins nickt zu dem Zwölferpack Bier, den er zuvor dort abgestellt hat, und sagt: „Das war das letzte Coors. Hast du noch welche im Lager?“
„Nein, das war’s“, antwortet sie mit fester Stimme und ich merke, dass es eine Lüge ist.
„Sicher?“, fragt er, stützt sich mit den Ellbogen auf den Tresen und sieht sie an. „Vielleicht könntest du nachsehen … ich könnte dir helfen, wenn du willst, und wir könnten die Kondome gleich ausprobieren.“
Ich würde mit den Augen rollen über die Absurdität dieses Versuchs, ein Mädchen anzubaggern, das nicht in seiner Liga spielt. Doch ich bin zu angespannt wegen der Aussicht, dass dies mehr sein könnte als nur ein harmloses Herumalbern von ein paar betrunkenen Hinterwäldlern.
„Was sagst du dazu, Süße?“, fragt er mit einer Stimme, die verführerisch anmuten soll, aber eher nach Abschaum klingt.
„Ich sage, da hinten ist kein Bier mehr“, presst sie hervor, wirft einen Blick über die Schulter zur geschlossenen Tür und dann zurück zu den Männern.
Das war ein besorgter Blick.
Ein sehr besorgter sogar, also beschließe ich, dass das so nicht weitergehen kann. Ohne hinzusehen schnappe ich mir die nächstbeste Tüte Chips und gehe den Gang entlang zur Kasse, während ich mit der anderen Hand die Kappe abnehme. Ich stecke sie in meine Gesäßtasche und als ich nur noch wenige Meter von den Männern entfernt bin huscht der Blick der Frau erleichtert zu mir. Mit einem aufmunternden Lächeln lese ich ihr Namensschild.
Julianne.
Ein schöner Name für ein schönes Mädchen.
Das Geräusch meiner Schritte dringt schließlich zu den Typen durch, weshalb sie sich zu voller Größe aufrichten, die immer noch ein paar Zentimeter unter der meinen liegt, und sich in meine Richtung drehen. Mein Blick fällt auf den ersten und wandert dann langsam zu dem anderen, wobei ich beide eiskalt fixiere. Wortlos fordere ich die zwei auf, die Schönheit hinter dem Tresen nicht weiter zu belästigen.
Da ich vermute, dass die einzigen Sportarten, die diese Typen verfolgen, Barschangelturniere und NASCAR sind, überrascht es mich nicht, dass keiner von ihnen mich als Torwart der Carolina Cold Fury erkennt. Die reizende Julianne offensichtlich auch nicht aber das ist in Ordnung.
Das Geräusch von Fingern, die auf die Kasse klopfen, erregt die Aufmerksamkeit der beiden Männer und sie drehen sich zu ihr um. „Das macht 19,86 Dollar.“
Einer der Kerle zieht eine Geldbörse aus der Gesäßtasche seiner schlechtsitzenden Jeans, holt einen Zwanziger heraus und reicht ihn ihr schweigend. Jetzt, wo sie wissen, dass sie Publikum haben, scheint keiner von ihnen das miese Spiel fortsetzen zu wollen. Zumindest glaube ich, dass es ein Spiel war, aber ich bin froh, dass ich hier war, sonst wäre daraus möglicherweise ernst geworden.
Julianne gibt dem Mann sein Wechselgeld, die beiden packen ihre Einkäufe ein und gehen grußlos.
Sobald sich die Tür geschlossen hat, entspannen sich Juliannes Schultern und sie seufzt erleichtert. Sie schenkt mir ein schwaches Lächeln, schaut auf die Chipstüte in meiner Hand und fragt: „Ist das alles?“
„Eigentlich nicht“, sage ich und grinse verlegen. „Diese Ärsche haben mich abgelenkt. Ich brauche noch ein paar weitere Dinge.“
„Klar“, antwortet sie mit müder Stimme und streicht sich die langen Haare zurück, ehe sie sich von mir abwendet und sich einem offenen Karton zuwendet, der auf einem Hocker zu ihrer Linken steht. Sie greift hinein, holt eine Stange Kippen heraus, die sie zügig öffnet, und beginnt, das Zigarettenregal hinter dem Tresen aufzufüllen. Ich bin damit praktisch entlassen und habe jetzt nicht mehr den geringsten Zweifel daran, dass sie nicht weiß, wer ich bin.
Also gehe ich zurück in den Gang mit den Chips, nehme eine Tüte gerösteten Mais und begebe mich zu den Getränken. Ich schnappe mir eine Flasche Mountain Dew, wobei ich keine Sekunde die Light-Variante in Betracht ziehe – das würde den Sinn eines Junkfoodabends völlig zunichtemachen –, und schlendere dann weiter zum Gang mit den Süßigkeiten. Zwei Snickers und schon bin ich fertig.
Sie muss mich kommen gehört haben, denn sie dreht sich mit demselben müden Lächeln wie vorhin um. Während sie zur Kasse geht, fällt ihr Blick auf die Artikel, die ich auf den Tresen lege, und sie tippt wie ein Roboter deren Preise ein. Ich beobachte ihre zarten Finger, mit denen sie die Tasten bedient, und ihre hängenden Schultern, als sie den letzten Artikel eintippt und den Blick wieder auf mich richtet.
Ihre Augen sind golden … nun, eigentlich hellbraun, aber so hell, dass sie wie poliertes Gold wirken.
Hinter der geschlossenen Tür ertönt ein schriller Schrei, so hoch, dass mir die Zähne wehtun. Ich fahre fast aus der Haut, so unerwartet war das Geräusch.
Die Frau, laut Namensschild Julianne, schließt die Augen, senkt den Kopf und stößt einen gequälten Seufzer aus. Es ist eine so leidgeprüfte Geste, dass ich für einen kurzen Moment die Hand ausstrecken und ihr aus Mitgefühl die Schulter drücken möchte. Aber ich ahne nicht, wofür ich Mitleid empfinde, denn ich weiß nicht, was dieses unheilige Geräusch war. Ich öffne den Mund, um zu fragen, ob es ihr gut geht, als die geschlossene Tür neben dem Zigarettenständer auffliegt und ein kleines Etwas herausstürmt.
Nicht mehr als einen Meter hoch, gefolgt von einem weiteren Geschöpf der gleichen Größe.
Wieder ein durchdringender Schrei aus dem Raum, diesmal lauter, weil die Tür jetzt offen ist, und für einen schrecklichen Augenblick fürchte ich, gerade Zeuge eines Mordes gewesen zu sein. Ich mache einen Schritt zur Seite, will den Tresen umrunden.
Julianne streckt blitzschnell die Hände aus und packt die beiden kleinen Kerlchen am Kragen. Als sie zum Stillstand kommen, sehe ich, dass es zwei kleine Jungs sind, beide mit hellbraunem Haar und ebensolchen Augen. Der eine hält eine Puppe in den Händen, der andere etwas, das aussieht wie ein Lego-Lkw.
Sie sieht mich entschuldigend an und sagt: „Tut mir leid. Geben Sie mir eine Sekunde.“
Mit festem, aber sanftem Griff dreht sie die kleinen Jungs in Richtung des Raumes, schiebt sie hinein und verschwindet mit ihnen darin. Sofort höre ich ein beunruhigendes Krachen, einen weiteren Schrei und ein lautes Fluchen der Frau, von der ich weiß, dass sie Julianne heißt: „Ach, Scheiße.“
Ein weiteres Kreischen von etwas, das ich für einen psychotischen Pterodaktylus halte, und meine Füße bewegen sich ohne mein Zutun. Ich umrunde die Theke und gehe zur Tür. Als ich über die Schwelle trete, stehe ich in einem kleinen Kabuff, das als Büro und Pausenraum dient. An einer Wand steht ein kleiner Schreibtisch, der mit Papierkram bedeckt ist, an einer anderen ein Regal, darunter ein Waschbecken und ein Minikühlschrank und dann sind da noch ein Klapptisch mit rostigen Beinen und vier Klappstühle aus Metall.
Plötzlich wird mir klar, was für ein Wesen dieses Geräusch verursacht hat, das mit dem Kratzen von Nägeln auf einer Kreidetafel vergleichbar war.
Ein kleines Mädchen, kleiner als die Jungs, ist an einen der Stühle gefesselt – mit etwas, das aussieht wie Klebeband und mehrmals um die Mitte ihres Bauches und um den Stuhl gewickelt ist. Ihre Beine sind frei, und der Lärm kam offenbar von einem Stapel Spielzeug, den sie von der Tischplatte getreten hat.
„Rocco … Levy … ihr habt versprochen, euch zu benehmen“, schimpft Julianne mit bebender Stimme, während sie sich neben das kleine Mädchen kniet und an dem Klebeband zu zerren beginnt. Die Jungs stehen mit hängenden Köpfen da und beobachten, wie ihre Mutter versucht, ihre Schwester zu befreien.
Ich kann einfach nicht anders. Der Tonfall der Frau, ihre völlige Erschöpfung und Frustration und die Tatsache, dass diese kleinen Teufelskerle ihre Schwester an einen Stuhl gefesselt haben, bringen mich in Bewegung. Ich gehe neben der Frau auf die Knie und greife nach dem Klebeband, um es abzureißen.
Sie wendet ruckartig den Kopf in meine Richtung und sagt: „Nicht.“
Mein Blick gleitet von dem Klebeband zu ihr und ich bin fast überwältigt von dem Glanz der dicken Tränen, die in ihren Augen glitzern und sich weigern, zu fallen.
„Bitte … macht es Ihnen etwas aus, draußen zu warten? Wenn irgendwelche Kunden kommen … sagen Sie einfach, ich bin gleich da“, bittet sie mich, wobei ein schwacher Anflug von Unabhängigkeit und dem Bedürfnis, die Sache selbst in die Hand zu nehmen durch die Niedergeschlagenheit hindurchschimmert.
„Klar“, antworte ich sofort und stehe auf, denn ich will die arme Frau mit den schönen, tränennassen Augen nicht noch mehr aufregen. Sie hat auch so schon genug um die Ohren.
Julianne wendet sich wieder dem Klebeband zu und geht dabei äußerst behutsam mit den Streifen auf den Armen des Mädchens um, wie ich feststelle. Ich schaue zu den beiden kleinen Jungs und obwohl ihre Köpfe scheinbar entschuldigend gesenkt sind, sehe ich, dass sie ein leichtes Grinsen im Gesicht haben.
Kleine Teufelchen, keine Frage.
Ich verlasse den Pausenraum und überlege, ob ich meine Snacks einfach auf dem Tresen liegen lassen und gehen soll, aber ich verwerfe den Gedanken. Aus irgendeinem Grund will ich mich vergewissern, dass alles in Ordnung ist, denn wenn ich mich nicht täusche, steht die schöne Frau kurz vor einem schweren Nervenzusammenbruch.
Sie lässt mich nicht lange warten, nur ein paar Minuten, dann kommt sie aus der Tür und zieht sie hinter sich zu. Dabei richtet sie einen letzten Appell an die Kinder drinnen: „Benehmt euch für den Rest des Abends, dann gehen wir am Wochenende für jeden von euch ein neues Spielzeug kaufen, okay?“
Sehr gut. Bestechung funktioniert bei Kindern normalerweise.
Ich höre keine Antwort von drinnen und mit einem tiefen Seufzer zieht sie die Tür zu und dreht sich zu mir um. Sie zuckt leicht zusammen, vielleicht ist sie so in Gedanken versunken, dass sie mich vergessen hat, aber dann fällt ihr Blick auf die Gegenstände auf der Theke.
„Es tut mir leid, dass Sie das miterleben mussten“, sagt sie, während sie zur Kasse eilt und den letzten Snack eintippt, zu dem sie nicht mehr gekommen ist, weil die Höllenbrut ausgebrochen ist.
„Kein Problem“, antworte ich lachend. „Das haben Sie gut gemacht.“
Sie seufzt frustriert, und ihr Pony hebt sich leicht, bevor er herunterfällt. „Sie können manchmal echt anstrengend sein.“
Schließlich sieht sie mir in die Augen. „Das macht dann 7,59 Dollar.“
Wortlos zücke ich mein Portemonnaie, nehme einen Zehner und reiche ihn ihr. Sie nimmt ihn ebenso wortlos, gibt mir das Wechselgeld heraus und packt meine Einkäufe leise in eine Plastiktüte. Ich nutze die Gelegenheit, um ihr Gesicht genauer zu betrachten. Sie ist nicht nur bleich, was auf Erschöpfung hindeuten könnte, sondern hat auch einen blauen Schimmer unter den Augen, was eindeutig Schlafmangel verrät.
Ich bin nicht sicher warum, doch das rührt mich, und ich öffne den Mund, um zu fragen, ob es ihr gut geht. Aber die Glastür des Ladens fliegt auf und zwei Teenager kommen herein, von denen einer laut über etwas lacht, das der andere gesagt hat.
Das Rascheln von Plastik erregt meine Aufmerksamkeit und ich drehe mich um. Die Frau hinter dem Tresen hält mir meine Einkaufstüte hin.
„Gute Nacht“, sagt sie mit einem müden Lächeln und als ich ihr die Tüte abnehme, entlässt sie mich sofort aus ihrem Fokus und beobachtet über meine Schulter hinweg die Teenager, die in den Glaskühlschränken im hinteren Teil des Ladens die Limonaden in Augenschein nehmen.
„Ja“, entgegne ich langsam. „Ihnen auch.“
Sie wirft mir nicht einmal einen zweiten Blick zu und es ist nicht geprahlt, wenn ich sage, dass ich normalerweise viel mehr Aufmerksamkeit von Frauen bekomme als gerade. Hauptsächlich, weil ich berühmt bin, aber auch, weil ich heiß bin, wie mir Frauen mehr als einmal gesagt haben.
Egal.
Der Punkt ist, dass diese Frau mir keinen zweiten Blick schenkt, und ich finde, dass ich …
Na ja, verdammt … ich stehe auf weibliche Aufmerksamkeit.
Ich glaube, ich bin ein wenig schräg. Viele der Single-Jungs im Team schwelgen in ihrem Junggesellendasein und genießen den unendlichen Nachschub an Puck-Häschen, die gern alles in den Wind schlagen, um die Chance zu haben, mit einem Eishockeystar rumzumachen. Doch das ist nicht meine Art. War es noch nie. Ich habe nichts davon, wenn sich eine oberflächliche Frau an mich ranschmeißt, ohne sich wirklich dafür zu interessieren, wer ich bin. Sie sehen einen heißen Torwart, der Millionen verdient, und das ist auch schon alles.
Aber diese Frau … sie sieht nichts anderes als einen gewöhnlichen Kerl. Aus den Augen, aus dem Sinn, und ja … das mag ich total.
Ich wende mich von der Theke ab und verlasse den Minisupermarkt, wobei ich mir vornehme, in naher Zukunft noch einmal vorbeizukommen, um mit ihr zu reden. Ein paar Schichten tiefer gehen. Vielleicht bitte ich sie um ein Date.
Ich lache.
Max Fournier – Eishockeyprofi und einer der begehrtesten Junggesellen des Teams – will mit einer Tankstellenangestellten flirten, die sich einen Dreck um ihn schert.
Das gefällt mir total.
Kapitel 2
Jules
„Levy, bitte probiere die Karotten wenigstens einmal“, sage ich flehend, während ich Annabelles Hühnchen zu Ende schneide. „Ich schwöre, sie werden dich nicht umbringen.“
Er ignoriert mich und stützt den Kopf mit dem Ellbogen auf dem Tisch ab, wobei er die Karotten auf seinem Teller hin und her schiebt. Ich mache mir nicht die Mühe, ihn noch einmal aufzufordern, denn es wird nichts nützen.
„Na schön, hier, Annabelle“, sage ich, richte mich auf und wende mich an Rocco. „Möchtest du noch Milch?“
Er schüttelt grinsend den Kopf und um mich stolz zu machen sticht er mit seiner Gabel in eine Karotte und isst sie. Ich strahle ihn für den Bruchteil einer Sekunde an, ehe ich mein Handgelenk umdrehe und auf meine Uhr schaue.
Mist. Tina hat fünfzehn Minuten Verspätung und wenn ich nicht in den nächsten zwei Minuten losfahre, komme ich auch zu spät.
Ich drehe mich zu meiner Handtasche auf dem Tresen um, wobei ich die Entfernung falsch einschätze und mit dem Hüftknochen gegen die Ecke knalle.
„Sch…“, setze ich zu sagen an, kriege aber mitten im Fluch noch die Kurve. „Schlecht.“
Es ist vier Monate her, dass die Kinder zu mir gezogen sind, und ich schaffe es inzwischen, wenn auch mit Mühe, vor ihnen nicht mehr zu fluchen. Ich greife über den Tresen, krame in meiner Handtasche und ziehe mein Mobiltelefon heraus. Mit ein paar Berührungen des Displays rufe ich Tina an.
„Hey“, antwortet sie nach dem zweiten Klingeln. „Ich wollte dich gerade anrufen. Du, ich schaffe es heute Abend nicht.“
Ich schließe die Augen, während sich meine freie Hand unwillkürlich zur Faust ballt, atme tief ein, und als ich die Augen öffne, kommen mir die Tränen. Es fällt mir in letzter Zeit immer schwerer, sie zu unterdrücken. Ich seufze und flehe dann inständig, mit leicht zitternder Stimme: „Bitte tu mir das nicht an, Tina. Ich kann nicht schon wieder nicht zur Arbeit erscheinen.“
„Tut mir leid, Jules“, sagt sie beschwichtigend. „Aber Marshall hat neununddreißig Fieber und ich glaube, ich muss ihn zum Arzt bringen.“
Ich nicke … nicht zustimmend, sondern eher niedergeschlagen. Dann blinzle ich meine Tränen weg. „Okay, verstehe.“
Dafür, dass Marshall Fieber hat, habe ich tatsächlich Verständnis. Aber nicht dafür, dass sie mich vor zwei Nächten schon versetzt hat, als sie nicht auf die Kinder aufpassen konnte, weil ihr Freund Todd sie zu einem Konzert im Red-Hat-Amphitheater mitnehmen wollte, für das er in einer Radiosendung Karten gewonnen hatte. Das hat mich dazu veranlasst, die Kinder mit zur Tankstelle zu nehmen, was eine sehr schlechte Idee war, wie ich wusste. Die Wahrscheinlichkeit, dass mich Chris, der Manager, erwischte, stand fünfzig zu fünfzig, denn manchmal kam er vorbei, um mich zu kontrollieren, manchmal auch nicht. In der Schicht von neunzehn bis vierundzwanzig Uhr war in den ersten Stunden viel los, aber nach einundzwanzig Uhr wurde es ruhiger. Normalerweise war ich froh, wenn diese magische Stunde schlug, doch vor zwei Nächten überraschte er mich mit einem Besuch gegen dreiundzwanzig Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren die Kinder schon auf dem harten Fliesenboden im Pausenraum eingeschlafen, was natürlich nicht ideal war. Andererseits konnte ich es mir nicht leisten, diesen Job zu verlieren.
Ich konnte sie auf keinen Fall allein zu Hause lassen.
Also bekam ich eine Standpauke von Chris und den Hinweis, dass Kinder dort nicht sein durften, wenn ich arbeitete.
„Vielleicht kann Glenda ja einspringen“, schlägt Tina vor.
„Kommt überhaupt nicht infrage“, sage ich entschieden.
Meine Nachbarin Glenda ist nachts absolut keine Option. Im Sommer hat sie tagsüber auf die Kinder aufgepasst, während ich in meinem Hauptberuf gearbeitet habe. Als die Schule anfing – Levy und Rocco waren in der ersten beziehungsweise zweiten Klasse –, musste sie nur noch auf Annabelle aufpassen, bis Levy und Rocco von der Schule nach Hause kamen.
Für mich ist das ein guter Deal. Sie passt auf die Kinder auf, damit ich von sieben bis sechzehn Uhr im Sweetbrier Nursing Home arbeiten kann, und im Gegenzug koche und putze ich für sie und ihren Mann Bill. Bill hat keine Ahnung von dem Arrangement und nimmt an, dass Glenda jeden Abend für ihn kocht und ihre kleine Wohnung sauber hält, aber Glenda hasst es, zu kochen, und noch mehr hasst sie es, zu putzen. Hinzu kommt, dass ich kein Geld habe, um sie zu bezahlen, geschweige denn mir eine Tagesbetreuung zu leisten, und so ist es ein guter Tausch, bis ich eine andere Lösung gefunden habe.
Glenda ist zwar nett, kompetent und kümmert sich gut um die Kinder, aber ihr Mann ist ein ausgewiesenes Arschloch und ein Alkoholiker und er ist abends zu Hause, also möchte ich die Kinder nicht in seiner Nähe haben.
„Es tut mir wirklich leid“, wiederholt Tina. „Ich muss jetzt Marshall in die Notaufnahme bringen.“
Um Tina keine Schuldgefühle zu machen, unterdrücke ich meinen Seufzer. Außerdem seufze ich in letzter Zeit sehr viel und das muss ich ändern. „Schon okay“, versichere ich ihr wider besseres Wissen.
Ich bin am Arsch.
Wenigstens kann ich noch in Gedanken fluchen, selbst wenn mich das im Augenblick nicht tröstet.
Annabelle stößt einen verzweifelten Schrei aus, ich drehe mich um und sehe, dass Levy all seine Karotten auf ihren Teller gestapelt hat. Sie mag sie auch nicht, also ist sie total beleidigt noch mehr zu bekommen.
„Hör auf damit, Levy“, befehle ich, aber er ignoriert mich. Mit sechs Jahren und als mittleres Kind scheint er sich irgendwie im Recht zu fühlen, meine Befehle zu missachten. Ich habe noch keinen Weg gefunden, das zu umgehen, also lasse ich es dabei bewenden, indem ich sage: „Schon gut, Annabelle. Ich erwarte nicht, dass du die alle isst.“
Annabelle lächelt, dreht sich um und streckt Levy die Zunge heraus.
Ich atme noch einmal tief durch … bete zu Gott, dass er mir Geduld und einen verständnisvollen Chef schenkt.
Dann rufe ich Chris an.
„Chris Bellis“, meldet er sich autoritär am Telefon, als wäre er der wichtigste Mann der Welt.
„Hier ist Julianne“, melde ich mich zögernd und fürchte mich schon vor seiner Antwort. „Ähm … mein Babysitter ist ausgefallen und ich schaffe es heute Abend nicht.“
Er sagt nichts.
„Es sei denn, Sie lassen mich die Kinder mitbringen“, füge ich schnell hinzu. „Ich schwöre, sie werden keinen Ärger machen.“
Bitte, Gott, lass nicht zu, dass sie Ärger machen.
Schließlich antwortet er: „Inakzeptabel, Jules. Wir haben klare Regeln, was Kinder angeht.“
„Nun, dann … tut es mir leid, aber ich kann nicht kommen. Sie müssen jemanden finden, der für mich einspringt“, sage ich mit hoffentlich fester Stimme, obwohl ich Angst habe, dass ich es gerade vermasselt habe.
„Dann tut es mir auch leid, Jules, aber ich muss Sie entlassen, wenn Sie heute Abend nicht auftauchen“, gibt er ebenso entschieden zurück. „Das wäre das zweite Mal in einer Woche, dass Sie Probleme mit der Kinderbetreuung haben, und das wird offensichtlich zum Dauerthema.“
„Nein“, versichere ich schnell und versuche dann, beruhigende Worte zu finden. „Es ist kein Dauerthema. Ich habe nur Pech. Chris, ich arbeite seit über zwei Monaten für Sie und das ist das erste Mal, dass ich darum gebeten habe, freizubekommen.“
„Ich spüre aber, dass dies nicht das letzte Mal sein wird“, behauptet er scharf. „Sie sind nicht die erste alleinerziehende Mutter, die hier arbeitet, und keine davon war zuverlässig. Ich habe keine Zeit, jemanden durchzufüttern, der nicht genug Verantwortung hat …“
„Bitte, Chris“, flehe ich und wieder steigen mir die Tränen in die Augen. „Ich brauche den Job wirklich.“
Er ist unerschütterlich. „Wenn Sie morgen Abend vorbeikommen, habe ich Ihre Schlusszahlung parat und Sie können den Schlüssel abgeben.“
Ich ziehe nicht einmal in Erwägung, weiter mit ihm zu diskutieren. In diesem Augenblick bin ich mehr als am Ende. Völlig am Boden. Ich habe nicht die Kraft, mir darüber Gedanken zu machen, dass ich nur mit diesen zusätzlichen Wocheneinnahmen drei hungrige Kinder ernähren und einkleiden kann, die ich nie gewollt habe.
***
Ich drehe den Kopf auf dem Kissen und ich schaue auf die Digitaluhr auf dem Nebentisch. Es ist fast dreiundzwanzig Uhr und ich kann nicht schlafen. Annabelle hat dieses Problem nicht, sie hat sich an mich geschmiegt und einen Arm um meinen Hals gelegt. Das ist ihre übliche Schlafposition, seit sie mit mir in dieser winzigen Wohnung wohnt, und nach vier Monaten habe ich mich daran gewöhnt. Das ist es also nicht, was mich wachhält.
Ich kann nicht einschlafen, weil ich daran gewöhnt bin, mit nur ein paar Stunden Schlaf pro Nacht auszukommen. Nach der Schicht an der Tankstelle kann ich froh sein, wenn ich viereinhalb Stunden Schlaf kriege, bevor ich aufstehen muss, um meinen Arbeitstag im Pflegeheim zu beginnen.
Das ist das Leben der Julianne Bradley.
Arbeiten, schlafen. Arbeiten, schlafen. Arbeiten, schlafen.
Eigentlich ist das nicht richtig. Es heißt eher: Arbeiten. Schlafen. Auf die Kinder aufpassen. Arbeiten. Auf die Kinder aufpassen. Für Glenda und die Kinder kochen und putzen. Arbeiten. Schlafen.
In diesem Alltagstrott ist nirgends Zeit für mich, es sei denn, man zählt die schnelle fünfminütige Dusche jeden Morgen. Es ist erstaunlich, welche Kleinigkeiten man aus seinem Leben streichen kann, weil sie unwichtig sind, wenn man unter Zeitdruck steht. Ich kann in etwa fünfzehn Minuten geduscht und angezogen zur Arbeit erscheinen. Das liegt daran, dass ich kein Make-up mehr trage und mein nasses Haar normalerweise zu einem Pferdeschwanz binde oder zum Dutt hochstecke. So habe ich ausreichend Zeit, um die Kinder zu wecken, anzuziehen und ihnen Frühstück zu geben, bevor Glenda erscheint. Sie bringt Levy und Rocco zum Bus und bleibt dann mit Annabelle in meiner Wohnung. Die Jungs kommen gegen sechzehn Uhr nach Hause, etwa zur selben Zeit wie ich von der Arbeit. Da ich nur wenige Kilometer von Sweetbrier entfernt wohne, bin ich normalerweise so gegen sechzehn Uhr fünfzehn zu Hause. Ich helfe Levy und Rocco bei den Hausaufgaben und allem, was sie sonst brauchen. Im Anschluss verbringe ich etwa eine Stunde in Glendas Wohnung, die direkt nebenan liegt. Dafür habe ich eine gute Routine entwickelt: montags und donnerstags Staub wischen und Bad putzen. Dienstags und freitags saugen und wischen. Mittwochs erledige ich alles, was warten kann, bis es eigentlich dran wäre. Das Einzige, was ich nicht mache, ist ihre Wäsche – ich habe Glenda gesagt, dass ich auf keinen Fall Bills Unterwäsche waschen werde.
Es war ihr egal. Sie war nur froh, dass sie sich nicht um so unangenehme Dinge wie Kloputzen kümmern musste, und noch glücklicher, dass ich für sie kochen konnte.
Nachdem ich also bei Glenda geputzt habe, gehe ich heim, bereite das Abendessen für ihre und meine Familie zu und helfe zwischendurch den Kindern, wenn sie noch Hausaufgaben machen. Wenn ich Glück habe ist das Abendessen fertig, bevor ich zur Arbeit an der Tankstelle aufbrechen muss, und ich kann mir noch schnell etwas in den Mund stecken. Wenn nicht, übernimmt Tina – die auch meine Nachbarin ist, aber ein Stockwerk weiter unten wohnt – das Füttern der Kinder, während Glenda ihre Portion für später, wenn Bill kommt, mit nach Hause nimmt.
Ich seufze in die Dunkelheit meines Zimmers und versuche, nicht an mein Leben vor Melodys Tod zu denken. Oft habe ich mit meinen Freunden oder meinem Freund darüber geklagt, wie schwer es manchmal ist, erwachsen zu sein und allein zu leben. Ich wollte mir die Haare färben lassen, konnte es aber nicht, weil ich ein Paar Schuhe gekauft hatte, das ich einfach haben musste. Oder das Profil meiner Reifen war abgenutzt, weil ich jedoch mein ganzes zusätzliches Geld für Spaßkäufe rausgeworfen hatte, konnte ich sie nicht wechseln lassen. In manchen Phasen konnte ich auch kurz vor dem Zahltag nur Ramen-Nudeln essen, doch am Tag danach habe ich mein frisch eingetroffenes Geld für ein hübsches Oberteil von The Gap ausgegeben.
Ich verdrehe innerlich die Augen, wenn ich an mein jetziges Leben denke, und mir wird klar, dass ich vor Melodys Tod eigentlich ein unbeschwertes, erfolgreiches Leben geführt habe. Ja, ich hatte es verdammt gut und obwohl ich die Kinder nie hergeben würde, ist da ein wenig Wehmut in mir, wie gut es sich angefühlt hat, nicht so viel Verantwortung zu tragen.
Ich habe nicht darum gebeten, dass meine ältere Schwester mit achtundzwanzig Jahren an Krebs erkrankt. Ich habe nicht darum gebeten, mich um sie kümmern zu müssen. Ich habe nicht darum gebeten, sie beim Sterben zu begleiten. Ich habe nicht darum gebeten, dass meine Nichte und meine beiden Neffen bei mir leben, und ganz sicher auch nicht um all den Stress und die Müdigkeit, die es mit sich bringt, drei Kinder aufzuziehen, die durch den Verlust ihrer Mutter am Boden zerstört sind, während man gleichzeitig für Mindestlohn arbeitet und nicht den geringsten Schimmer hat, wie man mit Kids umgeht.
Trotzdem würde ich nichts an meiner aktuellen Situation ändern wollen.
Nun, für einen weiteren Teilzeitjob würde ich töten, und ich werde morgen anfangen müssen, danach zu suchen. Aber es gab keine andere Möglichkeit, als die Kinder zu mir zu nehmen. Melodys Ehemann hat sie schon lange vor ihrer Krankheit verlassen und obwohl er immer mal wieder auftauchte ist er mit den Unterhaltszahlungen drei Jahre im Rückstand. Ich hatte wirklich keine Chance, Nein zu sagen, als Melody mich direkt fragte, ob ich nach ihrem Tod die Mutter der drei sein wolle.
Ich hätte ihr das niemals abschlagen können.
So übertrug mir das Familiengericht schon vor ihrem Tod die Vormundschaft, da der Vater keine Einwände erhob, und vor vier Monaten wurde ich auf einen Schlag Mutter von drei Kindern, die ich nicht besonders gut kannte. Ich hatte keine Ahnung, wie ich mit ihnen umgehen sollte. Klar war nur, dass es nun meine Aufgabe war, mich um sie zu kümmern, sie aufzuziehen und sie so gut wie möglich zu lieben.
Es ist jetzt meine Pflicht für sie zu sorgen.
Mit einem weiteren Seufzer löse ich vorsichtig Annabelles Arm von meinem Hals und gleite aus dem Bett. Ich fühle mich zu schuldig, nur hier zu liegen, wenn es Dinge zu erledigen gibt, die mir einen Vorsprung für den morgigen Tag verschaffen könnten.
Kapitel 3
Max
Hawke kommt durch die Eingangstür auf mich zu und ich stehe von der Polstercouch auf, auf der ich gewartet habe.
Ich grinse ihn an und sage: „Du bist zu spät.“
Er schaut auf die Uhr und rollt mit den Augen. „Etwa eine Minute.“
Ich antworte nicht, aber wir machen unseren Brudergruß: Handflächenklatschen, Handrückenklatschen, dann eine Gettofaust.
„Jim ist sowieso noch nicht da“, sage ich zu ihm, während ich mich wieder auf die Couch setze. „Er hat gerade angerufen und gesagt, er steht im Stau und kommt etwa fünfzehn Minuten zu spät.“
Hawke setzt sich auf einen Sessel neben der Couch und schlägt die Beine übereinander. Er ist genauso gekleidet wie ich, nur dass sein Anzug schwarz und meiner anthrazitgrau ist.
„Warst du heute Morgen im Krankenhaus?“, frage ich.
„Ja“, antwortet er. „Er sieht gut aus.“
Es geht um Dave Campbell, den Vater unserer kessen Athletiktrainerin Vale. Dave hatte vor zwei Tagen einen Krampfanfall und liegt im Duke Hospital. Er leidet an einem seltenen Hirntumor und hat im Duke eine experimentelle Behandlung erhalten, weshalb ich vermute, dass dieser Anfall eine Komplikation davon ist. Der Grund, warum unser bester Verteidiger Hawke Therrien den Vater unserer Athletiktrainerin im Krankenhaus besucht, ist, dass sie eine gemeinsame Vergangenheit haben.
Genauer gesagt: Hawke und Vale haben eine sehr lange gemeinsame Vergangenheit und nach dem, was ich gestern Nachmittag bei ein paar Bier mit Hawke erfahren habe, keine gute. Ich hatte gespürt, dass zwischen den beiden gestern im Cold-Fury-Trainingsraum etwas vorgefallen war. Vale verkrampfte sich bei Hawkes Eintreten sofort und ich registrierte auch von ihm seltsame Schwingungen. Nach dem Training ging ich, doch als ich ein paar Minuten später noch mal zurückkam, hatte Hawke die Hände auf ihren Schultern und einen sehr verärgerten Gesichtsausdruck. Er ließ sie los wie eine heiße Kartoffel, als ich wieder hereinkam, versuchte jedoch nicht, etwas vor mir zu verbergen.
Daher die Biere danach, bei denen er mir alles erzählt hat.
Offenbar waren Vale und Hawke vor Jahren ein Paar, doch sie hat plötzlich und ohne Erklärung Schluss mit ihm gemacht. Er hat den Grund nie herausgefunden, ist sich aber auch nicht sicher, ob er sie danach fragen sollte. Um die Sache zu verkomplizieren hatten sie anscheinend in der Nacht davor Sex und jetzt ist alles superpeinlich.
Ich hatte keine guten Ratschläge für ihn parat. Mein einziger Versuch, eine Beziehung zu führen, ist kläglich gescheitert, und das war ganz allein meine Schuld. Also konnte ich mir nur anhören, wie er über Vale jammerte und ihm bescheinigen, dass die Situation beschissen war.
„Das hier ist schon krass, was?“, sagt Hawke im Plauderton, während er sich die riesige Lobby ansieht, die mit bequemen, sehr stilvollen und eleganten Möbeln ausgestattet ist. Ein dicker, luxuriöser Teppich in hellem Lila, Grau und Creme passt zu den Tapeten mit einem Blumenmuster, das nicht feminin, sondern einfach nur geschmackvoll ist. Die Empfangsdame thront hinter einem viktorianisch anmutenden Schreibtisch aus Kirschholz und in der Ecke steht ein Flügel, an dem ein Mann sitzt und eine sanfte Melodie spielt.
Es ist definitiv nicht das, was ich mir unter einem Pflegeheim vorstelle, und das Einzige, was darauf hindeutet sind die verschiedenen Bewohner, die ich dort herumlaufen sehe. Einige sind mit Rollatoren unterwegs, andere sitzen in Rollstühlen, die sie über den Boden ziehen, indem sie mit den Füßen über den Teppich schlurfen, statt mit ihren gebrechlichen Armen zu versuchen, die Räder anzutreiben, um an ihr Ziel zu gelangen.
Wir sind im Reha-Center Sweetbrier, weil einer der stellvertretenden Manager der Cold Fury, Jim Perry, eine Spendenaktion für diese Einrichtung organisiert hat. Seine Mutter lebte hier und ist vor ein paar Monaten verstorben. Er war so beeindruckt von ihrer Pflege, dass er eine Wohltätigkeitsauktion veranstaltete, um Geld für den Bau eines neuen Flügels zu sammeln, der eine größere therapeutische Sporthalle und mehr Speiseräume beherbergen sollte. Jim hat einige Spieler gebeten, sich daran zu beteiligen und ich habe bereitwillig zugesagt. Die Benefizveranstaltung fand letzten Monat statt, lange bevor Hawke ins Trainingslager kam, und ich war für die Moderation zuständig. Hawke ist jetzt hier, weil er persönlich eine nachträgliche Spende geleistet und sich bereit erklärt hat, mitzukommen, um den Scheck über 57.000 Dollar, die wir gesammelt haben, an den Heimleiter zu überreichen. Natürlich wird es einen großen Bericht in der Zeitung geben und das Management findet es immer toll, wenn wir so etwas machen.
„Ich hoffe, dass ich niemals an einen Ort wie diesen muss“, fährt Hawke fort. „Wenn ich sterbe, soll es schnell gehen.“
„Amen, Bruder“, stimme ich ihm zu.
Die Einrichtung ist zwar sauber, riecht gut und ist sehr schön ausgestattet, aber mich überfällt dennoch dieses überwältigende Gefühl der Vergänglichkeit, wenn ich die älteren Patienten beobachte, die sich mühsam fortbewegen, weil ihr Körper sie im Stich lässt. Es ist verdammt deprimierend.
Ein Flur, der nach links und rechts zu den beiden Flügeln des niedrigen, weitläufigen Gebäudes mit den weißen Schindeln und den grünen Fensterläden führt, teilt den Eingangsbereich in der Mitte. An der Kreuzung dieses Flurs kommt es zu einem Tumult, als ein älterer Mann versucht, mit seinem Rollstuhl um die Ecke zu fahren, dabei aber mit dem Rollstuhl eines anderen älteren Herrn zusammenstößt.
„Verdammt, Ernie“, schreit der eine Mann. „Pass doch auf, wo du hinfährst.“
„Nein, du musst aufpassen, wo du hinfährst“, keift der andere Bewohner zurück.
Lachend beobachte ich die beiden Männer, die versuchen, ihre Rollstühle zu entwirren, die nun an den Fußstützen ineinander verhakt sind. Die Empfangsdame sieht erschrocken auf, als wüsste sie nicht, was sie tun soll. Ich finde, sie könnte aufstehen und helfen, aber dann eilt eine der Krankenschwestern – wie ich vermute, weil sie einen preiselbeerroten Kittel trägt – zu den Männern, legt ihnen die Hände auf die Schultern und bringt sie mit ein paar gemurmelten Worten dazu, mit dem Geschrei aufzuhören. Anschließend geht sie in die Hocke, schiebt die Stühle auseinander und schickt die Männer in entgegengesetzte Richtungen davon.
Sie richtet sich auf, und ich sehe sie zum ersten Mal von vorn. Mir gefriert der Atem in der Lunge. Ich kenne sie.
Die Schönheit von letzter Woche.
Julianne.
Sie sieht mich nicht, was daran liegt, dass sie mit gesenktem Kopf eine braune Papiertüte durch die Lobby trägt.
„Heilige Scheiße“, sage ich, stehe unwillkürlich von der Couch auf und laufe hinter ihr her.
Ich schäme mich nicht im Geringsten zu sagen, dass ich noch drei weitere Male bei dieser kleinen Tankstelle war, in der Hoffnung, sie wieder im Dienst zu erwischen, aber sie war nie da. Nach dem dritten Mal habe ich aufgegeben, weil ich dachte, sie hätte vielleicht eine andere Schicht oder arbeite gar nicht mehr dort, und ehrlich gesagt … ich konnte es ihr nicht verübeln. Sieht für mich wie ein Scheißjob aus.
Ich weiß nicht, warum ich so unbedingt ein zweites Mal mit ihr reden wollte. Oberflächlich betrachtet hatten wir nicht viel gemeinsam – sie arbeitet für Mindestlohn und hat drei widerspenstige Kinder. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, es war die Tatsache, dass sie trotz ihrer erkennbaren Erschöpfung und Frustration an diesem Abend immer noch so ein starkes Rückgrat hatte. Das hat mich beeindruckt.
Nicht zu vergessen, dass sie einfach umwerfend aussieht.
„Wohin gehst du?“, fragt Hawke, doch ich würdige ihn keines Blickes.
„Bin gleich wieder da“, brumme ich, während ich um den niedrigen Couchtisch herumgehe und Julianne durch die Tür zur Lobby folge.
Sie ist groß für eine Frau, knapp eins fünfundsiebzig, aber das ist perfekt für mich. Ich bin ein baumlanger Torwart von eins dreiundneunzig. Ihr Haar ist auch heute zum Pferdeschwanz gebunden und schwingt munter hin und her, als sie nach der Tür rechts abbiegt und auf einen kleinen Innenhof zugeht. Wann hat ein Krankenpflegerinnenkittel schon mal so verdammt gut an einer Frau ausgesehen? Er schmiegt sich perfekt an ihren Hintern und ich schäme mich nicht, dass mir das auffällt.
Es gibt keinen heißblütigen Mann, der da nicht hinschauen würde.
Sie winkt einer Kollegin zu, die an einem Picknicktisch sitzt und einen gleichfarbigen Kittel trägt, der wohl eine Uniform ist, setzt sich jedoch zum Glück nicht zu ihr. Stattdessen wählt sie eine Betonbank im Schatten einer großen Kreppmyrte. Obwohl es die erste Oktoberwoche ist, ist es noch ziemlich warm.
Ich zögere nicht, sondern gehe direkt auf sie zu. Sie sieht mich nicht, da sie ihren Kopf über die Papiertüte gebeugt hat, aus der sie ein in Plastik eingewickeltes Sandwich und einen Obstbecher herauszieht. Ich werfe einen Blick auf die Uhr und sehe, dass es erst fünf nach elf ist, also nehme ich an, dass dies ihre Frühstückspause sein muss.
„Julianne?“, frage ich, als ich nur noch einen knappen Meter entfernt bin.
Sie hebt ruckartig den Kopf und sieht mich ausdruckslos an, ehe sie fast zögernd antwortet: „Ja?“
Ich stecke die Hände in die Taschen und versuche, lässig vor ihr stehen zu bleiben. „Wir haben uns letzte Woche an der Tankstelle getroffen, wo Sie arbeiten. Nun, wir wurden uns nicht offiziell vorgestellt …“
Sie starrt mich ausdruckslos an, und obwohl ihre goldbraunen Augen so schön sind, wie ich sie in Erinnerung habe, sind sie immer noch durch die dunklen Ringe darunter getrübt. Es ist klar, dass sie keinerlei Ahnung hat, wer ich bin. Das sollte mein Ego verletzen, aber das Gegenteil ist der Fall – ich mag es, dass sie mich nicht kennt. So bin ich einmal ein echtes Mysterium und werde nicht aufgrund meiner Prominenz sofort in eine Schublade gesteckt.
Ich gebe ihr noch ein paar Informationen, um ihrem Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen. „Zwei Hinterwäldler, die Ihnen Ärger machen, und dann zwei streitlustige Zwerge, die ihre Schwester gefesselt haben?“
Diese letzte Aussage unterstreiche ich mit einem Grinsen und sie erkennt mich schließlich. Ihr Mund formt sich zu einem „O“.
„Ich erinnere mich“, sagt sie leise mit dem Anflug eines Lächelns, das genauso rasch wieder verschwindet, wie es entstanden ist. „Das war nicht gerade mein bester Abend.“
„Nun, ich finde, Sie haben das mit Bravour gemeistert“, versichere ich ihr.
Abermals die Andeutung eines Lächelns, das ihre Augen nicht ganz erreicht, dann fällt ihr Blick auf ihren Schoß. Sie wirkt schüchtern, als wüsste sie nicht, wie sie reagieren soll, oder vielleicht will sie auch nur in Ruhe gelassen werden. Da ich die Antwort nicht kenne, bleibe ich dran.
Ich nehme neben ihr auf der Bank Platz und sie rückt überrascht ein Stück ab, wendet sich dann jedoch mit großen, interessierten Augen mir zu.
„Ich bin noch mehrfach zu der Tankstelle gefahren, um Sie zu sehen“, sage ich im Plauderton.
Ihr bleibt der Mund offenstehen. „Warum das denn?“
Ich zucke die Achseln und sage ihr die einfache, aber vielleicht etwas zu forsche Wahrheit. „Sie sind ein hübsches Mädchen, ich habe keinen Ehering gesehen und ich wollte mehr über Sie erfahren.“
Julianne runzelt die Stirn und wirkt völlig verwirrt.
Also versuche ich es ihr zu erklären. Ich beuge mich vor und zwinkere verschwörerisch. „Das passiert, wenn ein Mann an einem Mädchen interessiert ist. Er versucht, Konversation zu machen.“
Na ja, das ist nicht ganz richtig. Viele Kerle wollen Mädchen nur an die Wäsche, aber das war nicht meine ursprüngliche Absicht. Verstehen Sie mich nicht falsch … diese Frau ist verdammt heiß, und ich werde nicht so tun, als würde hier nicht Anziehungskraft eine große Rolle spielen, doch ich bin auch wirklich fasziniert von ihr.
Sie sagt immer noch nichts und ich weiß nicht, ob sie einfach nur schrecklich schlecht in Small Talk oder ungewöhnlich schüchtern ist, was beides sehr schade wäre, denn ich mag es, wenn meine Frauen eine gewisse Persönlichkeit haben.
Also versuche ich erneut, den Ball ins Rollen zu bringen. Ich strecke die rechte Hand aus und sage: „Mein Name ist Max Fournier.“
Endlich bewegt sie sich und streckt mir die Hand hin, als würde sie es endlich schaffen, sich vorzustellen. „Julianne Bradly. Meine Freunde nennen mich Jules.“
Ihre Hand ist weich und die Knochen fühlen sich zart an, aber ihr Händedruck ist überraschend kräftig. Das gefällt mir. Mir gefällt auch, dass sie mich in die Kategorie „Freund“ und nicht in die Kategorie „komischer Kauz“ einordnet.
Unsere Hände lösen sich voneinander. Das gefällt mir weniger.
„Tja, Jules … wann arbeiten Sie das nächste Mal? Dann komme ich vorbei und leiste Ihnen Gesellschaft. Vielleicht verjage ich auch noch ein paar Hinterwäldler für Sie.“
Endlich bekomme ich ein echtes Lächeln von ihr, das ihre Augen erreicht. „Das ist lieb von Ihnen, aber leider bin ich dort rausgeflogen, also werden Sie mich dort nicht mehr stalken können.“
„Warum das denn?“, frage ich, ein wenig bestürzt darüber, dass ich sie dort nicht sehen kann, denn das wäre die perfekte Ausrede für mich, um … nun ja … sie zu stalken. Allerdings macht es mich auch ein wenig glücklich, weil ich das Gefühl habe, dass der Job unter ihrer Würde war.
„Mein Chef fand heraus, dass ich die Kinder dabeihatte und das ist gegen die Firmenpolitik“, antwortet sie traurig. „Außerdem konnte ich einmal nicht zur Arbeit kommen, weil meine Babysitterin wieder ausgefallen ist.“
Ich neige den Kopf. „Das hier ist vermutlich Ihr Hauptjob? Sind Sie Krankenschwester?“
„Ja, das ist mein Hauptjob, ich bin examinierte Schwesternhelferin. Ich habe nur von Montag bis Freitag von sieben Uhr abends bis Mitternacht in der Tankstelle gearbeitet.“
„Sie haben also zwei Jobs und ziehen drei Kinder groß?“, erkundige ich mich erstaunt.
„Genau.“
Wow.
„Haben Sie einen Ehemann oder Freund, der Ihnen hilft?“ Ich muss das einfach fragen.
Julianne schüttelt den Kopf, begleitet von einem weiteren hübschen Lächeln, aber diesmal senkt sie den Blick in einer eindeutig schüchternen Geste. Sie hebt die Hand und streicht sich eine verirrte Haarsträhne hinters Ohr, die sich aus ihrem Pferdeschwanz gelöst hat. „Ich bin allein.“
O mein Gott. Kein Wunder, dass sie aussieht, als könnte der nächste Windstoß sie umwehen. Ich finde, dem Arsch, der sie geschwängert und mit drei Kindern zurückgelassen hat, sollte mal jemand in den Hintern treten.
Ich bin zwar froh, dass es keinen Mann in ihrem Leben gibt, aber ich habe trotzdem ein ungutes Gefühl angesichts ihrer Notlage. „Keine Familie, die einer jungen Mutter mit ihren Kindern aushilft?“
Ihr Gesicht wird ein wenig reserviert und ich fürchte, sie sagt gleich, ich solle mich um meine eigenen Angelegenheiten kümmern, aber ich bin verblüfft, als sie antwortet: „Ich bin ihr gesetzlicher Vormund und es gibt nur mich. Die Kinder kamen vor vier Monaten zu mir, nach dem Tod meiner Schwester.“
Scheiße.
Einfach … Scheiße.
Plötzlich ist mir alles klar und ergibt Sinn. Eine junge Frau arbeitet als Schwesternhelferin und kommt wahrscheinlich ganz gut allein zurecht. Die Schwester stirbt und sie übernimmt die Erziehung ihrer Nichte und ihrer Neffen mit einem für ihre Arbeit vermutlich lächerlichen Gehalt. Kein Wunder, dass sie einen Zweitjob hatte.
Kein Wunder, dass sie aussieht als würde sie gleich zusammenbrechen.
Wenn man bedenkt, wie widerspenstig diese kleinen Teufelchen zu sein scheinen, wette ich, dass sie überfordert ist.