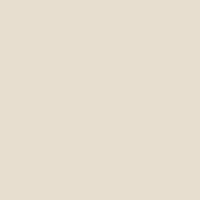15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: REDLINE
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Streckenstilllegungen, Streiks, Preiserhöhungen und Privatisierungspläne: Verlieren wir unsere Bahn? Unnachgiebig treibt Bahnchef Hartmut Mehdorn den Staatskonzern seit Jahren auf marktwirtschaftlichen Kurs - trotz aller Proteste von Mitarbeitern und Kunden und gegen alle Widerstände aus der Politik. Obwohl eigentlich Angestellter des Staates, strebt er mit aller Gewalt eine Privatisierung und den Umbau zum internationalen Logistikkonzern an. Bürger und Bahnkunden befürchten, dass dabei Volksvermögen unwiederbringlich verschleudert wird und sie letztendlich die Zeche zahlen - ganz zu schweigen vom drohenden Ende der flächendeckenden Bahn für alle. Der Journalist Markus Wacket beschäftigt sich seit Jahren mit der Entwicklung der Deutschen Bahn. Er zeigt, mit welchen Methoden Hartmut Mehdorn das Staatsunternehmen nach seinen Vorstellungen umbaut, wie er gegen Kritiker vorgeht und wie er zu einem der mächtigsten und umstrittensten Manager Deutschlands geworden ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 258
Veröffentlichungsjahr: 2008
Ähnliche
Markus Wacket
Mehdorn, die Bahn und die Börse
Markus Wacket
Mehdorn, die Bahn und die Börse
Wie der Bürger auf der Strecke bleibt
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-636-01572-3 | Print-Ausgabe
ISBN 978-3-86881-101-8 | E-Book-Ausgabe (PDF)
E-Book-Ausgabe (PDF): © 2009 by Redline Verlag, FinanzBuch Verlag GmbH, München.www.redline-verlag.de
Print-Ausgabe: © 2008 by Redline Wirtschaft, FinanzBuch Verlag GmbH, München.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Lektorat: Brigitte Mues, lüra – Klemt & Mues GbR, Wuppertal Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur GmbH, München Umschlagabbildung: Corbis, Düsseldorf Satz: M. Zech, Landsberg am Lech Printed in Austria
Inhalt
Einsteigen, bitte!1. Der Zug zur BörseHartmut Mehdorn – die Lokomotive Die Koalition der Unwilligen Wie viel Bahn kann sich der Staat leisten? Mit Netz und doppeltem Boden Bahn und Lufthansa – ein himmelweiter Unterschied2. Zwischen Bahntower und KanzleramtHartmut Mehdorns Macht Minister sind nicht für die Ewigkeit Operation „Blue Chip“ 3. Viel Feind, wenig Ehr’Ärger für die Bahnhofsmission Die Geschichte am Bahnsteig Die Kleinen müssen bluten Manfred Schell – der Lokomotivführer-Führer Sogenannte VerkehrsexpertenThilo Sarrazin – der Volksaktionär 4. Mehdorns MannenGetreue, Genossen und „Unionisten“ Warum Mehdorn seine Gewerkschaft so mag Starke Lobby: Berater, Beauftragte und Bevollmächtigte 5. Der Wettbewerb bleibt auf der StreckeWo der Platzhirsch röhrt Der Eisenbahn Dampf machen Nicht alle Kunden sind gleich Vom Netz genommen Das lukrative Spiel mit der Eisenbahn-Maut 300 Bahnen im Wettbewerb Der Staat hilft seiner DB – und schwächt die Eisenbahn 6. Die Bahn kommt: Trainieren für den KapitalmarktZüge sterben für die Börse: Aus für den Interregio Mehdorn verliert „PEP“ und gewinnt trotzdem Plan&Spar – wie die Bahn aus den roten Zahlen will Bloß weg von der Schiene: Laster, Schiffe, Flugzeuge 7. Der gescheiterte Börsengang 2006Anlauf zum großen Sprung Das Parlament probt den Aufstand Brieffeindschaft mit dem BDI Alles auf Rot 8. Ringen im Namen des VolkesDie große Koalition – Mehdorns kleine Chance Volksvertreter und Verräter Das Parlament – gar nicht Souverän Wir sind die Bahnfahrer Oktober-Resolution: Genossen stoppen Mehdorn 9. Endstation Börse?Zwischen Bürger- und Börsenbahn Was Mehdorn mit seiner Modellbahn machen würde Die Bahn wird anders – auch ohne Börse Ohne Netz und doppelten Boden Speedy Gonzalez und Lame Ducks – das Versagen der Politik Aussteigen, bitte!AnhangChronik – der lange Weg der Bahn zur Börse Literaturverzeichnis Studien und Gutachten Über den AutorEinsteigen, bitte!
Willkommen im „Sonderzug zur Börse“. Zum Verkauf steht das letzte große Unternehmen im Besitz der Bundesrepublik Deutschland. Jahrzehntelang das Schmuddel- und Sorgenkind der Politik, soll es herausgeputzt mit Milliarden des Steuerzahlers den gleichen Gang zum Kapitalmarkt antreten wie Post, Lufthansa oder Stromkonzerne vor ihm. Fast erscheint dieser inzwischen als natürlicher Weg aller Staatsbetriebe.
Doch der vorgezeichnete Weg ist holprig geworden. „Privat“ gilt nicht mehr automatisch als besser als der „Staat“. Nicht allein Linke, Globalisierungskritiker und Bundesbahnnostalgiker wehren sich, quer durch alle Parteien im Bundestag ist das Unbehagen gegen den Verkauf zu Widerstand geworden. Dazu hat der Mann an der Spitze der Deutschen Bahn seinen ganz eigenen Beitrag geleistet. Seit acht Jahren treibt Hartmut Mehdorn seine Vorstellungen und Pläne zum Börsenprojekt mit an Fanatismus grenzendem Elan voran, gegen alle Widerstände in Regierung, Parlament und im eigenen Konzern. Das hat ihn zugleich zum wohl bekanntesten wie umstrittensten Manager des Landes gemacht. Ganz nebenbei wird die Frage aufgeworfen, wo die Entscheidungen über die Zukunft der Eisenbahn getroffen werden. Im Bundestag, im Verkehrsministerium oder im Kanzleramt? Oder doch hoch oben in der gläsernen Konzernzentrale, von der aus Hartmut Mehdorn auf alle drei hinabblicken kann?
Aus der Suche nach einer Antwort auf diese Frage erwuchs die Idee zu diesem Buch. Es rückt Schwäche und Ohnmacht unserer Volksvertreter sowie Macht und Verbindungen eines Großkonzerns in den Blick – und dessen Grenzen. Es stellt die Verbündeten Hartmut Mehdorns vor und seine zahlreichen Feinde; es zeichnet seinen Börsenkurs nach und das, was der Kunde dafür zahlt; es zeigt auf, wie der Bürger auf der Strecke zu bleiben droht – und wie dies vielleicht noch verhindert werden kann.
Hier geht es nicht um irgendein Unternehmen. In jedem der letzten Jahre haben wir Steuerzahler fast 20 Milliarden Euro in das System Eisenbahn gesteckt, pro Jahr werden fast zwei Milliarden kurze und lange Reisen auf Schienen gemacht. Es geht nicht allein um die Deutsche Bahn AG, sondern auch um deren Konkurrenten, die den Steuerzahler entlasten und die Eisenbahn besser machen könnten. Denn die Bahn schont die Umwelt, schützt das Klima und spart Energie – und das fast unfallfrei.
Selbst denjenigen, die sie als zu spät, zu teuer und zu langsam schmähen, ist sie tief ins Unterbewusstsein gerollt. Zahllose Bilder hat sie in Sprache und Vorstellungen geprägt, sodass ein Autor schnell auf „ausgefahrenen Gleisen“ unterwegs ist, wenn wieder einmal die „Weichen gestellt“ werden oder „ausrangierte Politiker“ „aufs Abstellgleis“ geschickt werden. Es ist „höchste Eisenbahn“, die „Notbremse zu ziehen“, bevor dem Leser und Bahnkunden die Gesichtszüge „entgleisen“.
Alle besseren Geschichten beginnen am Bahnhof, hat Kurt Tucholsky einst geschrieben, und so wird auch diese dort ihren Anfang nehmen.
1. Der Zug zur Börse
„Im Grunde agieren wir bereits wie ein börsennotiertes Unternehmen, wir sind es nur noch nicht.
Diesen Schritt gilt es nun zu tun. Man muss sich an den Erfolgreichen orientieren.“
Hartmut Mehdorn – die Lokomotive
Der Mann hat es eilig. Es geht um seinen Traum. Mit kurzen, schnellen Schritten durchquert er die Eingangshalle, die Rolltreppe lässt er links liegen, hastet die Treppe hinauf, dann nach rechts durch die Glastür. Alles scheint hier aus Glas zu sein. Blickt er hinaus, sieht er in seinen Bahnhof. Hell, modern, effizient, sauber, kein Obdachloser weit und breit. Nicht einmal ein Zug. Nur Geschäfte und Boutiquen. So mag er es. Eigentlich ist die „Austernbar“ hier ein schöner Platz für eine Feier mit ein paar Kollegen aus dem Vorstand; man könnte in kleiner Runde auf die Aktie „B“ anstoßen, auf das erfolgreiche Börsendebüt der Deutschen Bahn. Ein Börsengang ist so etwas wie die Krönung für einen Manager, der Ritterschlag der Welt des Kapitals.
Es ist November und es ist kurz vor 9 Uhr morgens. Morgens feiert man nicht. Für Träume ist es schon ein bisschen spät und um seinen steht es ohnehin schlecht. Hartmut Mehdorn ist jetzt 64 Jahr alt. Er setzt sich mit dem Rücken zu den Boutiquen und blickt in die Gesichter seiner gut 25 Gäste. Fast alle Journalisten sind gekommen, und er weiß, warum: Weil das Projekt Börsengang zu scheitern droht, weil sie darauf lauern, dass er in wenigen Minuten von seinem Traum Abschied nimmt. Viele glauben, Hartmut Mehdorn geht gleich mit.
Niemand wird ihm vorwerfen, er habe nicht alles getan. Sieben Jahre hat er gerackert, sein Job gilt als der härteste in der deutschen Wirtschaft. Die Deutsche Bahn, ein Staatsunternehmen und Milliardengrab, angeblich unsanierbar mit zehntausenden Beamten. Regelmäßig landet er bei Umfragen zu Deutschlands Topmanagern ganz unten. Und doch hat er getan, was ein Mann in dieser Position tun muss: Er hat Zehntausende von Arbeitsplätzen gestrichen, hat sich von Kunden, Gewerkschaften und Mitarbeitern beschimpfen lassen. Er hat Manager gefeuert und fast alle Vorstandskollegen ausgetauscht. Er hat Verräter aufgespürt, angeprangert und gefeuert.
Aber er hat noch mehr getan als das, was andere auch machen: Er hat Machtkämpfe mit seinem Chefkontrolleur aus dem Aufsichtsrat gewonnen und seine Kunden ermahnt, ihren Müll gefälligst nicht in seinen Zügen liegen zu lassen. Er hat den Verkehrsminister entmachtet und sich mit den Schwestern der Bahnhofsmission verkracht. Er hat eine Bundesministerin öffentlich als unfähig bezeichnet und eine Ausstellung über jüdische Kinder auf dem Weg ins KZ vorerst verhindert.
Er hat in sieben Jahren wenige Worte der Entschuldigung verloren und viele Feinde gewonnen.
Sicher, er muss viel einstecken in Deutschland, „wo die Menschen als erste Fremdsprache das Meckern lernen“: Die Züge spät, langsam oder zu teuer, die Schaffner muffelig oder die Bahn ist ein arroganter Monopolist. Und schuld daran ist natürlich sein Börsengang. Dann wird zurück gerempelt, gerauft, geschubst und geschimpft. Eine Lok unter Volldampf, der Kessel glüht und das Ventil muss auf.
Wohl nur solch ein Mann kann etwas so Schwerfälliges wie ein Staatsunternehmen mit 230.000 Beschäftigen, mächtigen Gewerkschaften und Politikern als Bremsklötzen voranbringen. Dahin, wo die Freiheit für das Unternehmen nach Überzeugung des Flugzeugingenieurs fast grenzenlos ist: Auf den weltweiten Logistikmarkt, mit milliardenschweren Investoren im Rücken, Asien und Amerika vor Augen und keine Politiker mehr im Weg, für die er seine ICE-Züge in Horb oder Siegburg zum Halten bringen muss, wie ein Kaufmann den Wagen im Mittelalter an jeder Zollstation. Wie er sie verachtet, diese sogenannten Verkehrsexperten, die überall mitreden wollen und am Ende doch nur seine Modellbahn im Maßstab 1:1 kaputt machen.
Er ist kein Nadelstreifenjurist, er ist Ingenieur und Hobbyschmied mit schwieligen Händen, fühlt sich im Lokschuppen wohler als im runden Saal des Verkehrsausschusses, wo doch eigentlich über den Börsengang entschieden werden soll.
Das alles darf er in der „Austernbar“ jetzt nicht sagen, jedenfalls nicht so offen: Stattdessen spricht er von einem hervorragenden Bahnjahr, dass das Unternehmen gut unterwegs ist, im Jahr 2006 richtig gutes Geld verdient habe und – natürlich – für die Zukunft „gut aufgestellt ist“. Diese Botschaft geht ihm leicht von den Lippen.
Aber dann muss er etwas sagen, das ihm – so hat es den Anschein – offenbar vorher aufgeschrieben wurde. Dass er nicht wisse, ob die Politik die Kraft für eine Entscheidung zum Börsengang habe. Und auf Nachfrage, ob es das dann gewesen sei mit seinem Projekt, entfährt ihm ein Satz, den er sich scheinbar selbst verboten hatte. „Das ist möglicherweise das Wahrscheinlichste“, sagt er. „Es wäre für uns sehr misslich, wenn wir fünf Meter vor dem Ziel abgewunken würden.“ Und er selbst? Aufgabe, Rücktritt, mit Frau ins Haus nach Südfrankreich?
Die Antwort: Zunächst ein leichtes Wippen der Füße, das setzt sich in den beiden kurzen Beinen fort, überträgt sich auf die kräftigen Arme, bis die erstaunlich breiten Hände mit der Handkante auf den Tisch donnern. Warum werde er das immer gefragt, gebe es da nicht andere? „Ich bin kein Handtuchwerfer!“, ruft er mit gepresster Stimme, als ob je jemand daran gezweifelt hätte.
Er hat gesagt, was er sagen musste.
Hartmut Mehdorn ist jetzt wieder ruhiger. Schweift sein Blick durch die Scheiben von „Austernbar“ und Bahnhofsfassade, bleibt er am Kanzleramt hängen. Dort wird jedes seiner Worte registriert, gespeichert, analysiert. Er hat zwar in den vergangenen Jahren schon viel getan, zuletzt aber hat er alles versucht: Er hat Angela Merkel einen Brief geschrieben, einen sehr langen Brief. Abgeschickt vor einer Woche. Der Bahnchef schreibt gern. Dieser an die „Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin“ klingt nicht so, wie er sich gewöhnlich ausdrückt. Deutlich ist er trotzdem: „Der politische Diskussionsprozess hat sich von dem Ziel, dem Unternehmen DB AG den Weg in eine erfolgreiche Zukunft zu bereiten, entkoppelt.“ Besonders das Verhalten der Union mache ihm in der Frage der Bahnprivatisierung Sorge, schreibt er der CDU-Vorsitzenden. Mit deren Verhandlungsführern habe er kürzlich erneut sprechen müssen. Solche Positionen „sollten nicht ernsthaft von einem verantwortungsbewussten Eigentümer vertreten werden“, hat er die Kanzlerin belehrt. „Ich habe inzwischen große Zweifel, ob am Ende des politischen Prozesses überhaupt eine umsetzbare Privatisierungsentscheidung stehen wird.“
Zwei Milliarden Euro brauche die Bahn dann statt des Börsengeldes erstmal aus der Staatskasse. „Ich bitte um Verständnis, dass ich mich in Sorge um unseren erfolgreich arbeitenden Konzern so klar und direkt an Sie wende...“, hat er geschrieben. Die Bahn als gefräßiges Monster des Staatshaushaltes – das muss doch wirken, das ist doch seit Jahrzehnten der Schrecken aller deutschen Politiker.
Mehdorn gibt dem ZDF vor der „Austernbar“ noch ein Interview. Dann steckt er die starken Hände in die Taschen, auf dem Weg zurück nimmt er die Rolltreppe.
Die Koalition der Unwilligen
Wenige Wochen vorher, am 21. September 2006, rollte an eben diesem Berliner Hauptbahnhof ein Zug ein, den der Bahnchef wohl gern gestrichen hätte: Unter rot-weißen und mit DB-Logo bemalten Bettlaken stoppt eine Truppe von Bahnfans auf dem Vorplatz, um anschließend von „Investoren“ ausgeschlachtet zu werden. Versteigert mit einem überdimensionalen Papphammer gehen Filetstücke von Zug und Bahn scheibchenweise weg. Aus dem Streckennetz der DB, aufgemalt auf einem Transparent, werden die attraktivsten Trassen herausgeschnitten. Zum Beispiel die Hochgeschwindigkeitsstrecke Frankfurt – Köln, mit Milliarden vornehmlich aus Steuergeld gebaut. Junge Männer mit Haaren voller Gel stecken sie sich gierig ein – ganz offenkundig Heuschrecken in schwarzen Anzügen.
Das Happening der Globalisierungskritiker um „attac“ bleibt keine Einzelaktion. Wenig später treffen sich die Privatisierungsgegner zum Kongress in Berlin, mehrere Hundert füllten einen Kinosaal zur Premiere des Films „Bahn unterm Hammer“ – eines Plädoyers gegen den Verkauf und für die Staats- oder Bürgerbahn. In den Sesseln Kommunisten, PDS-Anhänger, ExBundesbahner, verärgerte Bahnkunden. Aber nicht nur: Im Bündnis „Bahn für Alle“ machen mehr als ein Dutzend Organisationen einschließlich der Umweltschützer vom BUND, des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) und der Gewerkschafter von IG Metall und Verdi mobil. Im Rahmenprogramm heizen linke SPD-Abgeordnete die Stimmung gegen die Verschleuderung öffentlichen Eigentums an. „Reisepläne“ im DB-Design wandern durch die Reihen mit der Parole „Höchste Eisenbahn – stoppt den Börsenwahn“. Eine erste Station für das Jahr 2007 weist der Plan hoffnungsvoll aus: „Der Bundestag verschiebt die Entscheidung um ein Jahr und prüft Alternativen zur Privatisierung der Bahn.“
Hier wird nicht über die Form einer Bahnprivatisierung debattiert – hier steht der Kapitalismus am Pranger und an diesem Abend hat er das Gesicht von Hartmut Mehdorn. Den größten Applaus im Saal gibt es, als sein sofortiger Rücktritt gefordert wird.
Die Organisatoren wissen, dass sie bestenfalls ein Kräuseln an der glatten Oberfläche des Projekts bewirken; aber sie setzen auf eine Welle im Land, die sich allmählich aufbaut und auf der sie eines Tages zu reiten hoffen: eine Welle des Widerwillens gegen den Verkauf von Lebensadern der öffentlichen Hand. Auf die Angst vor anonymen Fonds aus Übersee, einem massenhaften Verlust von Arbeitsplätzen und vor einem privat kontrollierten Monopol, das etwa in der Energiebranche durch überhöhte Strompreise genauso unbeliebt wie reich wurde. Eine Bürgerinitiative formt sich, eine außerparlamentarische Opposition gegen die Koalition von Bahn-Privatisierern.
Eine Bewegung mit unbequemen Fragen in jenem Herbst 2006: Wurde in den Parteien je ein Beschluss zum Bahn-Verkauf gefällt? Wurden Alternativen geprüft? Rechnet sich das Projekt für den Steuerzahler? Wer profitiert vom Börsengang? Was wird aus dem Schienennetz jenseits der Vorzeigestrecken und an welchen Bahnhöfen lassen Finanzinvestoren noch Züge halten? Wie viele Mitarbeiter verlieren ihren Job?
Für die Gegner des Börsengangs sind dies nur rhetorische Fragen, ein ideologisches Projekt, Ausdruck einer Modestimmung zur Privatisierung öffentlicher Infrastruktur. Sie glauben, dass Volksvermögen in kaum zu bezifferndem Ausmaß vernichtet wird: In den vergangenen über hundert Jahren hätten fünf Generationen von Deutschen diese Bahn aufgebaut und ein so dichtes Schienennetz geknüpft, dass es eine Bahn für alle möglich mache. Werte zwischen 100 und 200 Milliarden Euro seien geschaffen worden, die jetzt in der Hoffnung auf schnellen Gewinn verzockt würden.
Ihre Furcht: Die öffentliche Hand zieht sich aus dem letzten Großunternehmen im Dienst des Allgemeinwohls zurück. Private Investoren achten auf Rendite – aber Verkehrspolitik, die Umwelt und der Klimaschutz sind keine Kategorien für Beteiligungskapital. Die neuen Herren der Bahn werden die von Mehdorn ausgerufene Strategie zu einem weltweiten Logistikunternehmen vorantreiben, einem Mega-Konzern, in dem die Sonne nicht untergeht und die gute alte „Eisenbahn“ eine Randerscheinung sein wird. Die Bürgerbahn verfällt dem Börsenwahn, der „Global Player“ wird zum „Local Loser“, die Hafenterminals in China sind wichtiger als die Regionalbahn nach Cottbus.
Der Privatisierungszauber, demzufolge alles besser, kundenfreundlicher, billiger und flexibler sein soll, hat bei ihnen nie gewirkt. Wasser, Strom, Gas – das alles sind für sie Beispiele, wie sich vermeintlicher Zauber in einen Fluch wandelte. Bürgermeister bedauern öffentlich, dass sie Stromversorger verkauften und andere mühen sich, das Wasser wieder in eigener Regie fließen zu lassen.
Gefährlich ist die bunte Truppe damals noch nicht für Mehdorns Pläne, es sind Randfiguren im politischen Berlin, weit weg von den Hebeln der entscheidenden Stellwerke in Bundestag, Fraktions- und Parteispitzen und Regierung. Doch sie sprechen aus, was viele Abgeordnete in den Wahlkreisen an den Rändern der Republik wegen der Zwänge der großen Koalition nicht sagen dürfen. Es ist die Angst, abgehängt zu werden vom Netz einer Privatbahn und ein für alle Mal die Mitsprache zu verlieren.
Hans-Peter Friedrich ist keiner von ihnen. Nicht nur das CSU-Parteibuch trennt den Franken von attac-Aktivisten, der PDS oder Verdi. Er ist stellvertretender Fraktionschef, Mitglied einer Regierungspartei und Verhandlungsführer für die Union in Sachen Bahn. Er ist kein Privatisierungsgegner, sagt er. Er halte große Stücke auf den Bahnchef, sagt er auch.
Vielleicht galt er deswegen lange als dessen gefährlichster Gegner. Friedrich will die 34.000 Kilometer Schienen, die Bahnhöfe und die Stromversorgung der Züge – kurz „das Netz“ – verteidigen. Jenes Eigentum des Staates, in das der Steuerzahler jedes Jahr Milliarden fließen lässt. Wie für Autobahnen oder Kanäle. Und er wird weiter zahlen müssen, selbst wenn bei der Bahn Investoren aus Russland, Dubai oder China das Sagen haben. Für den Franken bleibt das Netz das Kerngebiet des Staates, besonders in der Marktwirtschaft. Friedrich kämpft wie Mehdorn – aber anders: Er ist ruhig, verbindlich im Ton, beweglich, ein Taktiker. Er weiß, er darf nicht nur dagegen sein, er muss auch für etwas sein, muss Kompromisse vorschlagen oder zumindest mittragen. Vom Zug der großen Koalition aus SPD und Union dürfen nicht zu viele abgekoppelt werden, das wird im Kanzleramt von ihm erwartet. Als letzten Ausweg kann er höchstens auf Zeit spielen.
Denn nach den Spielregeln der Regierenden in Berlins Mitte ist sein Verhandlungsmandat im Koalitionsvertrag klar geregelt. Dort steht, dass die Bahn verkauft wird – offen blieb nur das Wie. Das Papier sorgte im Herbst 2005 für Erstaunen unter Verkehrsexperten. Denn vorhergehende Entwürfe für den Vertrag sahen dies mitnichten vor. Das konnte den Herren im großen gläsernen Turm am Potsdamer Platz 2, dem Sitz der Bahnzentrale, nicht gefallen.
Wie der Privatisierungsauftrag seinen Weg in letzter Minute in den Regierungsfahrplan fand, darüber gehen die Darstellungen auseinander. Übereinstimmend wird jedoch berichtet, dass die Wortwahl Börsengang maßgeblich von zwei Politikern bestimmt wurde, die die Konsequenzen nicht mehr verantworten müssen: Der eine heißt Gerhard Schröder, damals Bundeskanzler und Duzfreund von Hartmut Mehdorn, den er auf seinen Posten gebracht hatte. Schröder war wenig später nicht nur Ex-Kanzler, sondern auch Ex-Parlamentarier. Doch selbst als Kanzler hätte er eine solche Formulierung nicht allein durchdrücken können, er brauchte Partner bei der Union und fand sie unter anderem in Otto Wiesheu, dem Verkehrs- und Wirtschaftsminister Bayerns. Wenige Wochen nach den feierlichen Unterschriften unter den Koalitionsvertrag gab Wiesheu seine politischen Ämter auf und wechselte für ein Millionengehalt in die Führung des größten Staatskonzerns der Republik – seitdem versucht er als rechte Hand Mehdorns und als Vorstand für politische Beziehungen den Börsengang nach den Wünschen seines Chefs durchzudrücken.
Im Reichstagsgebäude kennt die Börsen-Opposition längst keine Parteien mehr: Ob Friedrich oder die Linke der SPD – sie sind heimliche Mitglieder der Anti-Mehdorn-Fraktion, die ihre inoffiziellen Unterstützer überall hat. Bei der FDP, der Linkspartei oder den Grünen. Vor allem bei den zerrissenen Sozialdemokraten. Dort sehen sich viele zur Loyalität mit ihrem Minister Wolfgang Tiefensee gezwungen, der so schnell ins Lager Mehdorns wechselte. Nein, diese Bahnprivatisierung ist in Volk und Verkehrsausschuss so populär wie eine Steuererhöhung. Fast drei Viertel der Deutschen sprechen sich in Umfragen gegen sie aus. Zwischen den konkurrierenden Parteien zirkulieren vertrauliche Dokumente, Informationen werden ausgetauscht und an die Presse lanciert. Es ist eine kuriose Koalition aus attac-Aktivisten, PDSlern, Umweltbewegten, Fahrgastverbänden, Betriebsräten, SPD-Linken, FDP-Wirtschaftsliberalen, Industrievertretern sowie Konservativen und selbst Ministern – geeint in der Überzeugung, dass diese Privatisierung à la Mehdorn gestoppt werden muss.
Wie konnte unter diesen Vorzeichen ein solches Projekt Erfolg haben? Wer konnte es gegen diese Riesenkoalition der Gegner so weit vorantreiben, dass es nur noch eine Frage von Monaten schien, bis die erste Notierung der Aktie „DB“ an der Frankfurter Börsentafel leuchtete? Hartmut Mehdorn hat in diesem Spiel ein Gesicht und eine Meinung und die äußert er auch. Wolfgang Tiefensee vertritt als Bundesverkehrsminister die Regierung. Weitere Befürworter erkennt man kaum und hört sie selten, sie werden an den Spitzen von Ministerien, Fraktionen oder im Kanzleramt vermutet, ebenso bei großen internationalen Investmentbanken wie an der Gewerkschaftsspitze. Kaum jemand von ihnen spricht über dieses Thema gern öffentlich und schon gar nicht offen. In Arbeitsgruppen oder Fraktionssitzungen gibt es allenfalls Andeutungen. Halbsätze der Kanzlerin werden auf den Fluren analysiert, gedreht, gewendet und interpretiert. Ist der Bahnbörsengang nur eine Karte im großen Poker in Berlin, wo Arbeitslosenversicherung und Mindestlohn gegen Gesundheitsreform und Online-Durchsuchungen getauscht werden? Dieses Pokerspiel wird meist zwischen drei oder vier Mächtigen gespielt, keiner legt seine Karten offen. Die Privatisierung der Bahn kann eine aufschlussreiche Antwort auf die Frage geben, wer in diesem Land Entscheidungen trifft.
Die Bahn wird verkauft, so steht es im Koalitionsvertrag. Ein Bibeltext ist dies nicht, die Stimmung kann sich drehen – hoffen die einen und fürchtet der andere. Deshalb macht Hartmut Mehdorn hoch oben in der 25. Etage im Bahntower am Potsdamer Platz Druck.
Wie viel Bahn kann sich der Staat leisten?
Vermutlich hätte niemand Hartmut Mehdorn für den diplomatischen Dienst empfohlen. Doch wenn es eng wird, weiß er, welchen Nerv er treffen muss.
Er weiß, dass Angela Merkel viele Sorgen hat und die Bahn selten als Erstes in der wöchentlichen Kabinettssitzung behandelt wird. Es gibt die verfahrene Gesundheitsreform, die Pflegeversicherung, die Bildungsmisere und die fehlende Betreuung für Kleinkinder. Die Kanzlerin will das wichtigste Vorhaben der zweiten Phase ihrer Kanzlerschaft bis zu den Wahlen 2009 durchziehen – sie will nicht als Verliererin dastehen. Den Verkehrsminister weiß Mehdorn seit Ende 2006 an seiner Seite und es gibt keine Anzeichen dafür, dass die Aktivisten um attac, die SPD-Parteibasis oder gar die Linkspartei in der ausgefeilten Börsenstrategie eine Rolle spielen könnten. Und doch ist das Projekt Börsengang wieder einmal kurz vor der Ziellinie ins Stocken geraten, der Widerstand im Parlament und vor allem in Merkels Union verhärtet sich.
Mehdorn braucht die Kanzlerin jetzt. Er schreibt ihr daher einen Brief, der eher ein Gemälde mit zwei Motiven ist. Eines zeigt etwas Bedrohliches in düsteren Farben und deutlichen Worten, darüber liegt ein Beruhigendes: Es gibt ja ein Regierungsgutachten, das dem Bund beim Verkauf der Bahn Einnahmen von bis zu neun Milliarden Euro verspricht – auf einen Schlag – wenn sie nach dem Modell Mehdorn privatisiert wird. Und dies alles, ohne den Konzern umzukrempeln, ohne Unruhe im Betrieb zu schaffen und sogar mit Billigung der Gewerkschaft. Eine scheinbar verlockende Chance für jeden Regierungspolitiker, ein jahrzehntelanges, unkalkulierbares Risiko für den Haushalt auf stille Weise loszuwerden. Das scheint Mehdorns Ass im Ärmel zu sein.
Darunter schimmert das düstere Bild durch, das die andere Bahn zeigt, einen Betrieb in prekären Verhältnissen und vor allem einen, der ganz dringend Milliarden aus dem Bundeshaushalt braucht. Mehdorn lässt das alte Gespenst im Kanzleramt anklopfen, das dessen Bewohner seit Jahrzehnten immer wieder erschreckt hat.
„Wir können uns nur noch eines leisten – die Bundeswehr oder die Bundesbahn“, hatte schon Ex-Kanzler Helmut Schmidt einst gestöhnt. Und das hatte seinen Grund: Nachdem die Eisenbahn seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts einen weltweiten Boom erlebte und praktisch konkurrenzlos Kohle, Stahl und Menschen für die industrielle Revolution transportierte, änderte sich das nach dem Zweiten Weltkrieg dramatisch: Die Menschen des Wirtschaftswunders wollten Autofahren, der Lastwagen transportierte ihre Kühlschränke und folglich baute der Staat in erster Linie Straßen.
Im Osten ist es noch schlimmer: Zwar gibt es weder Wirtschaftswunder noch Autoboom, doch die Sowjets demontierten Gleise und transportieren sie als Beute ab. Wo früher zwei nebeneinander lagen, war plötzlich nur noch eins da. Der geplante Bau eines Hochgeschwindigkeitsnetzes in der DDR wird nie umgesetzt, die Züge zuckeln weiter durch den Arbeiter- und Bauernstaat; im Zweifel hat der Gütertransport für die volkseigenen Betriebe Vorrang.
Noch in den 20er-Jahren des vorigen Jahrhunderts beförderte die Eisenbahn in Deutschland rund 70 Prozent aller Güter, seit den 90er-Jahren sind es weniger als 20 Prozent. Auch im Personenverkehr dominiert das Auto mit über 80 Prozent. Während sich das Fernstraßennetz der Bundesrepublik zwischen 1949 und 1989 verdoppelt, schnurrt das DB-Netz von über 30.000 Kilometer auf noch 27.000 Kilometer zusammen.
Noch schneller als das Netz schrumpft, wachsen die Schulden der Bundesbahn: 1994 steht sie mit 34 Milliarden Euro in der Kreide und droht den Bundeshaushalt aufzufressen. Auf den ausgefahrenen Gleisen rumpeln Züge mit mehr als 40 Jahre alten Waggons verspätet in schmuddelige Bahnhöfe, wo nur noch der Drogenhandel blüht und immer weniger Reisende auf lustlose Schalterbeamte treffen. Die Bahn wird immer schlechter, weil sie immer schlechter wird. „Ein Dinosaurier im Schuldenmeer“, macht der damalige Bahnchef Heinz Dürr aus.
Nun kann ein Staat zwar ein sehr geduldiges Wesen sein, besonders wenn es um seine Behörden geht. Obwohl täglich Millionenbeträge auf unheimliche Weise auf Fluren und Gängen nahezu ohne Spuren ihre Nullen verlieren. Solche Haushalte des Bundes haben jedoch die Eigenschaft, dass ihre Schatten immer länger werden und es eines Tages den Finanzminister fröstelt. Bei der Bundesbahn wurde ihm eiskalt: Der Fehlbetrag des Jahres 1988 stieg auf fast vier Milliarden Mark, die Verschuldung betrug 43 Milliarden Mark. Mit den Einnahmen konnten nicht einmal die Löhne der Eisenbahner gezahlt werden.
Es war Zeit für eine Notoperation: Als 1989 im Auftrag der Regierung Experten zusammentraten, konnten sie auf der Intensivstation gleich einen weiteren Patienten mitbehandeln. Die deutsche Einheit brachte mit der Deutschen Reichsbahn zum verarmten Sorgenkind noch ein Geschwisterchen, dem es noch schlechter ging: Die Reichsbahn betrieb mit mehr Personal ein halb so großes, verschlissenes Netz mit halb so vielen Zügen wie die Bundesbahn.
Dabei war die Lage der Bundesbahn allein schon dramatischer als in offiziellen Papieren zu lesen war. Die Fachleute machten eine „kreative Buchführung“ mit einer systematischen Überbewertung aus. „Nach üblichen kaufmännischen Usancen bewertet, hätte die DB schon längst Konkurs anmelden müssen“, stellten sie in ihrem Abschlussbericht fest. Für Bundesbahn und Reichsbahn müsse der Bund für die nächsten zehn Jahre einen Finanzbedarf von über 400 Milliarden Mark einkalkulieren.
Tatsächlich beschloss die unionsgeführte Bundesregierung erschrocken mit Unterstützung aller Parteien – bis auf die PDS – 1993 den Bruch mit der Beamtenbahn. Die hoheitlichen Aufgaben der Behördenbahn wurden abgetrennt. Zurück blieb ein Unternehmen, das in vier Geschäftsbereiche gegliedert wurde: Fern-, Nah- und Güterverkehr sowie den Fahrweg, wie das Netz damals auch hieß, die später in einzelne Aktiengesellschaften unter dem Dach des Konzerns gewandelt wurden. Festgeschrieben wurde im Grundgesetz, dass das Netz – das wie die Straßen auf Dauer auf staatliche Hilfen angewiesen war – mit über 50 Prozent im Bundesbesitz bleiben muss. Damit sollte das ebenso teure wie entscheidende Instrument für die Verkehrspolitik unter Kontrolle des Staates bleiben.
Siehe Tabelle
Der Aufbau der DB nach den Beschlüssen der Bahnreform 1994
Befreit war die neue DB AG mit der Bahnreform nun von Pflichtaufgaben für das Gemeinwohl, die keine Rendite bringen und die der Staat künftig direkt subventionierte – also in erster Linie das Netz sowie den Nahverkehr, der für die Bürger erschwinglich bleiben musste. Mehr Klarheit sollte herrschen zwischen dem, was das Unternehmen selbst leisten konnte und dem, was der Staat für seine Bürger tun wollte. Am 5. Januar 1994 wurde das Neugeborene am Amtsgericht Berlin-Charlottenburg unter der Nummer 50 000 in das Handelsregister eingetragen. Die Deutsche Bahn ist damit eine Aktiengesellschaft, wenn auch zu 100 Prozent im Staatsbesitz. Ihre Aufgabe ist es, effektiv zu arbeiten und Gewinn zu machen. Ein Börsengang schwingt als langfristige Möglichkeit mit.
Als Starthilfe wurden dem neuen Unternehmen schwere Hypotheken abgenommen: Schulden von 34 Milliarden Euro – schulterte der Bund. Die Modernisierung der Reichsbahn – zahlte der Steuerzahler. Die höheren Bezüge der Beamten gegenüber Angestellten der Deutschen Bahn – finanziert der Bürger ebenso wie den Nahverkehr. „Mit der Bahnreform kam eine neue weiße Decke auf den Tisch“, fasst das Hartmut Mehdorn zusammen.
Ziel ist es vor allem, mehr Verkehr auf die Schiene zu holen, die der Bürger so teuer finanzierte. Das sollte in erster Linie die neue Deutsche Bahn AG schaffen, die nun entlastet und beweglicher in die Offensive gehen sollte. Aber das war nicht alles. Die Schiene wurde für alle geöffnet.
Der Nahverkehr, mit dem mehr als 90 Prozent aller Bahnreisenden unterwegs ist, zum Beispiel die Berufspendler, sollte günstiger und besser werden, indem die DB auf den eigenen Gleisen Konkurrenz bekam. Die Bundesländer schrieben Strecken und Verbindungen aus, um die sich dann verschiedene Eisenbahnen bewarben. Die beste Bahn erhält den Zuschlag, lautete das Konzept. Das konnten, mussten aber nicht die rot-weißen Züge der DB sein. Angelegt war darin einer der großen Streitpunkte der nächsten Jahre: Welches Unternehmen – zudem mit dem Ziel Börse – lässt schon gern Konkurrenten auf seinem eigenen Hof – dem Netz – Geschäfte machen?
In den Schattenhaushalt des Bundes fiel mit der Bahnreform zwar ein greller Lichtschein – billiger wurde es für den Steuerzahler jedoch erst einmal nicht. Im Gegenteil: Die Jahre 1994 bis 2004 sollten die bislang teuersten werden. Rund 200 Milliarden Euro wurden in die das System Bahn gepumpt – das ist fast jeder zehnte Euro des Bundeshaushaltes.1 Langfristig aber, so hatten die Konstrukteure der Reform gehofft, bekomme der Bürger eine effizientere und billigere Eisenbahn.
Zwar wies die Deutsche Bahn in den nächsten Jahren keine Verluste mehr aus, die Schulden jedoch stiegen, die große Wende in der Verkehrspolitik blieb aus, an der Dominanz der Straße änderte sich nichts. Die Hoffnung, mit der Reform einen gleich starken Konkurrenten für Auto und Lastwagen geschaffen zu haben, zerstob schnell als Illusion. Der Konkurrenzkampf zwischen Auto- und Bahnlobby um das immer knappere Geld des Staates tobte indes weiter: Ist es nicht für die Straße viel effektiver eingesetzt, zumal der Autoverkehr schier unaufhaltsam zu wachsen scheint, der Verkehrsinfarkt verhindert werden muss und die Zeit der Eisenbahn doch wohl endgültig vorbei ist?
Andererseits: Zeigen nicht gerade die verstopften Straßen, dass der Staat gar nicht so schnell so viel Geld verbauen kann, wie der Verkehr weiterwächst? Die Mobilität von Menschen und Maschinen entwickelt sich vor allem seit den 80er-Jahren rapide: Lastwagen werden zu rollenden Lagern, um Bauteile oder Rohstoffe „just in time“ in die Fabriken zu bringen. Aber erst als sich in den 90er-Jahren die Grenzen nach Osten öffnen, werden die Schranken des Verkehrswachstums unübersehbar: Vor Frankfurt an der Oder warten über 60 Kilometer hinweg aufgereiht Stoßstange an Stoßstange Laster mit den Kennzeichen Litauens, der Ukraine oder Weißrusslands. Auf der Autobahn parken sie auf der rechten Fahrspur, denn Standstreifen sind noch nicht gebaut. Die Staumeldungen im Radio sind länger als die Nachrichten.
Dazu kursieren Studien, die Politikern den Schweiß auf die Stirn treiben: Bis zum Jahr 2015 soll der Personenverkehr im Vergleich zu 1997 noch einmal um ein Fünftel wachsen. Der Güterverkehr im Transitland der Mitte Europas lege gar um 64 Prozent zu. Selbst Vertreter der Autoindustrie räumen ein, dass die Straße dies nicht bewältigen kann.
Zudem rücken zur Jahrtausendwende weitere Fakten ins Blickfeld der Öffentlichkeit, die früher hauptsächlich in Nischen der Umweltbewegten diskutiert wurden: Das Weltklima erwärmt sich und dafür ist das Treibhausgas Kohlendioxid verantwortlich. Autos und Lastwagen stoßen davon jedes Jahr Millionen Tonnen aus und bringen Deutschland in Schwierigkeiten, seine Zusagen beim Klimaschutz einzuhalten. Bahnfahren verursacht nur etwa ein Drittel des Kohlendioxids, das ein Autofahrer in die Luft bläst. Beim Energieeinsatz ist das Verhältnis ähnlich. Neben Kraftwerken und Heizungen sind es Autos und Laster, die in Deutschland den größten Beitrag zum Aufheizen der Atmosphäre liefern. Aus den Auspuffrohren der Diesel entweichen feine Rußpartikel, die sich in der Lunge festsetzen und Krebs auslösen. Und schließlich wird die deutsche Abhängigkeit vom Öl nirgends so deutlich wie an den Zapfsäulen.
Doch wie können zugleich die verkehrs- und klimapolitischen Ziele erreicht, Schienen und Straßen gebaut, die Bahn saniert und das Ausbluten der Staatskasse gebremst werden? Auf der Suche nach der Antwort tritt 1999 eine Kommission zusammen: Vorsitzender wird Wilhelm Pällmann, ehemaliger Vorstand der Staatsunternehmen Bundesbahn und Bundespost. Hartmut Mehdorn tritt seinen Chefposten bei der Bahn erst zwei Monate später an, er ist nicht dabei. Er wird das bereuen.
Seinen Auftraggeber Bundesregierung zu schonen, plant Pällmann nicht. Im Sommer 2000 legt er seinen Bericht vor, der ebenso radikal wie konsequent ist.
Die Diagnose für den Patienten Bahn und damit der wenige Jahre alten Reform fällt vernichtend aus: Alle Sanierungsversuche seien bisher gescheitert, heißt es, die Verkehrsleistungen erbärmlich. „Der Personenfernverkehr zeigt nur bescheidene Wachstumsraten, der Güterverkehr bewegt sich auf einer Talfahrt in Mengen und vor allem in Erträgen.“ Die Lage ist ernst: „Die finanzielle Situation der DB AG ist infolge der Ertragsschwäche und darüber hinaus erheblicher Kostensteigerungen bei Neubauvorhaben sehr angespannt.“
Allein mit den seit der Bahnreform fälligen Gebühren der DB-Töchter oder ihrer wenigen Konkurrenten für die Nutzung der Schienen – sozusagen die Maut der Eisenbahn – sei das dichtmaschige deutsche Schienennetz nicht zu bezahlen, geschweige denn auszubauen. Es müsse weiter Steuergeld fließen, macht Pällmann klar. Die Frage stelle sich also: „Wie viel Bahn will sich die Bundesrepublik leisten?“ Und: „Wie muss die Bahn aussehen, die sie sich leisten will?“