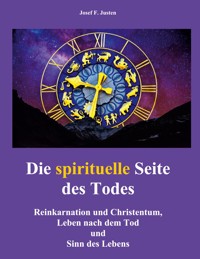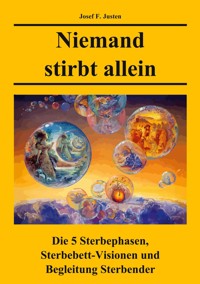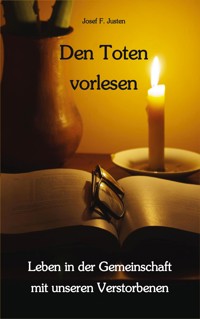3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Johann Mitterweger wächst in einem kleinen Ort im Bayerischen Wald auf. Nach dem Tod seines Vaters übernimmt er dessen kleine Tischlerei. Johann ist ein sehr gläubiger Mensch. Nachdem er von einigen schweren Schicksalsschlägen heimgesucht wurde, verliert er seinen Glauben. Er sieht in seinem Leben keinen Sinn mehr und möchte dieses mit eigener Hand beenden. Kurz bevor er zu dieser schrecklichen Tat schreitet, wird ihm eine große Gnade zuteil: Sein Schutzengel offenbart sich ihm. Insgesamt sieben Mal meldet sich sein Engel bei ihm. In diesen äußerst bewegenden Gesprächen berichtet er Johann von großen göttlich-geistigen Wahrheiten. Dadurch wird es ihm möglich, sein Leid und den Sinn des Lebens besser verstehen zu können. Johann kann durch die Belehrungen seines Engels seinen Lebensmut wiederfinden und seinem Leben nun eine ganz andere Richtung geben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 183
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Engel erwarten für ihre Dienste keinen Dank, sie wollen nur wahrgenommen werden.
Andreas Tenzer
Vermutlich werden Sie gar nicht mehr wissen, was Sie am 27. November 2011 gemacht haben. Höchstwahrscheinlich war es für Sie ein Tag wie jeder andere.
Für mich war dieser Tag einer, den ich niemals vergessen werde!
Sicherlich werden auch Sie schon auf ein paar Tage Ihres Lebens zurückblicken können, die Ihnen immer unvergesslich bleiben.
Aber einen Tag, an dem das Schicksal in so unerwarteter und segensreicher Weise ins Leben eingreift, werden wohl nur wenige Menschen jemals erlebt haben.
Bis zu diesem denkwürdigen Tag hatte mein Schicksal mir oftmals durchaus unerfreuliche und schmerzhafte Erfahrungen beschert, so dass ich mit ihm hadern zu müssen glaubte. Nun aber zeigte es sich auf eine ganz andere Art, eine Art, die ich nie für möglich gehalten hätte.
Dieser 27. November sollte mein Leben von Grund auf verändern. Er war für mich wie ein zweiter Geburtstag!
Was an diesem höchst ungewöhnlichen Tag geschah und was sich ab diesem in meinem Leben änderte, könnten Sie nicht verstehen, wenn ich Ihnen zuvor nicht in aller Kürze über mein Leben, das ich bis zu jenem Tag geführt hatte, schildern würde.
* * * * * * *
Also, ich wurde am 8. Februar 1965 in einem Dorf im Bayerischen Wald, in der Nähe der Grenze zur ehemaligen Tschechoslowakei, dem heutigen Tschechien, als einziges Kind meiner Eltern, Alfons und Elisabeth Mitterweger, geboren.
Wir wohnten in einem kleinen Haus am Rande eines großen Waldgebietes. Zum Haus gehörte eine Tischlerwerkstatt, die ebenfalls nicht gerade groß war. Hier ging mein Vater schon in der dritten Generation dem Tischlerhandwerk nach. In erster Linie fertigte, reparierte und restaurierte er Kleinmöbel.
Meine Eltern hatten die Hoffnung, ein Kind bekommen zu können, schon fast ein wenig aufgegeben. Um so glücklicher waren sie dann, als ich zur Welt kam. Zu diesem Zeitpunkt war meine Mutter immerhin schon 43 Jahre alt. Mein Vater war ein Jahr jünger. Ich wurde in der kleinen katholischen Dorfkirche auf den Namen Johann, den schon der Vater meines Vaters trug, getauft.
Wie die meisten Menschen in dieser Gegend waren auch meine Eltern sehr fromme Leute. Ein Sonn- oder Feiertag wäre ohne den Besuch der Heiligen Messe nicht denkbar gewesen. Schon ab dem Zeitpunkt, als ich etwa zwei Jahre alt war, nahmen mich meine Eltern immer mit in die Kirche.
Die feierliche Stimmung des Gottesdienstes hat mein kindliches Gemüt stets sehr ergriffen.
Daheim wurde sehr regelmäßig gebetet. Vor und nach jeder Mahlzeit war ein Tischgebet an der Tagesordnung. Wenn ich ins Bett musste, setzte sich meine Mutter noch eine Weile zu mir und sprach für mich ein Abendgebet.
Etwas später sprach ich es dann mit ihr zusammen, noch später allein.
An den Text kann ich mich heute noch gut erinnern:
Heiliger Schutzengel mein,
lass mich Dir empfohlen sein.
In allen Nöten steh mir bei
und halte mich von Sünden frei.
Du hast mich lieb, ich liebe Dich,
so soll es bleiben ewiglich.
Bei Tag und Nacht, ich bitte Dich,
begleite und beschütze mich.
Meine Mutter las mir vor dem Zubettgehen oftmals Märchen und auch Geschichten mit religiösen Motiven vor. Diejenigen Erzählungen, die von Engeln handelten, fanden stets mein besonderes Interesse.
Im Alter von drei oder vier Jahren fragte ich meine Mutter einmal, wer eigentlich der »Schutzengel«, zu dem ich jeden Abend betete, sei.
Sie antwortete: »Der Schutzengel ist ein ganz, ganz liebes himmlisches Wesen mit einem langen weißen Kleid, langen goldenen Haaren und großen goldenen Flügeln. Der liebe Gott schickt ihn zu den Menschen, damit er auf sie aufpasst und sie beschützt. Mit Menschenaugen kann man den Engel leider nicht sehen. Man kann ihn nur mit dem Herzen schauen.«
»Ja, kann der Schutzengel denn auf alle Menschen aufpassen?«, wollte ich wissen.
»Nein, selbstverständlich nicht! Jeder Mensch hat seinen eigenen Schutzengel.«
»Kann ich mit meinem Schutzengel auch sprechen?«
»Ja, du kannst ihm alles anvertrauen und ihm alles sagen, was dir auf dem Herzen liegt, so wie du dem lieben Gott auch alles sagen kannst. Nur können wir leider nicht verstehen, was er uns sagt. Wir können es aber fühlen.«
Dieses Gespräch fand in der Adventszeit statt. Am Firmament hatte sich gerade ein phantastisches Abendrot abgezeichnet. Meine Mutter führte mich ans Fenster, zeigte auf das Schauspiel und sagte: »Schau mal Hansi, siehst du das große Feuer am Himmel? Da backen jetzt gerade die Engel die Plätzchen, die das Christkind dann Weihnachten den Kindern bringt.«
Ich war ganz fasziniert und fragte: »Ist mein Engel auch dabei?«
»Nein, das sind andere Engel. Dein Schutzengel hat ja genug damit zu tun, auf dich achtzugeben!«
Alle diese Erklärungen meiner Mutter lösten eine große Freude in mir aus: »Jetzt habe ich jemanden, dem ich alles anvertrauen und mit dem ich über alles sprechen kann.«
In der Tat hatte ich von nun an einen unsichtbaren und unhörbaren Freund, dem ich immer wieder mein Herz ausschütten konnte. Über viele Jahre hinweg erzählte ich ihm alles, was mich bewegte und bedrückte. Auch in meine Dankgebete schloss ich ihn ein.
Wann immer ich in den nächsten paar Jahren am Weihnachtsfest auf meinem bescheidenen Gabentisch einen Teller mit Gebackenem vorfand, bedankte ich mich bei den Engeln, dass sie mir so leckere Plätzchen gebacken hatten.
An dem Weihnachtstag vor meiner Einschulung schenkten meine Eltern mir eine Engelfigur aus Ton. Der Engel sah genau so aus, wie meine Mutter ihn mir beschrieben hatte: Er trug ein langes weißes Kleid, goldene Haare und große goldene Flügel.
Nun konnte ich also auch meinen Engel sehen, wenn ich mit ihm redete.
Dann wurde ich mit sechs Jahren eingeschult. Die Schule lag drei Kilometer von unserem Haus entfernt. Einen Schulbus gab es nicht. So musste ich die Strecke täglich zu Fuß zurücklegen, was mir aber nichts ausmachte, zumal ich von einigen Mitschülern, die in der Nachbarschaft wohnten, begleitet wurde.
Das Lernen machte mir Spaß. Ich kam ganz gut voran. Nachmittags, wenn ich mit den Hausaufgaben fertig war, strolchte ich meistens mit einigen Freunden im Wald herum. Häufig kletterten wir Bäume hinauf. Das machte mir besonders viel Spaß. Kein Baum konnte mir hoch genug sein.
Manchmal unterhielten wir uns über unsere Schutzengel. Je älter ich wurde, desto mehr musste ich feststellen, dass viele meiner Freunde nicht mehr an ihn glaubten. Einer meiner Schulfreunde sagte einmal: »An Engel glauben nur Babys!«
Nun gewöhnte ich es mir langsam ab, im Beisein anderer über meinen Engel zu reden. Schließlich wollte ich nicht, dass mich meine Freunde für ein ›Baby‹ hielten.
Als ich dann so acht oder neun Jahre alt war, spielte mein Schutzengel eine immer geringere Rolle in meinem Leben. Nur noch selten bezog ich ihn in meine Gedanken und Vorstellungen ein. Allerdings betete ich noch recht regelmäßig zu ihm, wenngleich ich das mehr aus Gewohnheit machte.
Zu meinem zehnten Geburtstag schenkten meine Eltern mir ein Taschenmesser. Ich suchte mir jetzt häufig im Wald einen geeigneten Ast, der als Spazierstock umfunktioniert werden konnte. Diesen verzierte ich mit schönen Schnitzereien. Mein Vater lobte mich häufig für das Ergebnis meiner Arbeit, auch wenn diese noch weit von einer Perfektion entfernt war.
Insgesamt war es eine schöne und recht unbeschwerte Kindheit.
Kurz nachdem ich zehn Jahre alt geworden war, endete meine Zeit in der Grundschule. Einige meiner Klassenkameraden wechselten jetzt auf die Realschule oder sogar aufs Gymnasium. Mein Klassenlehrer meinte, dass ich nicht unbedingt das Zeug für eine höhere Schule habe und später lieber einen handwerklichen Beruf ergreifen solle. Somit ging ich dann noch fünf Jahre auf die Hauptschule.
Etwa zwei Jahre, nachdem ich auf die Hauptschule gewechselt war, verspürte ich plötzlich ein höchst sonderbares Bedürfnis: Ich wollte unbedingt die tschechische Sprache erlernen.
Ich konnte es mir eigentlich selbst nicht erklären. Obwohl Lernen und Lesen nicht unbedingt zu meinen Lieblingsbeschäftigungen zählten, war der Drang so stark, dass ich mir einige Lehrbücher kaufte und mich immer wieder in sie vertiefte.
Meine Eltern konnten mein Interesse nicht nachvollziehen. Meine Mutter meinte: »Warum lernst du nicht irgendeine andere Sprache, mit der du später etwas anfangen kannst. Wegen des Kalten Krieges kannst du ohnehin nicht in die Tschechoslowakei reisen. Also, wo und mit wem willst du tschechisch reden?«
Aber ich ließ mich nicht beirren. Schon nach drei, vier Jahren beherrschte ich die Sprache recht gut.
Leider gab es nur selten die Gelegenheit, meine neuen Kenntnisse in Gesprächen mit anderen Menschen einzusetzen. Allerdings bekam ich später einen neuen Sportlehrer, der vor Jahren aus der Tschechoslowakei ausgewandert war. Mit ihm konnte ich mich hin und wieder in seiner Muttersprache unterhalten. Er war immer voll des Lobes über mein Tschechisch.
Im vorletzten Jahr meiner Schulzeit fuhr ich mit meiner Klasse für eine Woche in ein Schullandheim nach Hessen. Die Schulleitung hatte für die Fahrt ein Busunternehmen beauftragt.
Auf der Rückfahrt – wir waren schon fast wieder daheim – verspürte ich plötzlich so eine Art Drang, meinen Platz im Bus zu wechseln. Während ich die ganze Zeit zuvor auf der rechten Seite saß, wählte ich nun einen freien Platz auf der linken. Ich kann nicht wirklich sagen, was mich dazu veranlasst hatte.
Kurze Zeit später kam es zu einem ganz fürchterlichen Unglück: Der Bus kam von der Fahrbahn ab, stürzte eine Böschung hinunter und blieb auf der rechten Seite liegen.
Viele Mitschüler – insbesondere diejenigen, die auf der rechten Seite saßen – wurden schwer verletzt. Zwei starben.
Ich kam mit dem Schrecken sowie Prellungen und ein paar Kratzern davon.
Ich hatte riesengroßes Glück!
Mit fünfzehn Jahren schloss ich meine Schulzeit ab. Ich hatte mir nie große Gedanken darüber gemacht, welchen Beruf ich ergreifen könnte. Zum einen waren in unserer Gegend geeignete Lehrstellen dünn gesät, zum anderen war eigentlich klar, dass ich bei meinem Vater das Tischlerhandwerk lernen werde. Für meinen Vater stand immer fest, dass ich später den kleinen Betrieb übernehmen sollte. Deshalb wäre es für ihn auch nie eine Option gewesen, mich auf ein Gymnasium zu schicken.
So kam es dann auch.
In den nächsten drei Jahren bildete mich mein Vater zum Tischler aus. Er war ein strenger, aber auch sehr gütiger Lehrmeister. Einen besseren hätte ich mir nicht wünschen können. Schon früh zeigte ich Geschick für diese Tätigkeit, die mir auch durchaus Freude bereitete.
Mein Plan war es, nach der Ausbildung noch etwa ein Jahr in der väterlichen Werkstatt zu arbeiten. Dann wollte ich mir irgendwo in einer Stadt eine Stelle als Tischler in einem größeren Betrieb suchen. Da der Betrieb meines Vaters nicht viel abwarf, hätte ich im Grunde kein eigenes Einkommen gehabt. Später, wenn mein Vater sich aus Altersgründen zur Ruhe setzen würde, könnte ich immer noch seine Tischlerei übernehmen, dachte ich.
Aber es sollte anders kommen.
Kurz nach Abschluss meiner Ausbildung starb mein Vater. Sein Tod kam recht überraschend, zumal er nie ernsthaft krank und erst sechzig Jahre alt war.
Es blieb mir jetzt nichts anderes übrig, als den Betrieb zu übernehmen. Da mein Vater mich sehr gut ausgebildet hatte, fand ich mich auch schnell bestens zurecht.
Allerdings florierte das Geschäft nicht gerade. Die Leute aus der näheren Umgebung, also die potentiellen Kunden, waren durchweg recht arm, so dass sie sich keine teuren neuen Möbel leisten konnten. Allenfalls gaben sie mal ein Kleinmöbelstück in Auftrag. Meistens brauchten sie mich aber nur, um alte Möbel zu restaurieren oder ein wenig aufzuhübschen.
Es kam mir jetzt nicht mehr in den Sinn, den Betrieb aufzugeben und mir in der Stadt eine besser dotierte Stelle zu suchen. Zum einen wollte ich meine Mutter nicht allein lassen, zum anderen fühlte ich mich der Familientradition verpflichtet.
Das, was die Tischlerei abwarf, war – wie man so schön sagt – zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Dennoch kamen meine Mutter und ich finanziell immer einigermaßen über die Runden. Meine Mutter hatte schon vor vielen Jahren ein großes Gemüsebeet in unserem Garten angelegt. Außerdem hatten wir einige Hühner, so dass wir uns zumindest mit Kartoffeln, Gemüse, Salat und Eiern selbst versorgen konnten.
Als ich 21 Jahre alt war, kam eines Tages eine junge Frau in meine Werkstatt. Sie brachte einen Stuhl vorbei und bat mich, das abgebrochene Bein durch ein neues zu ersetzen.
Die sehr attraktive Dame mit ihren auffallend langen hellblonden Haaren hatte ich schon hin und wieder in der Kirche oder auf dem Kirchplatz wahrgenommen. Auch meinte ich, sie vor Jahren schon mal auf dem Schulhof gesehen zu haben. Aber ich kannte sie nicht wirklich.
Ich sagte ihr, dass sie den Stuhl in drei Tagen wieder abholen könne.
In diesen drei Tagen ging mir die hübsche Dame nicht mehr aus dem Kopf. Als sie dann kam, um den reparierten Stuhl in Empfang zu nehmen, sagte ich: »Wenn Sie nächsten Sonntag mit mir nach der Kirche einen Spaziergang machen, brauchen Sie nichts zu bezahlen.«
Sie lächelte etwas verlegen und antwortete: »Sie hatten doch Arbeit! Also werde ich Sie auch entlohnen. Aber mit dem Spaziergang bin ich trotzdem einverstanden. Das können Sie als Ihr Trinkgeld auffassen.«
Meine Freude über diese Zusage sowie meine Vorfreude auf den nächsten Sonntag waren riesengroß.
Am folgenden Sonntag sah ich sie schon während des Gottesdienstes. Im Anschluss erwartete ich sie auf dem Kirchplatz.
Zielstrebig kam sie auf mich zu und sagte mit einem Lächeln: »Hallo, ich bin die Magdalena Oberhuber. Ich bringe Ihnen Ihr Trinkgeld!«
»Grüß Sie, ich heiße Johann Mitterweger. So ein großzügiges Trinkgeld habe ich noch nie bekommen!«
Dann begaben wir uns auf einen gut zweistündigen Spaziergang. Wir waren uns gleich sehr sympathisch und kamen überein, uns zu duzen. Wir unterhielten uns sehr angeregt. So wie Magdalena unterwegs einiges über mich erfuhr, erfuhr ich einiges über sie.
Sie war knapp ein Jahr jünger als ich und lebte bei ihren Großeltern im Nachbardorf. Sie war schon seit ihrer frühen Kindheit Vollwaise.
In der Tat hatte sie die gleiche Schule wie ich besucht, allerdings eine Klasse unter meiner. Nach dem Schulabschluss machte sie eine Lehre zur Einzelhandelskauffrau in einem Blumengeschäft, in dem sie auch jetzt noch als Verkäuferin arbeitete.
Schon bald wurde aus dieser Bekanntschaft erst Freundschaft, dann Liebe.
An den Wochenenden gingen wir viel spazieren und manchmal auch zum Tanzen. Oft verbrachten wir die Abende bei mir oder bei ihr daheim. Magdalena und meine Mutter mochten sich vom ersten Tage an. Auch ich kam mit ihren Großeltern ganz gut aus.
Irgendwie war sowohl Magdalena als auch mir schon bald klar, den Partner fürs Leben gefunden zu haben.
Bereits im Jahr darauf schlossen wir in der Dorfkirche den Bund fürs Leben.
Als ich meine Braut am Altar sah, dachte ich: »Ihr fehlen nur noch die goldenen Flügel. Dann sähe sie so aus, wie ich mir früher immer meinen Schutzengel vorgestellt habe!«
Da auch Magdalena und ihre Großeltern nicht gerade betucht waren, hatte sie sich ihr Hochzeitskleid von einer Cousine geliehen. Den schwarzen Anzug, den ich trug, hatte ich mir vor Jahren anlässlich der Beerdigung meines Vaters gekauft.
Nach der Heirat zog Magdalena zu mir und meiner Mutter in unser bescheidenes Häuschen. Wir waren vom ersten Tage an sehr glücklich miteinander.
Magdalena war sehr geschäftstüchtig und hatte häufig ganz ausgezeichnete Ideen. Als wir eines Abends in der Küche saßen, sagte sie: »Du Hansi, du bastelst doch gerne. Hättest du nicht Lust, Spielzeug und Christbaumschmuck aus Holz anzufertigen? Bei deinem handwerklichen Geschick und deiner Phantasie würden da bestimmt ganz tolle Sachen entstehen! Wir könnten das dann in der Werkstatt anbieten. Du wirst sehen, die Leute mögen so etwas. Was hältst du davon?«
Ich fand die Idee genial, hatte aber so meine Zweifel, ob die Leute aus der Nachbarschaft sich das leisten könnten.
Wie auch immer – schon in der nächsten Woche machte ich mich an nahezu jedem Abend ans Werk. Ich bastelte Holzautos, Holztrecker und vieles mehr. Magdalena malte alles farbig an.
In der Tischlerei teilten wir eine Ecke ab, in die wir ein Regal und einen kleinen Tisch als Theke postierten. In das Regal stellten wir unsere Werke. Jetzt hatten wir also einen kleinen Verkaufsladen.
Magdalena gab ihren Job im Blumengeschäft auf und wartete den ganzen Tag auf Kundschaft.
Die Leute, die jetzt kamen, um beispielsweise ihre Möbel reparieren zu lassen, wurden auf das Spielzeug aufmerksam und kauften hin und wieder auch etwas.
Es sprach sich herum, so dass in den nächsten Monaten auch viele Kunden von weiter her kamen und Holzspielzeug kauften.
Im Oktober des nächsten Jahres produzierten wir erstmals Christbaumschmuck aus Holz: Sterne, Tannenbäume – und natürlich Engel. In der folgenden Adventszeit verkauften sich diese erstaunlich gut.
Wir fertigten jetzt immer mehr Weihnachtsschmuck aus Holz, den wir in der Adventszeit insbesondere auf Weihnachtsmärkten der näheren und auch weiteren Umgebung feilboten. Es war ein sehr gutes Geschäft. Auf diese Weise machten wir in den kommenden Jahren in der Vorweihnachtszeit meistens einen doppelt so großen Umsatz wie im gesamten Jahr mit meinem eigentlichen Kerngeschäft.
Auch erinnerte ich mich wieder daran, dass ich als Kind gern Spazierstöcke geschnitzt hatte. Ich griff dieses Hobby nun wieder auf. Natürlich kaufte ich mir jetzt ein professionelles Schnitzmesser. Die fertigen Stöcke gaben wir in ein Geschäft, das vorwiegend Artikel für Touristen im Sortiment hatte, auf Kommission. Sie verkauften sich ebenfalls ganz gut.
Knapp drei Jahre nach unserer Hochzeit machte mir meine Frau die freudige Mitteilung, dass sie schwanger war. Wir freuten uns beide riesig auf die Geburt unseres Kindes.
Dann war es so weit. Magdalena wurde von einem gesunden Mädchen entbunden.
Als wir gemeinsam überlegten, welchen Namen wir ihr geben wollten, kam mir ganz spontan die Idee: »Was hältst du davon, wenn wir unsere Tochter auf den Namen Angela, was ja so viel wie ›Engel‹ bedeutet, taufen lassen?«
Magdalena war sofort einverstanden: »Der Name passt sehr gut! Sie ist ja wirklich unser kleiner Engel.«
Von Anfang an stand fest, dass Angela unser einziges Kind bleiben würde. Magdalena hatte von Hause aus eine etwas schwächliche physische Konstitution, so dass ihr Arzt schon von dieser Schwangerschaft abgeraten hatte.
Meiner Mutter ging es schon seit einigen Monaten nicht so gut. Sie war zwar noch nicht einmal siebzig Jahre alt, aber durch ihr doch recht beschwerliches Leben hatte sie sich ziemlich aufgearbeitet und wirkte auch deutlich älter.
Wenige Wochen vor der Geburt unserer Tochter wurde sie bettlägerig. Magdalena und ich kümmerten uns so gut es ging um sie. Meine Mutter war noch vom ›guten alten Schlag‹. Sie machte kein großes Aufheben wegen ihrer Situation, die sie mit großer Demut, Geduld und ganz viel Gottvertrauen zu ertragen wusste. In keiner Sekunde fiel sie uns irgendwie zur Last.
Als wir einmal an ihrem Bett saßen, sagte sie: »Ich habe in meinem Leben nur noch einen einzigen Wunsch: Ich möchte wenigstens einmal mein Enkelkind in den Armen halten. Dann bin ich bereit zu gehen.«
Drei Tage nach Angelas Geburt wurde ihr der letzte Wunsch erfüllt. Wir legten ihr die Kleine für ein paar Minuten in ihren Arm. Meine Mutter war ganz selig vor Glück: »So ein schönes Mädchen! Und so ein schöner Name!«
Dann hielt sie eine Weile inne, schaute Angela nochmals ganz tief in die Augen und fuhr fort: »Das Kind ist eigentlich viel zu schade für diese Welt!«
Über den letzten, fast prophetisch anmutenden Satz machte ich mir zunächst keine Gedanken.
Anschließend bat meine Mutter darum, die Letzte Ölung zu empfangen. Der Priester, den ich sogleich verständigte, kam noch am selben Abend und spendete ihr das Sakrament.
Zwei Tage später – es war 19 Uhr – machte meine Mutter mit einem unüberhörbaren Klopfzeichen auf sich aufmerksam. Wir hatten im Vorhinein dieses Zeichen für den Fall, dass sie dringend unserer bedarf, vereinbart. Eilig gingen wir in ihr Zimmer.
Sie sagte mit zarter und sehr leiser Stimme: »So, meine lieben Kinder: Jetzt ist es gleich so weit!«
Uns war natürlich sofort klar, was sie meinte. Meine Mutter gehörte zu den Menschen, die ein untrügliches Gespür dafür haben, wann es so weit sein wird, die Schwelle des Todes zu überschreiten.
»Sollen wir die Kleine noch holen?«, fragte Magdalena.
»Nein, lass das Engelchen mal schön schlafen!«
Dann gab meine Mutter erst Magdalena, dann mir die Hand, um sich zu verabschieden. Sie zeichnete uns noch ein Kreuz auf die Stirn und segnete uns. Sie faltete die Hände und schloss die Augen, atmete aber noch.
Magdalena und ich blieben an ihrem Sterbebett sitzen und sprachen ein Gebet. Wenige Minuten später machte meine Mutter ihren letzten Atemzug.
Die Beerdigung meiner Mutter war die dritte, der wir im letzten halben Jahr beiwohnten. Erst starb Magdalenas Großvater, dann sechs Wochen später ihre Großmutter. Beide hatten aber ein gesegnetes Alter erreicht.
Da meine Mutter mir zeitlebens immer sehr nahegestanden ist, war ich natürlich recht traurig. Allerdings gab es auch einen durchaus egoistischen Grund für meine Traurigkeit: Wir hatten die Hoffnung, dass sie Angela in den ersten Jahren etwas versorgen könnte, damit sich Magdalena mehr um das Geschäft, das insbesondere in der Vorweihnachtszeit recht boomte, kümmern könnte.
Unsere kleine Tochter war unser Sonnenschein. Sie war ein sehr hübsches und äußerst liebenswürdiges Wesen. Ich verbrachte sehr viel Zeit mit ihr.
So las ich ihr häufig die gleichen Geschichten vor, die meine Mutter mir in meiner Kindheit vorgelesen hatte. Auch erzählte ich ihr immer wieder von ihrem Schutzengel, an den sie genauso fest glaubte wie ich als Kind.
Wenn meine Zeit es erlaubte und das Wetter es zuließ, stöberte ich mit ihr im Wald umher. Dort fühlte sie sich stets besonders wohl. Weder zuvor noch später hatte ich ein Kind gesehen, das alles, was es in der Natur zu beobachten gibt, so genau und liebevoll betrachtete. Wenn sie einen besonderen Baum, eine außergewöhnliche Pflanze oder einen schön geformten Stein wahrnahm, so verharrte sie schweigend und wandte ihren Blick oft minutenlang nicht von dem Objekt ihrer Betrachtung ab. Dabei hatte ich bisweilen den Eindruck, wie wenn sie mit dem, was sie gerade anschaute, kommunizieren würde.
Angela war in vielerlei Hinsicht kein Kind wie jedes andere. Sie war – auch als sie schon in der Schule war – sehr verspielt und verträumt. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass sie in einer anderen Welt lebt, einer Welt, die sich uns nicht erschloss. In der Schule fand sie sich nicht gut zurecht. Sie war gewiss alles andere als dumm, aber das Lernen lag ihr nicht besonders. Da sie auch mit dem Lesen und Schreiben große Schwierigkeiten hatte, musste sie die erste Klasse wiederholen.