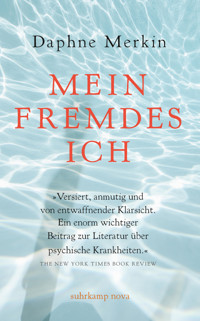
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
»Mein fremdes Ich gehört zum Kanon der Bücher, die depressive Menschen ermutigen und jenen glücklichen, die dieser Bürde entgangen sind, Aufklärung geben.« (Washington Post)
Seit ihrer Kindheit leidet die New Yorker Schriftstellerin Daphne Merkin an Depressionen. Obwohl ihre Eltern, orthodoxe deutsche Juden, sehr wohlhabend waren, war die Atmosphäre in ihrem Zuhause harsch, es fehlte den Kindern an Kleidung, Essen und Zuneigung. Zum ersten Mal wurde Merkin, die die Herzlosigkeit der Mutter kaum ertrug, als Schulkind klinisch eingewiesen, und hat nun – längst selbst Mutter – unzählige Therapien durchlaufen. Über fünf Jahrzehnte beschäftigt sie sich schon mit der noch immer stigmatisierten Krankheit und mit der Frage, was es bedeutet, ein Leben mit Depressionen zu führen, das trotz allem lebenswert ist.
In Mein fremdes Ich wartet Merkin mit all ihrer Erfahrung auf – den vielen Teilsiegen und Rückschlägen, der Aufarbeitung der eigenen Familiengeschichte, den neuesten Forschungserkenntnissen. Mit nüchterner Klarheit und dunkel strahlender Poesie beschreibt sie den Kampf mit Depressionen, die man nie besiegen, mit denen man aber zu leben lernen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 477
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Daphne Merkin
Mein fremdes Ich
Eine Abrechnung mit der Depression
Aus dem Englischen von Daniel Schreiber
Suhrkamp
Für Michael Porder
Beobachte fortwährend (...) Beobachte meine eigene Mutlosigkeit. Dadurch wird sie brauchbar. Hoffe ich zumindest.
Tagebucheintrag von Virginia Woolf vom 8. März 1941
All my watercolors fade to black.
Aus dem Lied »Pavement Cracks« von Annie Lennox
Prolog
Seit kurzem muss ich wieder über den Zauber nachdenken, der dem Selbstmord innewohnt – die Art und Weise, wie er »Basta!« zum Leben sagt wie eine italienische Großmutter, die den angehäuften Schutt des Alltags vor die Tür kehrt und nichts als einen sauberen, unbefleckten Boden hinterlässt. Keine Wut auf die Umstände mehr, die dich in die Knie gezwungen haben. Keine Angst mehr. Keine Notwendigkeit mehr, dich immer wieder aufs Neue durch den Tag zu schlagen, während du dich fühlst, als wäre dein Leben auf Eis gelegt worden. Keine Notwendigkeit mehr, die Müdigkeit zu spüren, die sich um deine Augen ausgebreitet hat – und auch hinter ihnen –, während du Unterhaltungen führst und hoffst, dass niemand merkt, was in dir vorgeht. Keine Qual mehr, kein dröhnender Schmerz in deinem Kopf, der sich so physisch anfühlt, aber trotzdem keine somatischen Ursachen hat, die man bekämpfen oder mit einem Pflaster, einer Salbe oder auch einem Gipsverband behandeln könnte. Und vor allem: Keine Verstellung mehr, kein Zwang, mit einer Maske auf dem Gesicht durch den Tag zu gehen: »Wie, du bist depressiv? Das hätte ich nie geahnt!«
Diese suizidal gefärbten Phasen beginnen zu Zeiten wie diesen – es ist Winter, während ich das aufschreibe, ich sitze an meinem Schreibtisch in New York City. Sie beginnen, wenn die Tage kürzer werden und die Abende früher anbrechen, wenn dem Himmel die Helligkeit fehlt und du damit aufgehört hast, dich für deine Bemühungen zu bewundern, trotz allem weiterzumachen. Sie können aber auch eintreten, wenn die Tage lang sind und das Licht über der Stadt niemals zu erlöschen scheint, sie können in den ersten Tagen des Frühjahrs eintreten oder in den prächtigsten Sommerwochen. Diese Phasen brechen an, wenn deine Stimmungslage, die schon seit Wochen, seit Monaten vielleicht, fühlbar negativer geworden ist, ihren absoluten Tiefpunkt erreicht hat. Du liegst im Schlamm und hältst es nicht mehr für nötig aufzustehen. Du bist in einem Elend gestrandet, das zu ertragen nicht einfach ist, selbst wenn die Umstände deines Lebens eigentlich nicht so schrecklich sind oder zumindest nicht offensichtlich so schrecklich, dass man in ihnen die Ursache für deine Verfassung ausmachen könnte. Und nun hat sich dieser verhängnisvolle Drang wieder in dir breitgemacht, der verspricht, deiner Verzweiflung ein Ende zu setzen. Der verspricht, Schluss zu machen mit deiner Unfähigkeit, dich zusammenzureißen – ein Ausdruck, den du nie gemocht hast, weil er von seinem forschen Ansatz her auch von einem Fitnesstrainer stammen könnte und weil er darüber hinwegtäuscht, wie schwierig deine Situation ist und wie groß die Herausforderung, dich deinem Leben und dessen Spielregeln zu unterwerfen. Trotz allem aber ein passender Ausdruck.
Du hast diese Spielregeln nie verstanden, so viel ist sicher, du hast nie verstanden, wie es möglich sein soll, dass du dich und dein Leben voranbringst, in Richtung eines langfristigen Ziels, das vor deiner Nase baumelt und die Möglichkeit birgt, auch wirklich erreicht zu werden. Da gibt es natürlich dein Schreiben, gewiss eine Art Ziel und auch der Antrieb, der dich am zuverlässigsten aufrecht hält. Kunst soll lange währen, auch wenn das Leben kurz ist, sagt ein lateinisches Sprichwort. Oder so etwas in der Art. Vita brevis, ars longa. Doch an einem Tag wie diesem, wenn alles grau und fadenscheinig wirkt, kann dir nichts Halt geben. Du fühlst dich zu zermürbt, um auch nur so zu tun, als würdest du wissen, warum du einen Fuß vor den anderen setzen solltest: Es wirkt, als wäre es nicht die Kunst, sondern das Leben, das lange währt und kein Ende zu kennen scheint. Du hörst, wie irgendwo in deiner Wohnung eine Uhr tickt, sinnlose Sekunde um sinnlose Sekunde, und das Ticken erinnert dich daran, dass dir die verstreichende Zeit die Luft abschneiden kann, wenn du von deinem inneren Weg abgekommen bist, als würde sich dein Hals in einem Schraubstock befinden. Du musst an einen deiner Aufenthalte auf einer psychiatrischen Station denken, bei dem du zusammen mit einigen anderen Patienten im sogenannten Aufenthaltsraum saßt und mitten am Tag Fernsehen geschaut hast, etwas, was du zuhause nie getan hättest und was dafür sorgte, dass du dich nur noch nutzloser fühltest, so nutzlos wie ein Kleidungsstück, das man nach der Wäsche zum Trocknen aufgehängt und dann vergessen hat.
Wie hast du deine Tage verbracht, bevor diese Trägheit in dein Leben trat und Besitz von dir ergriff? Es ist schwierig, sich in Erinnerung zu rufen, dass du einmal mit einer geradezu selbstverständlichen Betriebsamkeit einer Sache nach der anderen nachgegangen bist. Schreiben und lesen, online nach Dingen schauen, die du dir kaufen könntest, mit deiner Tochter sprechen, zusammen mit einem Freund oder einer Freundin über etwas lachen, eine Tasse Kaffee oder Tee in der Mikrowelle aufwärmen. Du warst sicherlich kein Derwisch, kein Paradebeispiel für Lebensenergie, du bist sicherlich nicht hektisch von einem Termin zum nächsten gewirbelt – auch in deiner besten Verfassung bist du jemand, der zuhause bleibt, jemand, der sich sammeln muss, um die Kräfte aufzubringen, die erforderlich sind, um nach draußen zu gehen und Leute zu treffen, egal wie offen und empfänglich du auch wirken magst –, aber irgendwann einmal hast du dieses ganze Getue, dieses Pläne- und Termine-Machen wenigstens nicht in Frage gestellt. Inzwischen kannst du nicht einmal mehr verstehen, was andere Leute antreibt, sich dort draußen in der Welt zu tummeln, ihre Besorgungen zu machen, zu Terminen zu eilen oder ihre Kinder von der Schule abzuholen. Du hast den roten Faden verloren, der die verschiedenen Facetten deines Lebens zusammengehalten hat. Nichts ergibt mehr einen Sinn, und du kannst nur noch an diesen blanken Nerv in deinem Kopf denken, an den Schmerz, der sich dort breitgemacht hat – und daran, dass du nicht nur dir, sondern auch den Menschen in deiner Umgebung Erbarmen zeigtest, würdest du diesen Schmerz auslöschen.
Unter anderen Umständen wärest du vielleicht abhängig geworden und hättest dich auf der Straße dem vernichtenden Glück von Drogen hingegeben. Stattdessen nimmst du das dir verschriebene Sortiment legaler Drogen, dessen Zusammensetzung von einem Psychopharmakologen, der es gut mit dir meint, gelegentlich neu eingestellt wird. Und du fasst deinen Schmerz in 50-Minuten-Sitzungen in Worte, gegenüber Menschen, denen du über die Jahre große Summen an Geld bezahlt hast, damit sie dir zuhören. Alles ist dir gleich, deine Tochter, deine Freunde, dein Schreiben, der Geschmack von etwas Köstlichem, dieses neue Buch oder jene Fernsehserien, die sich gerade jeder anschaut, alle die Dinge, die dich in dieser Welt verankern sollen. Selbst jene Menschen, die dich am besten kennen, verstehen das blendende Licht nicht, das sich über deine Augen gelegt hat, das Licht, das dich daran hindert, den Weg nach vorne zu sehen. Hoffnungslosigkeit wird immer so beschrieben, als wäre sie glanzlos und matt. Doch in Wahrheit birgt sie ein ganz eigenes Leuchten – ein Leuchten wie das Scheinen des Mondes, in der Farbe gesprenkelten Silbers.
1
Eine Frau steht in ihrer Küche und macht sich eine Kanne Kaffee. Sie löffelt die intensiv riechenden und überteuerten gemahlenen Bohnen aus ihrer adretten kleinen Aluminiumpackung in einen Kaffeefilter und versucht sich ins Gedächtnis zu rufen, bei welchem Esslöffel sie war – vier? sechs? drei? –, während dunkle Gedanken ungezügelt auf sie einpoltern und verschlagene Turnübungen machen: Hättest du nur nicht, hättest du doch, warum bist du, warum bist du nicht einmal, das ist hoffnungslos, es ist zu spät, es ist immer schon zu spät gewesen, lass es doch sein, geh zurück ins Bett, ist das nicht hoffnungslos, der Tag ist schon halb vorbei, nein, der Tag, der vor dir liegt, ist viel zu lang, es gibt so viel zu tun, hättest du doch nur genug zu tun, alles ist aussichtslos, das ist wirklich hoffnungslos.
Wie, fragt sie sich zum abertausendsten Mal, würde es sich anfühlen, wenn sie eine Person wäre, die den Alltag mit einer etwas fröhlicheren Einstellung angehen könnte, mit einem etwas festeren Vertrauen in den Nutzen ihrer Existenz? Jemand, die jene für den Alltag unverzichtbaren Illusionen unterhält – Illusionen, die sich darum drehen, dass Dinge Sinn ergeben und sich am Ende alles richten wird, insbesondere, wenn man sein Glück selbst in die Hand nimmt –, Illusionen, ohne die das Leben unerträglich ist? Diese Person würde sich doch mit Sicherheit auf ihren Kaffee konzentrieren, anstatt sich beim ersten Anflug von Hoffnungslosigkeit ihren Selbstmordfantasien hinzugeben, oder? Wie also wäre es, jemand zu sein, die schon geduscht, gekleidet und mehr oder weniger bereit wäre, sich dem Tag zu stellen, nicht vor Freude in die Luft springend, aber eben auch nicht lahmgelegt von ihrer Trübsal? Denn bestimmt ist dies das Schlimmste daran, jemand zu sein wie sie, die ihrem Kopf so ausgeliefert und so durchdrungen von der Lake ihres Selbsthasses ist: der Umstand, dass es keinen Ausweg aus der Tatsache gibt, so zu sein, wie sie ist. Es ist auch keine Erleichterung in Sicht, es sei denn, sie wird durch tatkräftiges oder zumindest gewissenhaftes Handeln herbeigeführt – Gesprächstherapie, medikamentöse Behandlung, bewusste Versuche, die eigenen Gedanken auf die Zukunft zu lenken oder sich die Hungernden und die Versehrten der Welt ins Gedächtnis zu rufen, oder überhaupt die vielen Menschen, die weniger Glück im Leben hatten als sie selbst. Diese Interventionen können durchaus dafür sorgen, dass sie mit beiden Füßen fest auf dem Boden steht und einen Zustand der Gefasstheit erlangt. Dass sich dieser Zustand bei anderen Menschen mit einer Natürlichkeit und einer Bestimmtheit einstellt, die für sie völlig fremd sind, steht auf einem anderen Blatt.
Die Küche hat ein Fenster, das auf einen Hinterhof und auf andere Wohnhäuser, auf andere Leben schaut. Der ganze Raum ist in hellen, antidepressiven Farben gehalten – Orange und Lila und Aquamarin –, und die in die Decke eingelassenen Einbauleuchten sind angeschaltet, aber es fühlt sich trotzdem an, als würde ein Schatten auf ihn fallen. Die Frau, von der die Rede ist, hat sich große Mühe gegeben, ihre Wohnung einladend herzurichten, und Gäste reagieren immer erfreut auf die von ihr ausgewählten Farben, auf die Kunst, die an den Wänden hängt, auf den Nippes, der zu sehen ist; doch wenn der Wind der dunklen Jahreszeit in ihr Leben weht, sind all ihre Anstrengungen der Haushaltsführung vergebens. Sie hat sich auch große Mühe gegeben, ein Leben aufzubauen, das eine innige Beziehung zu ihrer Tochter und eine Reihe enger Freundschaften enthält, ein leidenschaftliches Interesse an der Kultur, die sie umgibt, sowohl in deren ernsthaften als auch frivolen Ausformungen, eine sinnvolle Arbeit als Autorin. Man schätzt sie für ihren bohrenden Blick, ihre Neugier, ihren trockenen Humor und ihre Wärme; von außen betrachtet könnte ihr Leben für andere Menschen wie ein gutes, wenn nicht sogar beneidenswertes Leben wirken. Ein bestimmter Teil von ihr weiß das, aber dieses Wissen versiegt, sobald das Heulen jenes Windes sie durchdringt und sie daran erinnert, wie sie sich eigentlich fühlt: öde, verloren und völlig hoffnungslos.
Dieses Stimmungstief kann sie plötzlich und mit großer Wucht ereilen, ohne dass sie es kommen sieht: Den einen Moment fühlt sie sich mehr oder weniger okay, den nächsten möchte sie sich am liebsten eine Kugel in den Kopf jagen. Das kann etwa an einem Montagnachmittag passieren, wenn sie von einem Zahnarzttermin zurückkehrt und ihre Wohnung leer vorfindet und schon die Staubkörnchen, die in der Luft schweben, trostlos auf sie wirken. Sie fühlt sich einsam, gefangen in einer Höhle der Trauer, eines uralten und permanenten Leidens. Und dann, auf den Flügeln dieses Gefühls, gluckst von irgendwo in ihrem Inneren das Bedürfnis hoch, sich das Leben zu nehmen. Dieses Bedürfnis ist so stark, dass sie in die Küche geht, ein Brotmesser aus dem Block nimmt, der auf der Arbeitsplatte steht, und dessen gezahnte Schneide über ihren Daumen fahren lässt. Sie stellt sich vor, wie es wäre, sich damit die Pulsadern aufzuschneiden … Aber muss man nicht erst die Badewanne mit Wasser füllen und die Pulsadern dann aufschneiden, wenn man sichergehen möchte, dass man auch wirklich stirbt, so wie das Diane Arbus gemacht hat? Um sich davon abzuhalten, darüber noch länger nachzudenken, legt sie sich ins Bett, liegt einfach nur so da und wartet darauf, bis das Bedürfnis versiegt.
Dann wiederum nimmt sich die dunkle Jahreszeit mitunter ganz gemächlich Zeit, um sich zu erkennen zu geben, sie hält sich wochen- oder sogar monatelang zurück, bis sie verkündet, dass sie unwiederbringlich da ist. Dieser bestimmte Nachmittag, auf den ich hier anspiele, legt seinen Auftritt Mitte März hin, aber er hätte sich auch genauso gut Mitte Dezember oder Mitte August ereignen können. Die Erkrankung, die sie im Bann hält, hält sich nicht respektvoll an einen Kalender, sondern kommt genau dann zum Tragen, wenn ihr danach ist. Der Frau kommt es so vor, als hätte sie sich schon immer mehr oder weniger so gefühlt. Es ist schon immer der Ruß auf den Ziegeln gewesen, der ihr besonders auffällt, die Fehler ihrer Freunde, der Liebeskummer, der sich am Horizont abzeichnet – die Traurigkeit, die wie Blut unter der Haut des Lebens pulsiert.
Depression ist ein globales Problem, sie betrifft 350 Millionen Menschen in der Welt; in den Vereinigten Staaten hatten 2012 ungefähr 16 Millionen Menschen zumindest eine schwere depressive Episode, und 2014 haben sich hier mehr als 40 000 Menschen das Leben genommen. Dennoch ist es eine Art der Traurigkeit, über die in der Öffentlichkeit niemand sprechen möchte, nicht einmal in unserer Ära der Indiskretion. Auf New Yorker Cocktailpartys kann man ausgiebig darüber reden, dass man AA-Meetings besucht oder einen Aufenthalt in einer Entzugsklinik hinter sich hat, ohne dass jemand mit der Wimper zuckt. Aber stellen Sie sich vor, in gehobener Gesellschaft zu erzählen, wirklich zu erzählen, wie Sie sich fühlen, während die Leute mit einem Weinglas in der Hand ihre Kreise ziehen und sich darauf konzentrieren, mit wem sie als Nächstes sprechen könnten – mit jemandem, versteht sich, der nicht Sie sind:
»Wie geht es Ihnen?«
»Nicht so gut. Ehrlich gesagt bin ich gerade hochdepressiv. Ich schaffe es kaum, aus dem Bett zu kommen. Ich habe keine Ahnung, was gerade in der Welt passiert, und es interessiert mich auch nicht wirklich.«
Wer will so etwas schon hören? Wer hat so etwas je hören wollen? Wer wird das irgendwann einmal tun? Trotz unserer so freimütigen Geständniskultur schottet sich die soziale Welt gegen persönliche Enthüllungen ab, die sich zu echt anfühlen, die die Oberfläche des Miteinanders zu sehr aufwirbeln. Wir leben in einer Gesellschaft, der zu viel Innerlichkeit peinlich ist, es sei denn, sie wird in den schrillen, fast schon kitschigen Tönen der 12-Schritte-Bewegung vorgebracht, die von dramatischen persönlichen Zeugenberichten lebt. Gründliche Selbstreflexion – das nüchterne und nuancierte Ringen mit den eigenen Dämonen – ist mit den großen bekümmerten Viktorianern ausgestorben, mit John Ruskin, Thomas Carlyle oder Matthew Arnold.
Auch in privaten Kreisen ist es nicht wirklich zuträglich, solch erbarmungslose Gefühle zur Schau zu stellen, egal wie warmherzig die Freunde sind, wie sehr sie auch zuhören wollen. Es wird anderen Menschen langweilig, mit Depressiven über die einseitige Wahrnehmung der Welt zu reden, an der sie so stur festhalten, egal wie bereit diese anderen Menschen zunächst auch sind, ihnen zuzuhören. Mach Yoga, raten sie, oder Vielleicht brauchst du eine Massage? Sie sagen zwar nicht Hör nur bitte auf, unentwegt darüber zu reden, aber Sie können ihren fest geschlossenen Kieferknochen ansehen, wie groß ihr Widerstand ist, sich auf Sie und Ihre Tristesse einzulassen.
Wenn die Frau schließlich wieder einmal in den finsteren Nebel der dunklen Jahreszeit verschwindet – die Dunkelheit hat sich wie immer langsam herangeschlichen, diese Invasion negativer Gedanken, die dann die Zügel in ihrem Inneren übernehmen, eine Invasion, die geräuschlos vonstattengeht, von niemandem bemerkt wird und bei niemandem die Alarmglocken läuten lässt, bei niemandem als der Frau selbst, dem Opfer dieser Invasion, doch wenn bei ihr die Alarmglocken läuten, ist es schon längst zu spät –, ist die heimtückische Arbeit dieser Jahreszeit vollbracht. Es gibt dann niemanden, der sie dort herausholen könnte.
Diese Frau hat ein Kind namens Zoë, eine lebhafte Tochter in ihren Zwanzigern, mit der sie lacht, bis ihnen die Tränen kommen, auf jene emotional inzestuöse Art, die zwischen Töchtern und Müttern herrscht. Sie macht sich Sorgen, dass sie Zoë notgedrungen in eine Fürsorgerolle gezwängt hat, sie hat immer ein Auge auf ihre Mutter werfen müssen, die sechs Monate nach der Geburt zum ersten Mal aufgrund von Depressionen in ein Krankenhaus eingewiesen wurde – und dann noch einmal kurz vor Zoës viertem Geburtstag und dann noch einmal zum Ende ihrer Teenagerjahre. Die Frau liebt ihre Tochter so sehr, wie es in ihrer Macht steht, aber sie hat oft das Gefühl, dass sie das Mädchen, würde sie es wirklich lieben, von der Anwesenheit seiner Mutter befreien müsste, die für zu viel Dunkelheit und zu wenig Sonne in seinem Leben sorgt und ohne die es sicherlich aufblühen würde.
Die Frau bin natürlich ich selbst, aber sie könnte jeder von uns sein, der an diesem Gebrechen leidet, das Frauen fast doppelt so oft heimsucht wie Männer, obwohl es seltsamerweise vor allem Männer sind, die darüber schreiben. (Männer nehmen sich auch viermal häufiger das Leben als Frauen, obwohl so viel weniger von ihnen als depressiv diagnostiziert werden und sie die psychiatrischen Stationen in weitaus kleineren Zahlen als Frauen bevölkern.) Es hat mich immer fasziniert, dass es der größeren statistischen Häufigkeit von Depressionen bei Frauen zum Trotz sogar hier die Männer sind, die einen längeren Schatten werfen, ganz so, als wäre ihre Krankheit der Beweis einer gesellschaftlichen und nicht einer persönlichen Notlage. In der männlichen Variante des Depressionsnarrativs fällt die Schwärzung der Stimmung wie die Pocken über den Mann herein, ohne jede Warnung. Natürlich gibt es Berichte, die von diesem Modell abweichen, die Bücher von Andrew Solomon oder Edward St Aubyn etwa, aber normalerweise sucht man in den von Männern geschriebenen Erfahrungsberichten vergeblich nach Anhaltspunkten für eine zum Trübsinn neigende Veranlagung. Stattdessen wird auf eine bestimmte, sich in der Depression niederschlagende Ursache außerhalb der eigenen Person verwiesen, auf die Spätfolgen eines einschneidenden Todesfalls etwa, auf den Entzug von Alkohol oder von Schlaftabletten oder auf die Diagnose einer schweren Krankheit. Im einen Moment lebst du so vor dich hin, bist ein extrem erfolgreicher Schriftsteller oder Wissenschaftler, und im nächsten denkst du ernsthaft darüber nach, dich von der Brooklyn Bridge zu stürzen. Oder es liegt umgekehrt überhaupt keine äußerliche Ursache vor: Eines Morgens wachst du wie in der Geschichte von Himmel und Huhn auf und stellst fest, dass der Himmel dabei ist, auf die Erde zu fallen.
Zum zweiten wägt der Autor dann für gewöhnlich die Implikationen eines bisher übersehenen genetischen Erbes ab und zieht die Erinnerung an einen schizophrenen Onkel oder einen suizidalen Cousin dritten Grades zur Erklärung heran. So oder so wird dem Autor erspart, seine eigene Verletzlichkeit bloßzulegen oder sich auch nur mit seinen Problemen auseinandersetzen zu müssen – in seinen Augen ist seine Depression auf Umstände zurückzuführen, die jenseits seiner eigenen psychologischen Verfassung liegen. William Styron hat sich in seinen eindringlichen, aber seltsam kontextlosen Memoiren Sturz in die Nacht für diese Erzählweise entschieden. Darin führt er seine Depression fast vollständig auf die Notwendigkeit zurück, mit dem Trinken aufzuhören. Eine ähnliche Haltung schlägt sich auch in Anatomie der Schwermut, dem Erinnerungsbuch des britischen Biologen Lewis Wolpert, nieder. Als er gegen Ende des Buches von den vielen Lesern schreibt, die ihm dafür gedankt haben, dass er seine persönlichen Erfahrungen mit Depression so offen diskutiert, hält er es für nötig, eine entscheidende Einschränkung geltend zu machen: »Trotzdem muss ich einräumen, dass ich von dem Stigma nicht ganz frei bin, denn ich selbst ziehe ja auch eine biologische Erklärung für meine Depression einer psychologischen vor.«
Männer haben mit anderen Worten eine raffinierte Möglichkeit gefunden, die Vorstellung des moralischen Scheiterns zu umgehen, die mit psychischen Krankheiten verbunden ist – genauso wie jenes Urteil, das häufig über Berichte von dieser Erkrankung gefällt wird, die zum Introspektiven tendieren: das der Nabelschau. Dies ist ihnen gelungen, indem sie darauf beharren, dass Kräfte außerhalb ihrer selbst für ihre Erkrankung verantwortlich sind oder diese vollständig auf eine genetische Veranlagung zurückzuführen sei. Das weibliche Depressionsnarrativ hingegen neigt dazu, die entgegengesetzte Richtung einzuschlagen. Die Lyrik von Anne Sexton und Sylvia Plaths Roman Die Glasglocke versinnbildlichen, wie weibliche Depressive leichter anerkennen, dass ihre Erkrankung zu ihnen gehört. Sie akzeptieren schneller, dass diese nicht nur in biologischen Fehlern begründet ist, sondern auch in einem klaffenden inneren Mangel, der mit einem schwer fassbaren Verlangen nach Ganzheit oder Wohlbefinden einhergeht. Diese Art des Schreibens über Depression ist für gewöhnlich höchst innerlich, so sehr, dass es ihr fast schon zum Nachteil gereicht: Der Welt, durch die sich die Erzählerin bewegt, wenn sie nicht depressiv ist, wird in diesen Berichten ein so kurzer Prozess gemacht, dass sie fast völlig aus dem Blickfeld gerät.
In den autobiographischen Romanen von Jean Rhys zum Beispiel schleichen sich die missgestimmten Heldinnen in einem Zustand solch innerer Malaise durch die heruntergekommeneren Stadtviertel von Paris, dass der Leser mit nichts anderem als der hermetischen Atmosphäre tiefster Hoffnungslosigkeit zurückbleibt. Das Risiko solcher Erzählungen besteht darin, dass sie letztlich jedes Aufflackern von Lebendigkeit verpuffen lassen und dabei die Geduld des Lesers und sein Mitgefühl zu strapazieren drohen. Das bringt uns wieder zu dem Unterschied zwischen den Geschlechtern zurück, dessen Gefälle impliziert, weibliche Depression sei nichts als eine rein idiosynkratische Angelegenheit, nichts als eine Ansammlung von Reaktionen der Trauer auf eine Reihe unglückseliger Ereignisse – gescheiterte Liebesbeziehungen, verhinderte Arbeitsverhältnisse, schlechte Kindheiten. Eine Angelegenheit also, die kaum als ein beispielhaftes Modell taugt, das es uns ermöglichen würde, Schlüsse zu ziehen und diese auf jemand anderen als die depressive Person, um die es sich dreht, anzuwenden.
Der Erkrankung selbst hat man im Laufe unserer Geschichte viele Namen gegeben – Acedia, Melancholie, Malaise, Grillen fangen, Geistesabwesenheit, Hyperästhesie, Trübseligkeit, Schwermut, schwarze Galle, Zyklothymia, Lebensmüdigkeit, Todessehnsucht, Weltschmerz, Lagerkoller oder Anfechtung (das ist der Begriff, den die Hutterer benutzten, um zu beschreiben, dass jemand »vom Teufel verführt« worden war) –, sie wurde als eine spirituelle Krankheit verstanden, als ein Scheitern von Willenskraft, als biochemische Funktionsstörung, als psychisches Mysterium und manchmal auch als Kombination einiger dieser Vorstellungen. (In Frankreich, wo man die unvergleichliche Fähigkeit besitzt, Dinge elegant zu verpacken, hat man anstelle einfacher Erklärungen gleich eine ganze launische Philosophie der »Abjektion« entwickelt, die etwa von psychoanalytischen Denkern wie Julia Kristeva expliziert wurde. Sowohl der Zustand der Abjektion als auch die Depression sind dieser Theorie zufolge Variationen einer unmöglichen Trauer um das mütterliche Objekt. Kristeva trifft in ihrem Buch Schwarze Sonne. Depression und Melancholie jedoch die Unterscheidung, dass es sich bei der Depression um einen Diskurs mit einer erlernten Sprache handele und nicht um eine Pathologie im engeren Sinne, die auch behandelt werden kann.) Je nach Situation erregt die Erkrankung Mitleid, Feindseligkeit, Misstrauen, Mitgefühl, Verachtung, Geringschätzung, Respekt oder eine unreflektierte Mischung aus diesen Gefühlen.
Es ist eine Sache, wenn man eine Figur ist, die zum Helden taugt, jemand, der etwas erreicht hat, jemand wie Winston Churchill zum Beispiel, der mutig Krieg gegen Hitler führte, während er seine melancholischen Episoden mit Ölmalerei und Maurerarbeiten in Schach zu halten versuchte (obwohl es so aussieht, als sei es seine Frau Clementine gewesen, die an einer schwereren Depression litt; in höherem Alter unterzog sie sich sogar einer Elektrokonvulsionstherapie – einer Behandlung, die heute als Elektroschocktherapie bekannt ist), oder jemand wie Abraham Lincoln, der mit Selbstzweifeln und Hoffnungslosigkeit rang, während er seine Vision verfolgte, die amerikanische Republik von der Sklaverei zu befreien. Es ist eine völlig andere Sache, wenn man einer von vielen Millionen Erkrankten ist, die versuchen, so gut wie möglich über die Runden zu kommen, während sie ähnliche Dämonen im Zaum halten. Wie der Maler aus Chapel Hill, der meine Artikel über Depressionen las, die im Laufe der Jahre im New Yorker und im New York Times Magazine erschienen sind, und mir einmal schrieb: »Der sprichwörtliche schwarze Hund verfolgt mich, seit ich ein Teenager war, und schläft neben meinem Bett. Er hat dafür gesorgt, dass mein Vater ins Krankenhaus kam.«
Ich habe Leserbriefe bekommen, von denen manche eloquent waren und andere so verwirrt klangen, dass man sie kaum verstehen konnte. Unter den Autoren befanden sich ein 35-jähriger Knast-Insasse, ein uralter Golfpartner von John Updike und ein »melancholischer, alter Englisch-Professor«, dessen Tochter nach einer Reihe von Aufenthalten auf geschlossenen psychiatrischen Stationen starb, als sie gerade 29 war. Es gab eine Frau, die es vorzog, unter dem Pseudonym »Lisa« in Form von Päckchen mit mir zu kommunizieren, die sie selbstbewusst per Expresspost verschickte und die einige Seiten beinhalteten, die aus einem gelben, linierten Schreibblock gerissen worden waren. Darauf hatte sie in einer kindlichen Handschrift eine Liste mit Tipps in der Art des amerikanischen Haushaltsratgebers Hints from Heloise (»Tipps von Heliose«) gekritzelt, wie man Depressionen verhindern könnte. Einige von ihnen waren Gemeinplätze, andere geradezu geheimnisumwoben (»jedes Stück Grapefruit vermeiden« oder »keine Lieder mit Text hören«). Der Ansturm der Anerkennung von anderen Leidenden ändert nicht viel an den unmittelbaren Qualen. Doch diese Anerkennung kommt von Menschen, die es geschafft haben, auf ihre höchst individuelle Art und Weise zu überleben – es liegt Trost in dem Wissen, dass man selbst in größter Dunkelheit nicht allein ist.
Seit Jahren suche ich nach einem Bericht vom Schlachtfeld der Krankheit, der meine eigenen Erfahrungen widerspiegelt, aber bisher habe ich noch keinen gefunden. Ich schreibe dieses Buch teilweise, um diese Lücke zu füllen und um zu zeigen, wie es sich im Inneren anfühlt, an klinischer Depression zu leiden – auf eine Art, die hoffentlich sowohl Depressive erreicht als auch die Freunde und Familienangehörigen, die deren Leid mit ansehen müssen. In den vergangenen beiden Jahrzehnten sind eine Reihe von Büchern erschienen, die sich mit dem Phänomen der depressiven Störung, in seiner unipolaren ebenso wie in seiner bipolaren Form, auseinandergesetzt haben – darunter Styrons Sturz in die Nacht, Susanna Kaysens Durchgeknallt und Kay Redfield Jamisons Meine ruhelose Seele. Doch ich habe den Eindruck, dass diese Bücher die depressiven Episoden von Zusammenbruch und Handlungsunfähigkeit mit unanfechtbaren Darstellungen des ansonsten hyperfunktionierenden Lebens der Autoren einklammern. (Man beachte, dass Sturz in die Nacht mit der Beschreibung einer Reise nach Paris beginnt, wo Styron ein prestigeträchtiger Literaturpreis verliehen wird, und das Buch im Englischen den Untertitel »A Memoir of Madness« trägt, Memoiren des »Wahnsinns« also.)
Diese Art von Darstellung erlaubt es dem Leser, Depression als ein seltenes, anormales Faszinosum zu verstehen und nicht als den völlig gewöhnlichen, unexotischen psychologischen Vogel, der sie häufig ist und der es so schwer macht, sich eine florierende Existenz aufzubauen. Es ist schwer zu sagen, ob die Autoren das aus einem Bedürfnis des Selbstschutzes heraus tun oder ob sie den Leser vor etwas schützen möchten, und ich bin mir nicht sicher, ob sie es selbst sagen könnten.
Was ich sagen kann, ist das: Meiner Erfahrung zufolge bleibt das Stigma, das der Depression anhaftet, sehr real. Es gibt etwas an dieser Störung, das sowohl beschämend ist als auch auf eine Weise auf den Charakter der an ihr Leidenden verweist, wie es andere Krankheiten nicht tun. So lässt sie sich etwa nicht feinsäuberlich in die Literatur über Abhängigkeit und Genesung einreihen. Die Erfahrungsberichte, die über depressive Störungen geschrieben werden, bieten dem Leser keine stellvertretenden Nervenkitzel, nicht zuletzt, weil die Symptome selten exzessiv genug sind, um jemanden abzuschrecken oder auch nur neugierig zu machen. Schon psychische Störungen zeichnen sich im Allgemeinen durch etwas aus, das nicht greifbar ist, aber Depressionen lassen sich noch viel schwieriger bestimmen oder abgrenzen. Sie übernehmen das Leben schleichend und haben keine spürbare Präsenz, vielmehr machen sie sich in Form von Abwesenheit bemerkbar – einer Abwesenheit von Appetit, Energie oder Kontaktfreudigkeit. Es gibt wenig, auf das man wirklich zeigen kann: keine obszönen Tiraden, keine plötzlichen Anfälle unkenntlichen, hyperenergetischen Verhaltens, keine magischen Glaubenssysteme, die sich um Lottonummern oder Glückskekse drehen. Ich habe den Eindruck, dass wir der Behauptung, Depression sei eine legitime psychische Krankheit, manchmal immer noch skeptisch gegenüberstehen, weil sie nicht verrückt aussieht.
Andererseits hat gerade die Undurchsichtigkeit der Depression – sie beruht nun einmal sowohl auf biologischen als auch auf psychologischen Faktoren – dafür gesorgt, dass die Krankheit zum phänomenologischen Prügelknaben in der noch immer hitzig geführten Debatte avanciert ist, ob die Entwicklung und Formung unserer jeweiligen Charaktere aufgrund unserer Natur oder der Kultur, in der wir leben, erfolgt. Depressionen sind zum Magneten für die schlimmsten Projektionen unseres puritanischen Erbes und unserer verschreibungsfreudigen Psychopharmakaära geworden, mit dem traurigen Ergebnis, dass sie zu wenig diagnostiziert und zu oft mit Medikamenten behandelt wird. Wir schwanken zwischen zwei Polen: Einerseits versuchen wir, die Depression wegzuscheuchen, indem wir sie als eine Phantomerkrankung charakterisieren, die durch Anstrengungen des Willens gelindert werden könnte (setze einfach einen Fuß vor den anderen), andererseits tun wir so, als unterliege sie der Sorge unseres Hausarztes, den man für ebenso fähig erachtet, Antidepressiva zu verabreichen, wie Grippeimpfungen zu geben.
Es ist 15 Jahre her, dass ich zum ersten Mal eingewilligt habe, an diesem Buch zu arbeiten. Ich war aufgrund eines Artikels danach gefragt worden, in dem ich für den New Yorker über meine Erfahrungen während eines Psychiatrieaufenthalts schrieb, der mir wegen meiner Depression empfohlen worden war. Ich glaube, dass ich so lange gebraucht habe, dieses Buch zu beenden, weil das Schreiben über diese Krankheit bedeutete, dass ich mit der ständigen Angst vor dem erneuten Einsetzen depressiver Episoden und zugleich mit den immer wiederkehrenden Episoden selbst kämpfen musste. Ich musste mich auch mit den Geistern meiner Kindheit herumschlagen, mit den Zweifeln, die ich gegenüber dem Wert meiner Geschichte hege, und den Zweifeln daran, ob es mir überhaupt erlaubt ist, sie zu erzählen. Das Töten von Geistern ist niemals einfach, und meine Geister sind besonders gebieterisch und ermahnen mich immer wieder, meinen Kopf gesenkt zu halten und die Saga meines Lebens für mich zu behalten. Letztlich aber liegt dem Schreiben dieses Buches die Bemühung zugrunde, so etwas wie die Oberhand über meine Erfahrungen zu gewinnen, indem ich diese genau beobachte. Ich hoffe, dass ich meine Überlebenschancen erhöhe, wenn ich mir verdeutliche, was auf dem Spiel steht: ein Leben, das ich mir langsam selbst aufbaue, keines, das von anderen Menschen für mich aufgebaut wurde. Dabei versuche ich nicht nur den unheilvollen Zauber meiner Kindheit zu durchbrechen, sondern auch meine Lebensgeschichte von dem Narrativ zu befreien, das ich früher verfolgt habe – ein Narrativ, das sich einmal angefühlt haben mag, als wäre es notwendig und wahr, inzwischen aber selbst zu einer Art Gefängnis geworden ist.
Ich versuche, meine Erfahrungen mit der Depression als die »dunkle Jahreszeit« zu begreifen, zum Teil, weil ich damit ein Zeichen der Hoffnung setzen möchte, dass diese Erkrankung nicht nur über mich gekommen ist, sondern auch wieder zu Ende gehen wird. Andererseits möchte ich dieser Krankheit, die vollkommen unästhetisch ist, einen schöneren Anstrich verleihen. Wenn diese Jahreszeit anbricht, hilft es mir nicht, mir ins Gedächtnis zu rufen, dass ich sie schon einmal durchlebt habe, dass sie sich nicht völlig neu anfühlt, dass sie einen muffigen Geruch verströmt, der mir vertraut ist, oder dass sie mit einem Mangel von Licht und einem Übermaß an Eingeschlossensein einhergeht, die mir ebenfalls vertraut sind. Es hilft mir auch nicht, an die armen, ins Unrecht gesetzten und verlorenen Seelen dieser Welt zu denken, an die Menschen, die in Syrien gefoltert werden, im Sudan an Hunger leiden oder in Baltimore Gewalt erfahren. Vielmehr möchte ich wissen, wie ich hier jemals wieder herauskommen kann und ob es überhaupt eine andere Jahreszeit als die dunkle gibt. Sehen Sie, hier unten, wo sich das Leben so anfühlt, als fände es unter einem Deckmantel statt, der mir die Luft abschnürt, ist es mir nicht möglich, mich daran zu erinnern, dass ich mich jemals anders gefühlt habe. Ich muss mich bewusst daran erinnern, dass es Gründe gibt, an dieser Welt festzuhalten, auch wenn diese mir entfallen sind. Ich sage mir, dass mir diese Gründe schon wieder einfallen werden, solange es mir nur gelingt, weiter festzuhalten.
2
Manchmal fühle ich mich, als wäre ich dazu verdammt, meine Familiengeschichte immer wieder aufs Neue zu erzählen. So wie bei dem Ritual, jedes Jahr beim Sederabend des Pessach-Festes zu erzählen, wie sich das jüdische Volk von der grausamen Herrschaft des Pharaos befreit hat und aus Ägypten ausgezogen ist. Im hebräischen Text wird dieses Ritual explizit als »Mitzwa« beschrieben, als ein gutes Werk. Wir sind dazu angehalten, uns und unseren Gästen die Haggada laut vorzulesen und so die Geschichte unseres Volkes auf ein Neues weiterzugeben, damit wir die schwierigen historischen Umstände nicht vergessen, die uns von dort aus in die Gegenwart brachten und dafür sorgten, dass wir uns von der Sklaverei emanzipiert haben. Auch meine Kindheit verstehe ich als eine Art von Sklaverei – mit Sicherheit lässt sie sich als so etwas wie eine Gefangenschaft beschreiben –, aber ich bin mir selbst nach all den Jahrzehnten, die seither vergangen sind, nicht sicher, ob ich ihr jemals entkommen bin, ob ich jemals eine Art von Freiheit erreicht habe, die mehr als nur kurzlebig war.
Diese Geschichte schwankt wie alle Geschichten zwischen Vergangenheit und Zukunft. Anders als bei den meisten Geschichten bleibt die Vergangenheit in diesem Fall jedoch nicht in ihrem Schlupfwinkel. Stattdessen sucht sie in solch einem Maße die Gegenwart heim, dass diese Gefahr läuft, erdrückt und außer Betrieb gesetzt zu werden. Zum Beispiel in dieser Szene, die sich irgendwann im Heute abspielt: Es ist tiefe Nacht – eigentlich schon sehr früh am Morgen –, und ich spreche mit einer meiner Schwestern am Telefon über die »Tragödie unserer Familie«. Wir haben dieses finstere Thema schon viele, viele Male zuvor umkreist, haben schon oft detailliert besprochen, wie unerklärlich und unerträglich es war, bei uns zuhause aufzuwachsen. Meine Schwester benutzt Wörter wie »Havarie« oder »Blutbad«, und ich stimme ihr murmelnd zu. Keiner der anderen, die dort mit uns aufgewachsen sind, hat so viel Interesse daran, solche Unterhaltungen zu führen, wie wir, keiner unserer vier Geschwister – und übrigens auch unsere jeweiligen Kinder nicht –, aber wir beide stehen im Bann dieser Geschichte, sind süchtig nach ihren Gräueln, obwohl wir all ihre überraschenden Wendungen kennen und inzwischen auch einen recht soliden Eindruck davon haben, wohin sie geführt hat. Dennoch sieht es so aus, als werden wir niemals genug davon bekommen, uns wieder ins Gedächtnis zu rufen, wie unser früheres Leben ausgesehen hat, wie sie sich angefühlt hat, diese Landschaft aus Stacheldraht, hinter der vergoldeten Fassade des Park-Avenue-Lebens.
Wie, fragen wir uns wieder einmal, ist nur die heimtückische Grausamkeit unserer Mutter zu erklären – ihr Drang, »ihre eigenen Jungen zu fressen«, wie es ein Psychiater einer meiner Brüder und Schwestern einmal drastisch ausgedrückt hat, eine Art Pathologie, die anderen Menschen nicht ins Auge fiel, weil sie nach außen hin wie ein völlig normaler Mensch wirkte. Obwohl ich nicht behaupten kann, dass meine Mutter bei den Leuten, die ihr begegneten, einen besonders herzlichen Eindruck hinterließ, hätte sie jede Prüfung ihrer mütterlichen Fähigkeiten bestanden. Sie wirkte wie ein spezieller Typ von Mutter, kühl und ein wenig distanziert, aber nicht wie eine völlige Anomalie – sie war ein Monster, das sich vor der Außenwelt bedeckt hielt. Und das, obwohl sie sich durch keine der typischen Merkmale einer normalen Mutter auszeichnete, einer Mutter, die sich um ihre Kinder kümmert und ihnen ein Leben wünscht, das so gut ist wie ihr eigenes oder noch besser. Für die meisten Menschen wäre es schwierig gewesen, ihre essenzielle Perversität zu erkennen, da die Idee von Mutterschaft für die meisten von uns mit so vielen positiven Bedeutungen versehen ist. Niemand erwartet von einer Mutter, dass sie sich mit weit aufgerissenem Maul auf ihre Jungen stürzt.
»Deine Tränen berühren mich überhaupt nicht«, erklärte sie mir immer wieder, wenn ich als kleines Mädchen weinte. Und bevor sie mich schlug, warnte sie mich: »Gleich wirst du meine Hand auf deinem Gesicht spüren.« Sie war auch in der Lage, mir im gleichen Atemzug zu sagen, dass ich eigentlich ganz hübsch sei, aber scheußlich aussehe, wenn ich nicht munter oder gut gelaunt war – sie stieß das Wort mit Macht aus, betonte die erste Silbe und ließ die zweite dann langsam ausklingen, scheuß-lich. »Ich kann es mir nicht erklären«, sagte sie dann, als würde sie eine chemische Reaktion analysieren. »Irgendwas passiert mit deinem Gesicht, wenn du launisch bist.« (Launisch war ebenfalls eines ihrer Lieblingswörter.) »Du siehst dann einfach scheuß-lich aus.« Ich ging mit großer Befangenheit durch die Welt und versuchte, meine Gesichtszüge liebenswürdig und harmonisch wirken zu lassen, weil ich Angst hatte, dass sie in sich zusammenfallen und ein abstoßendes Bild abgeben würden, wenn ich nicht aufpasste.
Verstehen Sie mich nicht falsch: Meine Mutter hat uns nicht auf unverhohlene Weise vernachlässigt, sie war auch nicht offenkundig verrückt. Sie war durchaus fähig, halbwegs zu bewältigen, was von ihr als Mutter verlangt wurde, wenn auch nur mit einer bestimmten Distanziertheit: Sie konnte ein Geburtstagsfest organisieren, mit einer Schokoladenbuttercremetorte, die von Iva, unserer Köchin, gebacken wurde, sie konnte telefonisch Rat beim Kinderarzt einholen und dafür sorgen, dass uns jemand zum Zahnarzt brachte. Aber der Subtext von allem, was sie für uns machte, waren Neid und Geringschätzung. »Ich glaube, er könnte schwul sein«, sagte sie einmal beschwingt und wie aus heiterem Himmel über meinen älteren Bruder, bei dem ich keine Anzeichen für Homosexualität ausmachen konnte, der als Teenager jedoch für kurze Zeit seine Koteletten lang trug, ein Frisierstil, den meine Mutter feminin fand. Oder als ich einmal nach Hause eilte, um die Neuigkeit zu verkünden, dass der New Yorker eingewilligt hatte, eine Erzählung von mir zu drucken, und meine Mutter nur sagte: »Deine Nase sieht groß aus, wenn du lachst.« Ich hatte mir ohnehin schon über meine Nase Sorgen gemacht – es war eine typisch ethnische Nase, die nach unten zeigte und einen leichten aristokratischen Buckel hatte, nicht das süße Stupsnasenmodell –, aber diese Bemerkung sorgte dafür, dass ich sie richten ließ.
Vor allem wollte sie nicht, dass irgendeiner von uns dachte, er oder sie sei von Bedeutung – oder hätte es auch nur annähernd verdient, so viel Raum einzunehmen, wie sie es tat. Hör auf, über dich selbst zu reden, sagte sie mir während meiner ganzen Kindheit in regelmäßigen Abständen, wenn ich neben ihr herlief und sie an irgendeiner kleinen Kränkung oder irgendeinem kleinen Triumph teilhaben ließ. Und obwohl sie uns mit Geschichten über ihr eigenes grenzenloses Potential bombardierte, das sich nur nicht ausschöpfen ließ, weil ihre Schulausbildung von den Nazis abgebrochen worden war, genoss sie es, den Ehrgeiz von uns Grünschnäbeln zurechtzustutzen. Immer wenn ich sie wie das Mädchen in dem Lied »Que Sera, Sera« fragte, was ich wohl werden würde, wenn ich erwachsen bin – eine Zeit lang glaubte ich, ich würde Schauspielerin werden –, zerstörte sie all meine Hoffnungen, indem sie sagte, mir bliebe immer die Möglichkeit, bei Woolworth, dem Billigladen auf der Lexington Avenue, zu arbeiten. Ich nahm sie beim Wort und malte mir in tristen Farben aus, wie ich zu einem Leben verdammt sein würde, das daraus besteht, in einem taillierten 50er-Jahre-Kleid und praktischen flachen Schuhen am Verkaufstresen zu stehen und Knöpfe und Reinigungsprodukte abzukassieren. Als sie älter war, äußerte sie mit großer Schadenfreude, ganz so, als sei es immer ihr größter Traum gewesen, dass wir eines Tages sozial absteigen würden: »All meine Kinder haben in Familien eingeheiratet, die arm wie Kirchenmäuse sind.«
Heute, mehr als 40 Jahre später, kommt es zu kompensatorischen Redeschwallen wie diesen, in denen meine Schwester und ich mikroskopisch unsere verletzten Persönlichkeiten ausloten. Ich sitze in meinem Bett, meinen Rücken an Kopfkissen und Wand gelehnt, und meine Schwester und ich reden und reden. Auch wenn es schon drei Uhr in der Nacht ist, sind wir hellwach und können nicht schlafen, in unseren Wohnungen, die sich jeweils auf der anderen Seite des Central Park befinden. In der Stadt, die niemals schläft, ist es weitgehend ruhig geworden, gelegentlich hört man den Verkehr auf der Straße oder die plötzlichen Rufe eines Fußgängers. Meine Schwester und ich schweigen einen Moment und versuchen die Kosten abzuschätzen, die all das, was schiefgegangen ist, für unser Leben hatte. Wir versuchen, die Verwüstung zu überblicken, die unsere Kindheiten hinterlassen hatten und die es so gut wie unmöglich macht, ein gutes Erwachsenenleben zu führen.
Obwohl keiner unserem Elternhaus unversehrt entkommen ist, ist jedem von uns Geschwistern ein unterschiedliches Maß an Resilienz eigen, das dabei geholfen hat, unser Schicksal zu formen. Den »Jungs« (auch wenn sie heute über 50 oder 60 sind, nenne ich meine Brüder in Gedanken noch immer »die Jungs«) scheint es trotz all ihrer Fehltritte und kleinerer Vergehen besser ergangen zu sein als uns »Mädchen« – sie haben ihre Vergangenheit schlicht besser hinter sich gelassen. Ich hingegen brauche große Mengen an Tabletten, nur um durch den Tag zu kommen, schlucke 20 Milligramm hiervon und 70 Milligramm davon, Dopaminfreisetzungsverstärker, Stimmungsstabilisatoren und Stimmungsaufheller, eine Handvoll Pillen in verschiedenen Farben, Formen und Größen, welche die Biochemie meines Gehirns auf Arten und Weisen verändern, die niemand wirklich versteht, welche aber dennoch die Erklärung dafür sind, dass ich noch da bin, um diese ganze verdammte Geschichte hier zu erzählen.
Einige von uns haben größere Narben davongetragen als die anderen, doch jeder ist auf seine oder ihre Weise davon betroffen. Aber wenn wir herausfinden könnten, was unsere Eltern dazu gebracht hat, sich so zu verhalten, wie sie sich verhalten haben, und was uns dazu angehalten hat, so darauf zu reagieren, wie wir reagiert haben – würde das noch irgendeinem von uns helfen? Und ich frage mich auch: Wenn wir die Möglichkeit hätten, jemanden völlig anderen aus uns zu machen und die ganze Geschichte unseres Elends aus unserem Gedächtnis zu streichen, würden wir diese Möglichkeit wahrnehmen können? Ist es nicht die Essenz eines Traumas, dass es sich ständig wiederholt, und ist es nicht ebenso die Essenz von Neurosen, sich jeder Art von Veränderung zu verweigern und Angst vor jedem Schritt zu haben, der aus den Schatten des Vertrauten hinaus ans Licht führen könnte? Was wäre aus mir geworden, wenn ich nicht so geworden wäre, wie ich heute bin? Trotz all dessen, was mich an mir stört, kann ich mir kaum vorstellen, wie ich leben würde, wenn ich jemand anderes wäre, jemand, der mit dem Wind von Liebe im Rücken in die Welt geschickt wurde.
*
Das Problem mit der Rückschau auf das eigene Leben besteht darin: Ich bin mir nie sicher, wie viel Glauben ich meinen Erinnerungen schenken soll und ob ich mich tatsächlich an das genaue Geschehen erinnere oder daran, was ich mir zurechtgelegt habe, nachdem dieses Geschehen vorbei war. Einer meiner Brüder besteht darauf, dass er sich an den Tag seiner Geburt erinnern kann, aber in unserer Familie genießt er den Ruf, dass er es mit der Wahrheit nicht ganz so genau nimmt, daher glaube ich, dass seine Behauptung mit Vorsicht zu genießen ist. Ich muss oft an den Schriftsteller William Maxwell denken, der in seinem zwischen Fiktion und Memoiren schwankenden Roman Also dann bis morgen schreibt, wir alle würden mit jedem Atemzug lügen, wenn wir über die Vergangenheit reden.
Die Wahrheit ist, dass einige von uns ein besseres – und auch genaueres – Gedächtnis haben als andere. (Ich meine damit nicht nur faktische, sondern auch affektive Erinnerungen, die auf emotionalen und visuellen Gedächtnisleistungen beruhen anstatt darauf, Fakten oder andere konkrete Informationen abzuspeichern.) Dabei handelt es sich im Grunde um eine Frage der Anpassung: Einige von uns überleben, indem sie ihre eigenen Erfahrungen unterdrücken oder negieren, während die anderen den Unwillen und die Demütigungen ihrer Vergangenheit zu bewältigen suchen, indem sie diese fest im Gedächtnis verankern, um sie besser aufrufen zu können und nochmals zu durchlaufen. Ich selbst, würde ich sagen, gehöre zur zweiten Kategorie. Obwohl es viel gibt, an das ich mich nicht erinnere, und obwohl ganze Zeitabschnitte für immer in den Tiefen meines Gedächtnisses verloren gegangen sind, glaube ich, dass es mir guttäte, wenn ich mehr vergessen könnte – wenn ich die Hände von den Kümmernissen und Sorgen lassen könnte und nicht mit aller Kraft an ihnen festhielte.
Hier bin ich also, gerade mal ein Jahr alt, auf einem uralten Schwarz-Weiß-Foto, und halte mich an den Stangen des Laufgitters fest, in das ich eines Nachmittags im Garten hinter unserem ersten Sommerhaus in Long Beach gesteckt wurde, eine Autostunde von Manhattan entfernt. Natürlich muss jemand dieses Foto gemacht haben, aber was es für mich ausdrückt, ist das Gefühl völliger Einsamkeit. Das eindrucksvolle Haus hat rote Ziegel und weiße Holzverzierungen und befindet sich an der Ecke der West Beach Street; der Himmel an diesem heißen Juni- oder Julitag in den 1950er Jahren ist gleißend hell. Laufgitter sind heute nicht mehr besonders in Mode – ich glaube, ich habe meine eigene Tochter nur wenige Male in eines gesetzt, obwohl meine Mutter sie mir als wahre Wunderwerke der Kindererziehung ans Herz gelegt hatte –, und ich verstehe auch warum: Im Grunde handelt es sich bei ihnen um kleine Gefängnisse, die dazu da sind, das Leben des Kinderbetreuenden leichter zu machen und das Kind einzusperren. Das Kind ist darüber nicht glücklich.
Ich trage nichts als eine Stoffwindel, die von einer Sicherheitsnadel zusammengehalten wird und aus der mein Bäuchlein herausquillt. Ich habe leichte X-Beine. Meine feinen Haare sind noch immer die eines Babys und kurz geschnitten, auf jene verunstaltende Weise, wie sie in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts üblich war, mit jenem zur Mitte der Stirn reichenden Pony also, den man an Kindern heute nicht mehr sieht. Ich sehe einigermaßen niedlich aus mit meinen großen braunen Augen – ich bin das einzige von uns sechs Kindern, das die dunklen Augen des Vaters und nicht die hellen der Mutter geerbt hat, ein Detail, das mir in den folgenden Jahren das Gefühl geben wird, auf ungerechte Weise ausgesondert worden zu sein.
Ich muss mir Mühe gegeben haben, mich in eine aufrechte Position zu bringen – ich muss es in vorsichtig geplanten Stufen getan und mich hochkonzentriert an den Stangen des Laufgitters hochgezogen haben –, und es wäre sicherlich schön gewesen, wenn jemand diese Leistung gewürdigt hätte, aber es gibt zu viele andere Kinder, auf die man aufpassen muss, und meine Mutter ist ohnehin nicht jemand, die meine Fortschritte verfolgt. Sie befindet sich in einem Liegestuhl am anderen Ende des Gartens, wenn sie überhaupt in der Nähe ist. Sie liest einen Roman oder unterhält sich mit einem ihrer vielen israelischen Verwandten, die sie auf Kosten meines Vaters besuchen, um zu sehen, wie es ihr mit ihrem reichen Ehemann im christlichen Amerika ergangen ist. Meine Sehnsucht nach meiner Mutter entspricht exakt dem Maße ihrer Unerreichbarkeit. Ich wünsche mir, sie würde herüberkommen, mich hochheben und ihr Gesicht an das meine drücken. Das tut sie sehr selten. Stattdessen werde ich zunächst der Obhut einer Säuglingsschwester übergeben, an deren Namen ich mich nicht erinnern kann und die wie meine Eltern eine Immigrantin aus Deutschland ist – sie ist mit Sicherheit effizient, neigt aber auch nicht dazu, Zärtlichkeit zum Ausdruck zu bringen –, und dann der Obhut von Jane, der Putzfrau, die in den Niederlanden geboren worden war und kurz vor meiner Geburt in einer impulsiven Entscheidung von meiner Mutter angestellt wurde, um auf uns sechs Kinder aufzupassen. Jane ist die Geißel meiner Kindheit.
Ich stelle mir vor, wie hilflos ich mich in dem Laufgitter gefühlt haben muss, so ganz mit mir allein. Ich bin mir sicher, dass im Hintergrund die vertraute Geräuschkulisse des Sommers zu hören war – das Brummen der Rasenmäher, das Surren der Mücken und das gelegentliche Zirpen der Vögel –, aber mir kam es so vor, als wäre ich nicht anwesend, als hätte ich auch genauso an einem anderen Ort sein können. In welchem Alter beginnen die Erregungen der Angst und das Gefühl, sich im Nirgendwo zu befinden, zu niemandem zu gehören? Ich nehme an, es hat irgendwann in dieser Zeit angefangen, dieses Grundgefühl, das einem Taumeln gleicht und sich in dem nicht abzuschüttelnden Eindruck niederschlägt, sich an einem Ort zu befinden, der keiner ist.
Dieses Gefühl einer ursprünglichen, existentiellen Verrückung verfolgt mich bis heute, so sehr, dass ich mich an einem Spätnachmittag in Midtown Manhattan wiederfinden kann, keine zwanzig Straßenblocks von dem Haus entfernt, in dem ich aufgewachsen bin, und mich trotz allem wie ein entwurzelter Fremdling fühle. Auf der Sixth Avenue irgendwo zwischen 53rd und 58th Street, auf der Third Avenue irgendwo zwischen 40th und 50th Street: Was sind das für Straßenzüge, woher kommen all diese Hochhäuser mit ihren vielen Büros, und, noch viel verwirrender, wer bin ich nochmal? Dieses tiefsitzende Gefühl von Angst kann überall außerhalb des Viertels eintreten, in dem ich wohne und das ich streng eingegrenzt habe. Dieses Wohnviertel umfasst in etwa 20 Straßen, die mir vertraut sind und mir fast wie eine Erweiterung meiner Wohnung vorkommen. Es ist beinahe so, als würde mir der innere Kompass fehlen, jenes Gefühl also, das einen nach links und nicht nach rechts gehen lässt oder einen lenkt, wenn man aus der U-Bahn steigt, damit man nicht ein paar Minuten lang in die falsche Richtung läuft, bevor einem auffällt, wo man sich befindet – etwas, das mir oft passiert.
Irgendwann muss ich in jenem Laufgitter zu Boden gefallen sein und zu weinen begonnen haben; es ist kein forderndes Weinen, sondern ein weiches, nutzloses Jammern, das keinen Trost erwartet. Ich frage mich, wie lange ich dort gesessen habe, bevor jemand zu mir kam, um mich zu erlösen, oder ob ich letztlich einfach aufgegeben und mich in den Schlaf gewunden habe, mit der Hilfe eines Schnullers vielleicht oder meines Daumens. Obwohl man mich als Kind für eine zügellose Heulsuse hielt und ich mich an viele Heulanfälle in meinen Zwanzigern und Dreißigern erinnere, weine ich heute nur noch selten. Aber dieser Mangel an Erwartung, was die Linderung meines Leidens, was sein nahendes Ende betrifft, begleitet mich noch immer, so sehr, dass ich viel zu leicht in einen Modus der Hoffnungslosigkeit verfalle, selbst wenn etwas Unwichtiges schiefgeht. Wo eine andere Person dazu übergeht, das vor ihr liegende Problem zu lösen, wiege ich mich im Wind, bereit, umgestoßen zu werden, bereit, aufzugeben. Ich bewundere den Einfallsreichtum, den andere Menschen entwickeln, wenn ihre Pläne fehlschlagen – jene Menschen, die sich glauben machen können, dass jeder Rückschlag auch ein neuer Ansporn sei, jene Menschen, die wieder aufstehen, wenn sie hingefallen sind, sich den Staub von der Kleidung wischen und noch einmal von Neuem beginnen –, aber ich finde keinen Weg, es ihnen nachzutun.
3
Sich das Leben zu nehmen hatte schon immer eine große Anziehungskraft auf mich: Mich faszinieren Menschen, die so tollkühn sind, den Vorhang zuzuziehen und so ihrem Leid ein Ende zu setzen, anstatt sich misslaunig herumzudrücken und auf bessere Zeiten zu hoffen. Ich kenne all die Diskussionen über die Feigheit, die Selbstbezogenheit (und erst recht die Wut), die mit dem Selbstmord einhergehen müssen – aber nichts kann mich davon abbringen, zu glauben, dass diese Tat nicht auch einen gewissen Mut erfordert, eine stählerne Affirmation der Selbstauslöschung. Ich schubse mich weiter durch die Tage, versuche, meinem Leben einen Sinn zu geben, versuche, dieses Buch über das Leben zu schreiben, während ich eigentlich sterben möchte – und ich komme nicht umhin, Notiz davon zu nehmen, dass andere Menschen während all dessen aufgeben und einen Schlussstrich ziehen, einige von ihnen berühmt wie Robin Williams oder Philip Seymour Hoffman, andere nicht.
So haben sich etwa zwei Lyriker vor einiger Zeit im selben Jahr das Leben genommen, im Abstand von acht Monaten. Ich hatte keinen von beiden zum Zeitpunkt ihres Todes gelesen, obwohl ich eine recht passionierte Leserin von Lyrik bin. Eine von ihnen, Deborah Digges, war 59, im gleichen Alter also wie Virginia Woolf – die Schriftstellerin, deren Romane und deren Empfindungsvermögen mir am meisten bedeuten –, als sie sich dazu entschied, einen Schlussstrich zu ziehen. Digges sprang von der oberen Tribüne des Sportstadions einer Universität. Auf dem Autorenfoto, das in ihrem letzten Gedichtband The Wind Blows Through the Doors of My Heart (»Der Wind weht durch die Türen meines Herzens«) abgedruckt ist, sieht sie sehr schön aus. In einer makabren Koinzidenz lag, kurz nachdem sie gestorben war, ein Rezensionsexemplar dieses Bandes in meiner Post. Sie sieht auch sehr jung aus auf diesem Foto, fast schon mädchenhaft, und ich frage mich, ob es sich dabei um ihr Lieblingsfoto gehandelt hatte oder ob sie es einfach nicht wichtig fand, ein aktuelles Foto von sich machen zu lassen.
Ich stelle mir zudem eine Reihe anderer Fragen: Ob insbesondere auch die Wochenenden, die Digges durchlebte, so frei von jeder Form der Erleichterung waren wie meine. Hielt sie eine Art Winterschlaf, wie ich es tue, und verbrachte sie den größten Teil des Tages im Bett, wachte sie am späten Morgen kurz einmal auf und dann noch einmal am frühen Nachmittag? Aber nur um die Kissen aufzuschütteln, wieder etwas Leben in ihre müden Federn zu bringen und sich danach erneut der friedlichen Welt des Schlafes zu übergeben – und mit anderen Worten noch nicht einmal zu versuchen, Pläne für den Tag zu machen? Führte auch sie ihr Leben in ihren Träumen noch einmal neu, so wie ich, die ich träumend meine toten Eltern wieder auferstehen lasse, Kontakt zu lange verflossenen Liebhabern aufnehme, das zweite Kind im Bauch trage, das ich nie hatte, oder jenen Freund von ganz früher heirate, der nicht mein Typ war, aber von dem ich mir gewünscht hätte, ich hätte sein Typ sein können? Nur um im gleichen Bett wie immer aufzuwachen und festzustellen, dass das Nachthemd durchgeschwitzt ist und am Körper klebt?
Etwas mehr als ein Jahr später, Anfang Mai an einem Donnerstagabend gegen sieben Uhr, werde ich wieder in diesem Bett liegen. Ich bin vom Gefühl erfüllt, dass es nicht möglich ist, psychisch noch tiefer zu sinken, und stelle mir die Frage, ob ich dazu in der Lage sei, mich umzubringen. Ich frage mich, was die sinnvollste Art und Weise wäre, ob ich einen Abschiedsbrief hinterlassen soll, wie unumstößlich die grausamen Folgen wären, die diese Tat für meine Tochter hätte. Ich frage mich, ob neun Stockwerke hoch genug sind, um sicherzugehen, dass ich sterbe (die Schauspielerin Elizabeth Hartman, so ergreifend als blindes Mädchen in Träumende Lippen und etwas später als Priss in Die Clique, »fiel« aus einem Fenster im fünften Stock in ihren Tod) – oder ob auch bei dieser Höhe die Möglichkeit bestünde, auf den Asphalt zu schmettern, zu überleben und dann sein Dasein als Krüppel zu fristen.
Eine Freundin von mir, die im oberen Teil der Upper East Side wohnt – »dort, wo diese ins benachbarte Spanish Harlem übergeht«, wie sie sagt –, erzählte mir kürzlich von einer Frau, die zusammen mit ihrem kleinen Hund jeden Morgen in der Lobby des mehrstöckigen Wohnhauses Zeit mit den Portiers verbrachte. »Sie hatte immer diesen ungefärbten Haaransatz, das hat mich richtiggehend verfolgt«, erklärte diese Freundin. »Sie trug ihr Haar in der Mitte gescheitelt, fünf Zentimeter davon grau, der Rest war in einem sehr dunklen Braun gefärbt. Und ich habe immer auf sie herabgeschaut, ich konnte wirklich nicht verstehen, warum sie nicht zum Friseur ging, es hat mich sehr gestört. Dann sprang sie vom Dach unseres Gebäudes, und ich fühlte mich schrecklich, weil ich sie wegen ihrer Haare jeden Morgen in der Lobby nur schlechtgelaunt angeknurrt habe, anstatt mit ihr zu reden.« Ich muss daran denken, wie lange ich oft warte, bis ich mein Haar färben lasse, und frage mich, ob es innerhalb einer bestimmten Schicht von Frauen ein Anzeichen für wachsende Verzweiflung darstellt, wenn man seinen Haaransatz nicht nachfärben lässt, so wie die nicht pedikürten Zehennägel von Marilyn Monroe.
Dann war da noch die 42-jährige Lyrikerin, die ich nicht persönlich kannte, aber von der ich gehört hatte, dass sie am Weihnachtstag 2009 den Schlussstrich zog. Sie unterrichtete am 92nd Street Y, einem Kulturzentrum, an dem ich einige Jahre lang Kurse in der »Kunst des Lesens« und Schreibkurse für Memoiren gegeben habe. Es ist also sogar möglich, dass wir uns beim Betreten oder Verlassen des Instituts über den Weg gelaufen sind. Wir hätten uns miteinander anfreunden und unsere persönlichen Kriegsgeschichten miteinander teilen können. Wie die New York Times berichtete, geriet Rachel Wetzsteon in Verzweiflung, weil ihre dreijährige Liebesbeziehung gerade zu Ende gegangen war. Es war auch bekannt, dass sie an Depressionen litt, was keine besondere Überraschung war. Ich frage mich, auf welche Art und Weise sie sich das Leben nahm, und erkundige mich bei einer Freundin, von der ich glaube, dass sie zum Kreis jener gehört, die das wissen könnten. Diese Freundin schreibt mir, dass die Dichterin sich erhängt habe, zumindest werde das so erzählt.
Die verschiedenen Methoden des Freitods haben mich schon immer genauso interessiert wie die Finalität dieser Tat an sich. Wer griff auf Feuer zurück? Wer auf Wasser? Wer auf Tabletten? Wer benutzte eine Rasierklinge dafür? Rachel Roberts, die talentierte walisische Schauspielerin, die in den 1960er Jahren in düsteren Filmen aus Großbritannien mitgespielt hat, in Samstagnacht bis Samstagmorgen etwa oder Lockender Lorbeer, hörte nie auf, sich nach ihrem Ex-Ehemann Rex Harrison und dem glamourösen Leben zu sehnen, das dieser ihr ermöglicht hatte, auch lange noch, nachdem die beiden geschieden waren und sie ihren ergreifenden, posthum veröffentlichten Tagebüchern No Bells on Sunday (»Keine Glocken am Sonntag«) zufolge der Alkoholabhängigkeit anheimfiel. Im Alter von 53 Jahren schluckte sie Natronlauge, warf sich dann in einen Raumteiler aus Glas und fügte sich so eine Art doppeltes Harakiri zu. Sich zu erhängen scheint eine Menge logistischer Sorgfalt zu erfordern, ich sehe nicht, wie ich diesen Weg einschlagen könnte. Insbesondere mache ich mir Sorgen, dass ich den Hocker oder den Stuhl im falschen Augenblick umkippen und dann einfach so hängen würde, im Ersticken begriffen, aber nicht tot. Oder dass das Seil nicht kurz genug wäre, diese Art von Fehler also. Ich glaube nicht, dass ich über die eiserne Willenskraft und die planerischen Fähigkeiten eines David Foster Wallace verfüge, der sich, wie berichtet wird, die Handgelenke mit Klebeband zusammenklebte, bevor er sich erhängte.





























