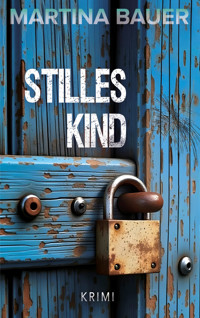2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
19. Oktober, Nordseeküste, Schillig/Ostfriesland. Ein herrenloser Border Collie irrt durch die nächtliche Wattlandschaft und kratzt entkräftet an der Tür von Melissas Ferienhaus. Kurzentschlossen nimmt sie den Vierbeiner bei sich auf, verspricht seine Gesellschaft doch eine gewisse Sicherheit in einer Gegend, wo das Verschwinden von zwei jungen Frauen die Bewohner in tiefe Besorgnis stürzt. Doch der Hund trägt ein Geheimnis. Versteckt in seinem Halsband findet Melissa einen Zettel mit einer rätselhaften Nachricht. Handelt es sich um einen Hilferuf? Nur der sympathische Kommissar Adam Janssen scheint ihre Befürchtungen ernst zu nehmen, doch die Suche nach den Vermissten nimmt die Ressourcen der Polizei in Anspruch. Auf ihrer erschütternden Suche nach Antworten folgt Melissa einer Spur, stets begleitet von ihrem neuen tierischen Gefährten. Sie ahnt nicht, dass diese Fährte sie direkt in die Hände eines Frauenmörders führt. Der Täter hat ihr Grab bereits geschaufelt!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
1. Was aus dem Nebel kam
2. Nachrichten aus dem Leuchtturm
3. Das traurige Schicksal der Charlotte R.
4. Unter der Treppe
5. Melissa bekommt Besuch
6. Einmal Burger mit Pommes und ein Dolch, bitte
7. Bleib bei mir
8. Von Hausbesetzern und Hausbesitzern
9. Ebbe
10. Ene meine miste, wer steckt in deiner Kiste?
11. Nichts ist klar, Herr Kommissar
12. Melissa bei den Engeln
Über Martina Bauer
Leseprobe "Die Tränen der Toten"
Leseprobe "Schlechtes Blut"
Copyright
Mein Grab im Watt
Teil 1 der Reihe um Melissa Dietrich
Küstenkrimi
Martina Bauer
Ausgezeichnet mit dem Qindie-Logo. Qindie steht für qualitativ hochwertige Indie-Publikationen. Achten Sie also künftig auf das Qindie-Siegel! Für weitere Informationen, News und Veranstaltungen besuchen Sie unsere Website: www.qindie.de
© 2023 Martina Bauer
Inhaltsverzeichnis und Impressum
1.Was aus dem Nebel kam
Früher hat mir meine Großmutter vor dem Einschlafen Geschichten erzählt. Als Nachtlicht besaß ich eine magische Laterne, deren mit Schäfchen bedruckter Lampenschirm sich sanft drehte und verzerrte Muster über Großmutters runzeliges Gesicht huschen ließ. Dunkler, heller, dunkler: Es war, als hätte sie verschiedene Gesichter, und genauso unterschiedlich waren ihre Gutenachtgeschichten. Beim Erzählen kniff sie nachdenklich die Augen zusammen, sodass ich nicht wusste, ob sie sich alles ausdachte oder ob es wirklich so passiert war, wie sie es beschrieb. Manches war lustig und brachte mich zum Kichern, aber oftmals waren die Geschichten gruselig. Vielleicht zu gruselig für ein Kind in meinem Alter, aber ich bettelte trotzdem immer wieder darum, von ihr ins Bett gebracht zu werden. Gespannt zog ich die Bettdecke bis zur Nasenspitze, sodass ich sie schnell übers Gesicht ziehen konnte, wenn es zu aufregend wurde.
Einmal erzählte Großmutter von einer Frau, die sich im Moor verlief. In der Dunkelheit irrte sie umher und geriet dabei immer tiefer in den tödlichen Sumpf, bis sie schließlich in ein Wasserloch stürzte und im Moor unterging. Sie wurde nie gefunden, aber fortan strich ihr Geist durch das Moor und suchte vergeblich den Weg hinaus.
In dieser Nacht fand ich, damals noch ein kleines Mädchen, kaum Schlaf.
Viele Jahre lang hatte ich nicht mehr an diese Geschichte gedacht. An diesem Oktoberabend, als die Sohlen meiner Gummistiefel im Schlick einsanken, fiel sie mir wieder ein. Es fühlte sich an, als wollte mich der Boden festhalten; er saugte und zog, als versuchte er, mich sich einzuverleiben. Es hatte etwas Schlüpfriges, fast Obszönes, wie der Schlamm nach oben quoll.
Beim Rausgehen hatte ich die Temperaturen unterschätzt. Ich trug meinen Windbreaker über einem dünnen Pullover und bis zu den Knien hochgekrempelte Jeans. Trotz Wollsocken waren meine Füße eiskalt.
Feiner Sprühnebel erfüllte die Luft, und meine Klamotten fühlten sich klamm an und klebten auf der Haut. Ich fror erbärmlich; eigentlich hatte ich vor dem Schlafengehen nur einen kurzen Strandspaziergang unternehmen wollen, aber die sternenklare Nacht zeigte sich so wunderschön, dass es mich immer weiter hinauszog. Die Oberfläche des Wattenmeeres funkelte und glitzerte im Licht des Vollmondes wie mit Kristallen übersät.
Ein Windstoß fuhr in mein Haar und zerzauste es, wie Großmutters schwielige Hand, wenn sie mich rügen wollte, weil ich ungezogen war: Du solltest nicht so weit rauslaufen. Es ist viel zu gefährlich.
Ich war zum ersten Mal an der Nordsee und hatte mich auf der Stelle in die Endlosigkeit des Wattenmeeres verliebt, in diese glitschige, nasskalte Wüste, die zweimal täglich im Meer versank und wenige Stunden später wieder auftauchte.
Blitzschnell, in der kurzen Zeitspanne zwischen zwei Lidschlägen, veränderte sich die Stimmung.
Das Licht war trübe geworden. Mehrmals hintereinander blinzelte ich, aber um einen Schleier, der sich auf meine Linse gelegt hatte, handelte es sich nicht. Dichter Nebel war wie aus dem Nichts aufgezogen. Keine Schwaden hatten mich vor ihm gewarnt; von jetzt auf gleich umgab mich eine dicke graue Suppe. Die klaren Umrisse des Mondes verschwammen zu einem unscharfen blassen Antlitz. Die Küste war nun kaum noch zu erkennen. Der morastige Boden unter mir schmatzte bei jedem Schritt stärker: Das Wasser begann zu steigen.
Melissa, dachte ich. Du dummes, dummes Ding! Warum hast du dich so weit hinausgewagt? Jedes Kind wusste, wie schnell man sich im Watt verirrte!
So schnell ich konnte, eilte ich in die Richtung, in der ich die rettende Sicherheit des Strandes vermutete. Die nahende Flut schwappte nicht in sanften Wellen heran, wie ich mir die Gezeiten immer vorgestellt hatte; das Wasser schien direkt aus dem Boden zu sprudeln. Aus allen Richtungen floss es auf mich zu. Salzwasser brandete schäumend heran, nicht mehr lange, und es stand hoch genug, um in meine Stiefel hineinzulaufen. Dann würde ich noch langsamer vorankommen. Die blanke Angst saß mir im Nacken. Ich wusste, dass es kaum möglich war, ein fest angepeiltes Ziel zu erreichen, wenn man erst einmal die Orientierung verloren hatte. Und ich wusste auch, dass man ohne feste Orientierungspunkte nie genau geradeaus lief, sondern automatisch einen Kreis beschrieb und ungewollt zum Ausgangspunkt zurückkehrte.
Und dann tappten meine Stiefel über trockenen Sand. Erleichtert sog ich die kalte, salzige Luft ein.
Hier an Land war der Nebel schwächer. Ich erklomm den Deich und erblickte das kleine, weiß getünchte Ferienhaus mit dem reetgedeckten Dach, das ich bewohnte. Ich hatte es geschafft. Ich war dem Meer entkommen. Aber es hätte anders ausgehen können: Was war nur in mich gefahren, dass ich mich so weit ins Watt gewagt hatte, im Dunkeln und ohne ortskundigen Führer?
Ein klagender Laut hallte durch die Nacht, gedämpft und verzerrt durch den Nebel.
Hier im Norden existierte die Sage vom Gonger, dem untoten Seemann, der aus dem Meer zurückkehrte und Rache für seine Ermordung forderte. Beim letzten Glockenschlag um Mitternacht entstieg er den Wellen, um seine Peiniger aufzusuchen und mit hinauszunehmen in sein nasses Grab. Seine Berührung reichte aus, einen zu seinesgleichen zu machen. In dieser Abgeschiedenheit, links von mir das ewige Meer und rechter Hand endlose Wiesen und Salzwiesen, fiel es nicht allzu schwer, an den Gonger zu glauben. Wie spät war es? Wie lange noch bis Mitternacht?
Was, wenn gleich die Glocken anfangen würden zu schlagen?
Ich hastete am Deich entlang. Keuchend und zitternd vor Kälte erreichte ich schließlich das Ferienhaus.
Ursprünglich hatte ich geplant, mit meiner besten Freundin Sina in den Urlaub zu fahren. Wir wollten ans Meer, ins Warme, an einen Palmenstrand. Wir wollten aus Kokosnüssen Cocktails schlürfen, muskelbepackte junge Männer in Badehosen bewundern und am Morgen eine Schneise durchs Frühstücksbüfett pflügen. Aber dann zog das Unternehmen, für das Sina arbeitete, einen fetten Auftrag an Land. Sie wurde mit Arbeit überschüttet und gab alles, um auf der Karriereleiter nach oben zu steigen. Schweren Herzens sagte Sina die gemeinsame Reise ab.
Das Schild mit der Aufschrift »Wir machen Urlaub« lag schon unter der Theke und wartete darauf, an der Tür meines Ladens für Geschenkartikel angebracht zu werden. Wir verschoben Jamaika auf das kommende Jahr. Ich hatte keine Lust, stundenlang alleine im Flieger zu sitzen und um die halbe Welt zu tingeln, und beschloss, in Deutschland zu bleiben. Beim Stöbern durch die Seiten der Reiseanbieter stieß ich auf das Foto des abgeschiedenen Häuschens mit den dunkelblau gestrichenen Fensterläden auf einem hübschen Gartengrundstück und verliebte mich auf der Stelle in es. Also setzte ich mich in meinen Wagen und machte mich auf die dreistündige Reise an die Waterkant. Seit drei Tagen unternahm ich nun ausgiebige Spaziergänge am Strand entlang, besichtigte Windmühlen und trank schwarzen Tee in einem der heimeligen Cafés oder einer der Teestuben in der Gegend. Ich versuchte, die Einsamkeit zu genießen, was mir teilweise gelang; endlich hatte ich jede Menge Zeit zum Lesen und konnte im Bett liegen bleiben, so lange ich Lust dazu hatte. Die Adventszeit rückte näher, und bald würde das Weihnachtsgeschäft in meinem Laden starten, sodass mir jeden Abend nach dem Umgang mit anspruchsvollen Kunden der Kopf brummte. Die Ruhe im Urlaub tat mir gut.
Aber mit ein wenig netter Gesellschaft wäre es besser gewesen.
Der Schlüssel steckte in meiner vorderen Jeanstasche. Mit meiner klammen, feuchten Hand schaffte ich es kaum, ihn aus der eng sitzenden Hose zu pfriemeln, und als ich ihn endlich zwischen den Fingern hielt, fiel er mir gleich wieder hinunter. Ich musste zwischen Grasbüscheln danach suchen und dachte eine schreckliche Minute lang, ich würde ihn in der Dunkelheit nicht wiederfinden. Schließlich entdeckte ich ihn, schlüpfte aus den schmutzigen Stiefeln und schloss die Haustür auf, wo mich gedämpftes Licht und Wärme empfingen.
Ich war in Sicherheit.
Zumindest glaubte ich das an jenem Abend. Es sollte sich herausstellen, dass ich mich fürchterlich irrte.
#
Das Häuschen bot gerade genügend Platz für eine bis zwei Personen, aber es war ansprechend und gemütlich eingerichtet. Für die Nordsee typischer Nippes stand überall herum. Muscheln lagen auf der Fensterbank. Das Seifenstück im Badezimmer besaß die Form eines Ankers, die Bettwäsche war mit Bildern der blaugrauen, stürmischen See bedruckt. Solche Dinge, wie ich sie verkaufen würde, stünde mein Geschenkartikelladen hier am Meer und nicht in der Lüneburger Heide. Gerade so viel Schnickschnack, dass es ansprechend und noch nicht kitschig wirkte.
Und es gab eine Badewanne. Ich ließ sie volllaufen, glitt seufzend ins heiße Wasser und wärmte meine durchgefrorenen Glieder auf. Ich türmte Badeschaum auf meinen Kopf zu einer Marge-Simpson-Frisur und schnitt mir im Spiegel eine Grimasse. Du bist wie ein achtundzwanzig Jahre altes Kind, Melissa, schimpfte ich mich selbst. Ein Kind, das nur Unsinn im Kopf hat, sobald man es alleine lässt.
Der Spiegel lief an, mein Gesicht löste sich langsam auf und verschwamm wie der Mond im nächtlichen Nebel.
Mit einem Käsesandwich und einem Glas Cabernet Sauvignon setzte ich mich vor den Fernseher, eine Decke mit Strandmotiv um die Beine gewickelt – ich überlegte, ob ich warme Decken in meinem Laden verkaufen sollte, und welches heidetypische Motiv dafür geeignet wäre –, und sah mir eine Talkshow an. Politiker diskutierten mit Industriemagnaten und einer Moderatorin über die Gasversorgungslage und verdienten mit diesem Auftritt vermutlich mehr Geld, als mein Laden in einem Jahr an Gewinn abwarf. Plötzlich kam mir der Gedanke, dass ich bei der lautstarken Diskussion nicht mitbekam, wenn sich draußen etwas bewegte. Ich stellte den Ton leise.
Ein Fensterladen klapperte leicht im Wind. Ansonsten war alles still. Was sollte hier schon sein? An diesem menschenleeren Abschnitt der ostfriesischen Küste, nachts um halb eins?
Der Gonger, dachte ich.
Ich hätte nicht alleine hierherkommen sollen. Das nächste Haus lag mehr als einen Kilometer entfernt. Ein Fußmarsch ins nächste Städtchen dauerte fast eine halbe Stunde. An der Nordsee hört dich niemand schreien, dachte ich und ärgerte mich selbst über meine Nervosität.
Und dann vernahm ich es erneut. Ein klagender Laut, ein Heulen voller Verzweiflung und Schmerz, ein Geräusch, mit dem ich nichts zu tun haben wollte und das mich nichts anging, und ich war hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch, den Fernseher so laut zu stellen, dass ich die Welt draußen komplett ausklammern konnte, und dem Drang, hinauszugehen und nachzusehen, was da los war.
Bestimmt ist das nur der Wind, sagte ich mir. Der Nordseewind, der über den Deich strich und ungewöhnliche Geräusche erzeugte. Der durch Strandgrasbüschel fuhr, das Meer aufwühlte und in den Baumwipfeln tobte.
Die Talkshow war zu Ende. Zeit, schlafen zu gehen.
Das war keine sehr gute Idee. Glockenwach lag ich im Bett und lauschte. Wieder vernahm ich dieses Jammern, zuerst in der Ferne, dann war es eine Zeitlang still. Schließlich erklang es ganz nah an meinem Fenster. Und dann streifte etwas an der Hauswand entlang.
Kurz wurde es dunkler im Zimmer, und einen grässlichen Moment lang glaubte ich, eine Gestalt stünde vor der Scheibe. Aber es war nur eine Wolke, die am Mond vorüberzog.
Im Bett fühlte ich mich schutzlos. Eilig stand ich auf und schlüpfte in meine Sachen. Ich schnappte mir das Handy und überlegte, was ich der Polizei erzählen sollte: Ich habe ein einsames Ferienhaus gemietet. Nun fürchte ich mich, so ganz alleine in der Nacht. Ich habe ein seltsames Geräusch gehört. Würden sie einen Beamten herschicken?
Ganz bestimmt nicht, Melissa, die werden die Augen verdrehen und dich für eine überdrehte Pute halten, also sieh gefälligst selbst nach, was da draußen los ist, mit dem Handy in der Hand, damit du direkt einen Hilferuf lossenden kannst, wenn du dich bedroht fühlst!
Der Schlüssel drehte sich so laut im Schloss, dass alle Ungeheuer und Bösewichte auf der ganzen Welt den Kopf in meine Richtung drehten. Ich drückte die Tür einen Spalt auf und knipste die Außenlampe an. Schatten sprangen aus ihrem Versteck wie schwarze Kastenteufel. Terrassenmöbel warteten abgedeckt unter einer grünen Plane auf ihren Einsatz im nächsten Sommer. Meine Gummistiefel lagen mitten auf der Veranda, wo ich sie achtlos hingeworfen hatte.
Der Rest lag in tiefer Finsternis. Ums Haus herumzugehen, wagte ich nicht. Drinnen, hinter der verriegelten Tür, mit dem Handy unter dem Kopfkissen, wäre ich sicherer aufgehoben.
Gerade wollte ich die Tür wieder schließen, als ich links von mir ein Winseln vernahm. Um die Ecke des Hauses schlich ein Hund.
Er war mittelgroß, mit schwarz-weißem, halblangem Fell; schwarzer Rücken, schwarze Ohren, weiße Schnauze, weiße Beine und weißer Bauch. Ein Border Collie. Zumindest vermutete ich das, ich kannte mich mit Hunden nicht wirklich gut aus. Er hielt gebührend Abstand zu mir, schaute mich aber bettelnd an: Darf ich näher kommen?
Das Heulen, das Jaulen: nur ein harmloser Hund. Trotzdem wollte sich mein Herzschlag nicht beruhigen.
»Hallo?«, rief ich in die Dunkelheit. Niemand antwortete.
Ich warf einen Blick um die Ecke des Häuschens: wabernde Schwärze. Nun, ich konnte mir zwar nicht vorstellen, dass dieser Hund mit seinem Herrchen oder Frauchen zu einem verspäteten Gassi unterwegs war. Doch nicht so spät in der Nacht, nicht so weit hier draußen. Für einen Streuner wirkte er aber zu gepflegt, und er schaute recht gesund aus, soweit ich das beurteilen konnte. Zumindest war er nicht abgemagert, und die Augen blickten klar und interessiert. Ich beugte mich zu ihm hinunter. Er trug ein rotes Halsband, aber keine Hundemarke. Nur ein kleiner Anhänger in Form eines Leuchtturmes hing an dem Band.
»Geh weg«, sagte ich. »Verschwinde. Lauf nach Hause. Deine Leute suchen bestimmt schon nach dir.«
Aber der kleine Kerl machte keine Anstalten, die Veranda zu verlassen. Bettelnd schaute er mich an. Ich konnte ihn nicht einfach wegscheuchen. Nicht in dieser frostigen Oktobernacht, wo die Feuchtigkeit des Nebels in jede Ritze kroch, und der Wind immer stärker auffrischte.
Ich seufzte. »Na gut«, sagte ich. »Komm schon rein.«
Ich hielt die Haustür weit auf und dachte, verdammter Mist, jetzt versaut er mir den schönen hellen Holzfußboden und ich werde Stunden damit zubringen, den wieder sauber zu schrubben, damit mich Axel, der Vermieter, nicht tötet. Und wenn der Hund nicht stubenrein war? Wenn er in die Ecke pinkelte, oder einen Haufen auf den Küchenboden setzte?
Quatsch, Melissa, sagte ich mir. Der Hund war ausgewachsen, und so freundlich, wie er wirkte, war er bestimmt gut erzogen worden.
Den Schwanz zwischen die Hinterbeine geklemmt, schlich der Border Collie über die Schwelle. Kaum war er drinnen, bewegte er sich selbstsicherer; zügig trabte er ins Wohnzimmer. Ich sperrte die Nacht hinter uns aus und folgte ihm. Der Hund schnupperte an dem leeren Teller auf dem Couchtisch.
»Du hast bestimmt Hunger«, sagte ich.
Als Antwort stieß er mit der Schnauze gegen den Tellerrand, und ich konnte gerade noch vortreten und den Teller auffangen, bevor er auf dem Boden zerschellte. »Und wenn du die Hütte demolierst«, sagte ich drohend, »bist du schneller wieder draußen, als du Wau sagen kannst.«
Doch ich ahnte bereits, dass ich meinen Besucher so schnell nicht wieder loswerden würde.
Aus dem Kühlschrank holte ich meine letzten Wurstvorräte. Viel war das nicht. Ich füllte gekochten Schinken in eine Müslischale und schnitt Brot in kleine Würfel. Geräuschvoll vertilgte mein Gast restlos, was ich ihm anbot. Den Müsliriegel, den ich ihm hinhielt, verschlang er mit einem Happs. Ich füllte eine weitere Schüssel mit Wasser und stellte sie auf den Boden.
»Die Milch kriegst du nicht«, sagte ich, »ich weiß nicht, ob du die verträgst, und ich brauche welche für meinen Kaffee morgen früh.«
Er legte den Kopf schief und spitzte die Ohren, lauschte gespannt meiner Stimme. Als ich mich vorbeugte und ihm den Hals kraulte, schloss er genüsslich die Augen.
»Jetzt rede ich auch noch mit einem Hund«, sagte ich, »als wärst du ein Mensch.« Ich gähnte. »Ich bin müde, und es ist spät. Lass uns schlafen gehen. Und morgen früh fahren wir in die Stadt und hören uns mal um, ob jemand einen hübschen, schwarz-weißen Kerl vermisst, wie du einer bist.«
Im Schlafzimmer legte sich der Hund neben dem Bett auf den kleinen, gestreiften Läufer und winselte leise vor sich hin.
Ich konnte immer noch nicht schlafen. Nicht mit diesem Tier neben mir, das jedes Mal, wenn mein Bettzeug raschelte, alarmiert den Kopf hob. Nun hatte ich keine Angst mehr vor irgendwelchen Geistern oder Untoten, die durch den Nebel schlichen, oder anderen nächtlichen Herumtreibern. Das Schlafzimmer mit einem Lebewesen zu teilen, das man gerade erst kennengelernt hatte, und von dem man nicht wusste, wo es herkam, und welche Geschichte es hinter sich hatte, wirkte nicht besonders schlaffördernd. Und ich bildete mir ein, dass er mich nicht aus den Augen ließ. Wie soll man denn schlafen, wenn man die ganze Zeit angestarrt wird?
In den frühen Morgenstunden, ich hatte es gerade geschafft, einzudösen, sprang mein tierischer Gast zu mir ins Bett und legte sich auf meine Füße.
»Geh weg!«, schimpfte ich, setzte mich auf und schaltete die Nachttischlampe ein. Der Hund warf mir einen trotzigen Blick zu, der besagte: Du bekommst mich hier so schnell nicht raus.
Ich sprang aus dem Bett. »Raus hier! Sofort!« Zur Bestärkung streckte ich die Hand aus und zeigte auf den Fußboden, wo es, das musste ich zugeben, weniger gemütlich war. Aber der Hund schaute mich nur müde an und legte seinen Kopf ab, dann streckte er sich der Länge nach aus. Für mich blieb nicht allzu viel Platz übrig.
Nein, ich wollte das Bett nicht mit ihm teilen. Ich tappte ins Wohnzimmer und rollte mich auf der viel zu kleinen Couch ein, und es gelang mir, eine oder zwei Stunden zu schlafen.
#
Um kurz nach acht erwachte ich mit Kopfschmerzen und quälte mich von der Couch. Schlaftrunken warf ich einen Blick ins Schlafzimmer. Das dumme Ding lag immer noch in meinem Bett. Igittigitt, dachte ich, lauter Hundehaare und Schmutz auf der schönen Bettdecke! Träge hob der Hund den Kopf, warf mir einen gelangweilten Blick zu und legte sich wieder hin.
»Damit eins klar ist«, sagte ich. »Wir hatten einen One-Night-Stand. Mehr wird nicht aus uns beiden. Heute suchen wir deine Besitzer.«
Der Hund streckte sich, als wollte er sagen: Gib dir nur Mühe beim Suchen. Ich bleibe hier so lange liegen und ruhe mich aus.
#
Als der Duft von Rührei durch die Küche zog, kam er schließlich doch getapst und hob witternd die Schnauze in die Luft. Ich hatte mir eine Kanne Kaffee gekocht und trank ihn langsam. Dazu knabberte ich an einem Stück gebuttertem Toast und googelte. Hund zugelaufen, was tun? Ich fand die Telefonnummer einer hiesigen Tierrettungsorganisation und versuchte anzurufen, aber niemand ging ran. Wangerland Hund vermisst. Hier stieß ich auf einen Artikel über Anouk König, eine vermisste junge Frau aus der Gegend, die man erfolglos mit der Hilfe von Suchhunden versucht hatte aufzuspüren, und überflog ihn oberflächlich. Dann entdeckte ich eine Seite mit einer Liste mit Fotos von entlaufenen Haustieren, aber ein Border Collie befand sich nicht darunter. Also würde ich ihn ins Tierheim bringen. Ich googelte die Adresse und stellte fest, dass es auf direktem Weg zum Muschelmuseum lag, das ich besuchen wollte. Ich würde den Hund abgeben und gleich weiterfahren, um mein Touristenprogramm zu absolvieren.
Währenddessen fraß der Hund selig das Rührei, das ich eigentlich für mich selbst zubereitet hatte. Ich musste zusehen, dass ich ihn loswurde, bevor er vollends das Ruder übernahm.
Ich stellte das Geschirr in die Spüle. Zeit, zu gehen. Aber bevor ich den Hund ablieferte, wollte ich ihn ein bisschen bürsten. Mit einem grobzinkigen Kamm versuchte ich sein Fell notdürftig zu entwirren. Das Halsband war mir im Weg, daher nahm ich es ab und legte es auf den Holzfußboden. Dabei löste sich das Dach von dem Leuchtturm-Anhänger. Ich sah, dass es einfach aufgeschraubt war; in dem Gehäuse steckte ein kleiner Zettel. Ich nahm ihn heraus und faltete ihn auseinander.
Darauf war in krakeliger Kinderschrift geschrieben:
Halo
Ich heise Felix von Barkenhait
Mama und Papa schlagen mich und sperren mich ain
Sie wolen mich nicht mehr haben
Bitte helfen sie
Ich dachte, mein Herz müsste stehen bleiben. Schreckliche Bilder schossen durch meinen Kopf von einem Kind, eingeschlossen in seinem Zimmer oder womöglich in einem Kellerraum, vernachlässigt und misshandelt, das keine andere Möglichkeit sah, die Außenwelt über seine Situation zu informieren.
Eilig zog ich mich um, kämmte mein Haar und putzte die Zähne. Eine Dusche wäre schön gewesen, musste aber ausfallen. Zu trödeln konnte ich mir nicht leisten. Hier steckte ein Kind in der Klemme, und ich war womöglich die Einzige, die ihm helfen konnte.
2.Nachrichten aus dem Leuchtturm
Das Polizeirevier war ein zweckmäßiger, dreigeschossiger Neubau mit verklinkerter Außenfassade in der Nähe des Hafens. Modern und schmucklos wirkte das Gebäude wenig einladend auf mich. Ich stellte meinen Wagen in der Nähe des Eingangs ab. Das Wetter hatte umgeschlagen, die Sonne schien von einem strahlend blauen Himmel, der Nebel hatte sich komplett verzogen und ein leichter Wind kühlte meine erhitzten Wangen. Ich hatte die Bettwäsche abgezogen und die Rückbank damit ausgelegt, damit der Hund mir nicht auch noch das Auto einsaute. Ich würde ein zweites Paar Bettwäsche für das Ferienhaus kaufen müssen.
Ich überlegte, ob ich den Hund mit reinnehmen sollte. Wahrscheinlich durfte ich das nicht. Aber war er nicht so etwas wie ein … Beweisstück? Ich besaß keine Leine, an der ich ihn hätte irgendwo anbinden können.
»Du musst im Auto bleiben«, sagte ich. »Es wird nicht lange dauern. Sei schön brav.« Obwohl mir die Zeit unter den Nägeln brannte, hatte ich ihn sein Geschäft erledigen lassen, bevor ich losgefahren war.
Hinter der gläsernen Eingangstür befand sich eine Art Informationsschalter. Die Frau dahinter musterte mich aufmerksam, während ich mein Anliegen schilderte, wirkte aber nicht übermäßig besorgt. Eher so, als stünde tagtäglich eine junge Frau vor ihr mit dem Hilferuf eines kreuzunglücklichen Kindes.
»Ich melde Sie bei einem Beamten an«, sagte sie, »mit dem Sie sprechen können. Einen Moment bitte.«
Sie hielt den Hörer eine Zeitlang ans Ohr, aber nichts passierte. »Kommissar Petersen nimmt nicht ab«, sagte sie, »vielleicht ist er kurz nicht an seinem Platz, ich schicke Sie nach oben in sein Zimmer. Sie nehmen bitte diese Treppe hoch in den ersten Stock, dann halten Sie sich rechts, es ist die zweite Tür auf der linken Seite mit der Zimmernummer 332.«
»Vielen Dank«, sagte ich.
Ich war zum ersten Mal in meinem Leben auf einem Polizeirevier, und ich fühlte mich reichlich nervös. Das wurde ich gewöhnlich schon, wenn ich beim Autofahren in eine Verkehrskontrolle geriet, selbst wenn ich mich korrekt an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten hatte. Und nun hatte ich wegen dieser Katastrophe mit der Polizei zu tun: Durch Zufall war ich die Empfängerin einer Art Flaschenpost geworden, die einen verzweifelten Hilferuf enthielt. Den Zettel aus dem Leuchtturm-Anhänger hielt ich in meiner Faust umklammert, während ich die Stufen hochschritt, bis mir einfiel, dass ich damit vermutlich sämtliche Fingerabdrücke verwischte. Würden die Polizisten überhaupt versuchen, welche festzustellen? Die Abdrücke des Kindes waren aller Wahrscheinlichkeit nach nicht in irgendwelchen Dateien gelistet. Verunsichert blickte ich auf das zusammengeknüllte Stück Papier und stieß beinahe mit einem Mann zusammen, der gerade Kommissar Petersens Zimmer verließ.
»Entschuldigung«, stammelte ich.
Er hielt inne und musterte mich eindringlich, dann nickte er mir kurz zu. Er war groß, bestimmt über eins neunzig, und der intensive Blick aus seinen dunklen Augen wühlte mich noch mehr auf.
Hot, hätte Sina über ihn gesagt.
Ich ging an ihm vorbei ins Zimmer 332.
Kommissar Petersen stand am Fenster und blickte nach draußen. Sein eisgraues Haar trug er stramm nach hinten gekämmt. Er war stämmig und schätzungsweise in den Sechzigern.
Unschlüssig stand ich in der Tür und wusste nicht so recht, ob ich einfach nähertreten durfte. »Guten Tag«, sagte ich.
»Hmmm«, brummte er statt einer Antwort, ohne sich umzudrehen. »Was wollen Sie?«
»Man hat mich zu Ihnen geschickt«, sagte ich, »die Dame am Infoschalter, meine ich. Ich möchte Anzeige erstatten. Nein, das ist nicht korrekt, ich habe mich falsch ausgedrückt; ich weiß nicht recht, wie ich es beschreiben soll, aber ich glaube, ich muss ein Verbrechen anzeigen.«
Petersen starrte immer noch nach draußen. Auf einmal schnaubte er und schüttelte leicht den Kopf, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass das mir galt. Vielmehr wirkte es, als beobachtete er etwas da draußen auf dem Parkplatz vor dem Gebäude, das ihm nicht gefiel. Ich stellte mir vor, wie der Border Collie wie ein Derwisch durch mein Auto fegte, seine aufgerissenen Augen und die heraushängende Zunge erschienen direkt hinter der Scheibe, weil ich ihn im Auto eingesperrt zurückgelassen hatte. Ob Petersen das von hier oben sehen konnte?
Können Sie bitte so höflich sein und sich zu mir umdrehen?, hätte ich gerne gesagt, verkniff es mir aber.
»Also gut«, sagte Petersen schließlich und nahm an seinem Schreibtisch Platz. »Setzen Sie sich.« Mit der Hand zeigte er auf den Stuhl ihm gegenüber.
Ich setzte mich hin. Kommissar Petersen nahm zunächst meine Personalien auf. Das erledigte er so gemächlich, dass ein notleidendes Kind in der Zwischenzeit verhungern und verdursten konnte.
»Mir ist heute Nacht ein Hund zugelaufen«, sagte ich. »An seinem Halsband war ein Anhänger in der Form eines kleinen Leuchtturmes befestigt, darin habe ich das hier gefunden.« Ich hielt ihm den Zettel entgegen.
Petersen zog die Augenbrauen hoch und betrachtete skeptisch das zusammengeknüllte Stück Papier. »Ach ja? Ein Leuchtturm am Halsband eines Hundes?«
Ich schwieg. Und hätte Kommissar Petersen am liebsten erschossen.
Ich legte den Zettel auf den Tisch. Er faltete ihn sorgfältig auseinander und las. Nachdenklich rieb er sein Kinn.
»Erzählen Sie mal von Anfang an«, sagte er.
Also erzählte ich, wie ich auf den Hund gekommen war. Meinen nächtlichen Spaziergang durch das Watt ließ ich außen vor, er tat nichts zur Sache. Dafür berichtete ich von dem Wimmern und den vermeintlichen Schreien, die sich nachträglich als Jaulen des Collies herausgestellt hatten.
»Ich dachte zunächst, da ruft ein Mensch«, sagte ich. »So einfach ließ sich das nicht identifizieren.«
»Ich erlebe immer wieder, dass Leute aus den südlicheren Teilen Deutschlands mit dem Wind an der Küste nicht zurechtkommen«, sagte Petersen. »Der Wind benimmt sich wie ein eigenständiges Lebewesen. Er packt einen am Kragen, er schüttelt einen durch und wringt einen wieder aus; er wühlt die See auf, und er ruft und keift wie ein Waschweib.«
Was wollte er damit sagen? Fang nur nicht auch noch vom Gonger an, dachte ich.
»Das war nicht der Wind«, sagte ich. »Wenn der heult, klingt es anders.«
Lange betrachtete Petersen das Stück Papier. Er hielt es in beiden Händen. Die Fingerspitzen berührten die Ecken, als wollte er ein sauberes Laken an die Wäscheleine hängen.
»Ich habe das Papier natürlich angefasst«, sagte ich.
Fragend schaute er auf.
»Meine Fingerabdrücke sind drauf. Ich habe mich gefragt, ob das Stück Papier nicht ein Beweisstück ist? Muss das nicht … in so eine kleine Plastiktüte?«
Petersen legte den Zettel zur Seite und verschränkte die Hände auf dem Schreibtisch. Irgendwie gab er mir das Gefühl, als sei ich ziemlich dämlich. »Wo haben Sie den Hund?«, fragte er. »In Ihrem Ferienhaus?«
»Er sitzt draußen in meinem Auto.«
Schwerfällig erhob er sich. »Lassen Sie ihn mich mal ansehen«, sagte er.
Gemeinsam gingen wir die Treppe hinab ins Erdgeschoss. Sämtliche Angestellten grüßten Petersen respektvoll, worauf Petersen entweder gar nicht antwortete, oder mit einem missmutigen Brummen reagierte, das sich anhörte wie ein kleineres Nebelhorn.
Der Hund saß brav auf dem Rücksitz. Als er uns kommen sah, drückte er erwartungsvoll die Schnauze gegen die Scheibe und hinterließ dabei eine schlierige Spur auf dem Glas. Ich öffnete die Autotür, und er sprang heraus. Schwanzwedelnd beschnupperte der Collie seine Umgebung.
Petersen betrachtete ihn eine ganze Weile. Als er sich hinkauerte, lief der Hund zu ihm hin und leckte ihm unterwürfig die Hand.
»Er ist reinrassig«, sagte Petersen.
Ich zuckte die Achseln. »Kann sein.«
»Na gut.« Petersen stand auf und streckte sich, ließ die Knöchel in seinen Fingern knacken, was bei mir eine Gänsehaut verursachte. »Behalten dürfen Sie den Hund nicht. Es ist ja nicht Ihrer. Seien Sie so gut, bringen Sie ihn ins Tierheim, dort wird er gut versorgt und die Mitarbeiter werden versuchen, den rechtmäßigen Besitzer zu finden.« Er nannte mir die Adresse eines Tierheims und erklärte den Weg. »Um alles andere kümmern wir uns.«
»Werde ich erfahren, was aus dem Kind geworden ist?«, fragte ich. Das ging mir alles zu schnell. Ich hatte mit einem größeren Aufwand gerechnet. Mit vielen Fragen, geschäftigem Interesse, eifrigen und beflissenen Beamten, die sich sofort bemühten, die Sache aufzuklären.
Petersen ließ seinen Blick über den Parkplatz schweifen. »Sie können in ein paar Tagen hier anrufen. Lassen Sie sich zu mir durchstellen.« Mit diesen Worten ließ er mich stehen und ging zurück in das Polizeigebäude. Ich hatte nicht das Gefühl, dass mein Bericht, meine Befürchtungen sowie der Zettel mit dem Hilferuf ihn tatsächlich beunruhigt hatten.
Nun schäumte ich vor Zorn. Und verspürte quälende Angst um einen unbekannten kleinen Jungen, einsam und verzweifelt, der keinen Ausweg sah, als seinen Hund mit einer Nachricht loszuschicken; der flehte und hoffte, dass jemand dieses Stück Papier entdeckte.
Ich brauchte jemanden zum Reden.
Sina würde wahrscheinlich keine Zeit haben, sie hing vermutlich am Telefon, während sie gleichzeitig Mails schrieb, einen schwierigen Kunden in den Griff kriegte und ihren aufdringlichen Chef abwimmelte, aber ich versuchte es trotzdem und wählte ihre Nummer.
»Melissa! Süße! Wie ergeht es dir da oben bei den Deichschafen und den verkrüppelten Kiefern?«
Ich hörte Stimmen im Hintergrund, Gemurmel, Tastaturklappern. Sina war Disponentin in einem Großraumbüro. Es ploppte am anderen Ende der Leitung; vermutlich bildete sie gerade eine riesige Blase mit einem Kaugummi.
»Hast du kurz Zeit?«, sagte ich. »Fünf Minuten oder zehn?«
»Nein. Aber für dich nehme ich sie mir natürlich trotzdem. Schieß los.«
»Halt dich fest«, sagte ich. An meinen Wagen gelehnt, erzählte ich die komplette Geschichte. Der Hund erkundete in der Zwischenzeit den Parkplatz und markierte ihn fröhlich als sein Revier, indem er an jedem Strauch und an jedem Hinweisschild ungeniert das Bein hob.
»Das glaube ich jetzt nicht!«, stieß Sina hervor. »Du sollst Urlaub machen. Dich erholen, mal eine Zeitlang nicht an das Geschäft denken. Aber nein. Stattdessen legst du dir ein Haustier zu und schickst ein Einsatzkommando los. Nein, das gehört nicht auf meinen Schreibtisch, das macht der Kollege.«
»Was?«
»Sorry, der letzte Satz galt nicht dir. Und du bist dir wirklich sicher, dass es sich um Kindesmisshandlung handelt?«
»Für mich klingt das eindeutig danach. Ja.«
»Hast du den Zettel noch?«
»Ich habe ihn dem Kommissar gegeben. Dachtest du etwa, ich dürfte ihn behalten, als schreckliches Andenken oder so?«
»Du hast ihn doch hoffentlich vorher abfotografiert?«
Verdutzt schwieg ich. Nein, hatte ich nicht. Und ich wusste nicht, ob ich ein solches absolut unerfreuliches Urlaubsmitbringsel in meinen Fotodateien haben wollte.
»Ich hätte den genauen Wortlaut gerne gehört. Wie auch immer, boah, mir läuft’s gerade eiskalt den Rücken runter. Da lässt man dich mal ein paar Tage alleine losziehen, und du ziehst die Kacke an wie so’n Scheiße-Magnet.«
»Für problematisch halte ich«, sagte ich, »dass dieser Petersen, der Kommissar, nicht übermäßig engagiert wirkte. Was ich erzählte, schien von ihm abzuprallen. Als würde er mich nicht sonderlich ernst nehmen. Ich mache mir richtig Sorgen um dieses Kind.«
»Lass die Polizei ihre Arbeit machen. Die verstehen was von solchen Dingen. Im Gegensatz zu dir.«
»Ja, aber – der Hilferuf ist bei mir angekommen – so, als sei es mein Schicksal, dass ich mich darum kümmere.«
»Was redest du da für einen Unsinn!«, sagte Sina. »Du hast getan, was du konntest, du bist zur Polizei gegangen damit. Jemand anderes hätte den Zettel vielleicht weggeschmissen und sich überhaupt nicht drum geschert. Du musst der Polizei vertrauen. Mehr kannst du nicht tun. Du bist doch nicht Catwoman, die die Welt retten muss.«
»Ich bin nicht Catwoman, sondern Dogwoman«, sagte ich.
»Du, ich kann jetzt echt nicht mehr reden. Ich ruf dich heute Abend an. Hier im Büro tanzt der Teufel.«
»Lass dich nur nicht von ihm kriegen, wenn du dich erst mal totgearbeitet hast. Du hast ein Plätzchen auf einer Wolke verdient.«
»Ischliebdisch«, sagte Sina.
»Ischdischauch.« Ich drückte das Gespräch weg.
Der Hund kam zu mir zurück und setzte sich neben meine Füße. Sein Nackenfell war leicht gesträubt, und er knurrte leise ein parkendes Auto an.
»Benimm dich!«, schimpfte ich und öffnete die hintere Autotür. Sofort sprang er auf den Rücksitz und machte es sich gemütlich.
#
Eine Viertelstunde später stand ich vor dem Tierheim. Es bellte, miaute und jaulte, als ich die Autotür aufstieß. Der Border Collie zog den Schwanz ein und verkroch sich in dem Raum hinter den Vordersitzen, als versuchte er, sich zu verstecken. Er winselte so herzzerreißend wie gestern Abend vor der Haustür. Nein, noch schlimmer. Als wüsste er, dass ich ihn abschieben wollte.
Ich seufzte.
Ich googelte den Namen des Tierheims: Pfotenherz. Die Homepage war übersichtlich und ansprechend aufgebaut, es gab eine Liste der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit Fotos und Infos über die jeweilige Qualifikation, Spezialisierung und Fortbildungen. Mit Sicherheit gaben die Tierpfleger und –pflegerinnen alles für die Tiere in ihrer Obhut. Und trotzdem. Ich stellte mir Käfige vor, in denen traurige Vierbeiner hockten und sehnlich auf eine liebevolle Familie warteten. Eine Familie, die vielleicht nie kommen würde.
Eine Frau mit wilden roten Locken kam aus dem Gebäude und warf einen Blick in meine Richtung. Sie trug ein dunkelgrünes T-Shirt mit einem Aufdruck des Tierheims.
Ich drehte mich um und suchte den Blick des Hundes. Aus dem Fußraum starrten mich zwei riesige Augen panisch an.
Ich brachte es nicht fertig, ihn hierzulassen. Ich startete den Motor und fuhr davon.
3.Das traurige Schicksal der Charlotte R.
Charlotte war übel. Salzsäure stieg aus ihrem Magen nach oben und brannte in der Kehle. Der Geschmack ließ sie würgen. Ein nach Motoröl stinkender Lappen steckte in ihrem Mund und verhinderte ein Ausspucken. Krampfhaft schluckte sie die ätzende Flüssigkeit hinunter.
Ich darf mich nicht übergeben, sagte sie sich, auf keinen Fall. Dass sie dann in ihrem eigenen Erbrochenen liegen würde, wäre das geringste Problem. Nein, wenn das passierte, verstopfte womöglich ihre Nase, und sie bekäme gar keine Luft mehr.
Was die Luft betraf: Die fühlte sich jetzt schon stickig an. Wie viel davon war in ihrem engen Gefängnis überhaupt vorhanden? Wie lange konnte Charlotte damit auskommen? War die Kiste, in der sie steckte, dicht, oder gab es genügend Ritzen, durch die Luft zum Atmen einströmen konnte?
Eine halbe Stunde? Oder mehr?
Charlotte wusste es nicht. Sie atmete so ruhig und flach wie möglich, um sparsam mit dem kostbaren Sauerstoff umzugehen, was ihr angesichts ihrer Panik nicht leichtfiel. Sie versuchte den Gedanken zu verdrängen, wie die verbrauchte Luft immer dünner wurde; wie sie immer stärker, immer schneller, immer hektischer um Atem ringen würde. Es gelang ihr nicht.
Zusammengepfercht lag sie da, mit angezogenen Beinen, die Handgelenke auf dem Rücken zusammengebunden. Eine unfreiwillige Fötusposition ohne die warme Geborgenheit, die ein Mutterleib zu geben vermochte. Die Stricke und die unbequeme Lage schnürten die Blutzufuhr in den Händen ab. Anfangs hatte sie die Finger bewegt, um den Kreislauf in Schwung zu halten. Es hatte nicht geholfen. Aus dem unangenehmen Kribbeln war ein Schmerz geworden, der sich bis zur Unerträglichkeit steigerte und schließlich in Taubheit überging. Inzwischen fühlten sich die Finger an, als gehörten sie einer Fremden. Bei dem Versuch, damit zu wackeln, gehorchten sie ihr nicht mehr.
Wie eine zweite Haut lag der Schweiß auf Charlottes Stirn. Ihr Sweatshirt war komplett durchgeschwitzt, auch die Hose fühlte sich feucht an. Nein, nicht feucht: triefend nass. In ihrem Elend, in ihrer Angst, in ihrer Verzweiflung hatte sie sich eingenässt.
Ihr wurde schwindelig. Sie hatte das Gefühl, die Welt um sie herum würde sich drehen, doch nach einer Weile erkannte sie, dass die Kiste sanft schaukelte.
Sie befanden sich auf einem Boot.
Auf dem Boot ihres Peinigers.
Sie hielt die Augen geschlossen und konzentrierte sich auf die Geräusche, die von außen an ihre Ohren drangen. Champ befand sich in der Nähe. Sie hörte seine Schritte, hörte ihn hin- und herlaufen. Der Knebel raubte ihr die beste Waffe, die sie jemals gehabt hatte: Sprache. Worte. Sich aus ihrer Situation herausreden, ihn überzeugen, dass er sie herauslassen musste, wäre ihre einzige Chance. Ob es helfen würde, an seine Vernunft zu appellieren? Ob ihr Flehen zu ihm durchdringen würde?
Über ihr knirschte das Holz. Champ hatte sich auf die Kiste gesetzt.
Hin und wieder raschelte etwas, und regelmäßig vernahm Charlotte ein leises Klopfen oder Klappern. So, als würde Champ etwas trinken. Als würde er immer wieder die Tasse anheben, einen Schluck nehmen und sie wieder abstellen.
Er saß auf ihrer Kiste und trank Kaffee!
Mit ihrer ganzen Kraft drückte sie die Beine gegen das Holz, bis sie es knacken hörte. Vielleicht schaffte sie es, die Seitenwand zum Bersten zu bringen.
Champ über ihr sagte: »Du hörst sofort damit auf. Oder ich werde dir fürchterlich wehtun. So sehr, dass deine jetzige Lage das Paradies dagegen sein wird.«
Seine Stimme, sie klang so eiskalt. Was war geschehen, dass er sich so verändert hatte? Dieser plötzliche, unerwartete Umschwung, als aus einem freundlichen, umgänglichen Mann ein Psychopath wurde wie in einem mittelmäßigen Fernsehthriller? Und alles nur, weil er sich einbildete, sie wollte sich über ihn lustig machen.
Sie schloss die Augen, sie versuchte, sich aus dieser schrecklichen Situation auszuklinken, an etwas anderes zu denken, aber ihre Gedanken kreisten nur um die Frage, ob sie hätte merken müssen, dass Champ anders war als andere Menschen. Dass mit ihm etwas nicht stimmte. Champ musste krank sein, psychisch krank, er gehörte in eine Anstalt oder noch besser hinter Schloss und Riegel.
#
Es hatte so schön angefangen. Champs Lächeln, seine raue Stimme versprachen einen unvergesslichen Abend.
Sie und Champ – diesen Kosenamen hatte sie ihm gegeben, Champ und Charlotte, das erinnerte sie an den schönen altmodischen Kinderfilm Cap und Capper, und er hatte nichts dagegen einzuwenden gehabt – waren zu einem Ausflug verabredet. Sie hatten sich bereits zuvor einige Male getroffen, es waren nette, behutsame Dates gewesen; sie hatten Strandspaziergänge unternommen, hatten sich bei schlechtem Wetter einander untergehakt und den Regenschirm geteilt. Sie waren zusammen schön essen gegangen, und heute wollten sie mit dem Boot rausfahren. Zwar hatte Charlotte insgeheim darauf spekuliert, mit Champ in der Kiste zu landen, aber doch nicht auf diese Art und Weise, dachte sie mit einem seltsamen Anflug von Galgenhumor.
Sie hatten vorgehabt, aufs nächtliche Meer hinausfahren, eine Flasche Wein zusammen zu trinken und die Sterne zu betrachten. Und, zumindest hatte sich Charlotte das so vorgestellt, zum ersten Mal miteinander im Bett zu landen beziehungsweise in der Koje.
Doch dann krempelte er die Hemdsärmel hoch, um das Boot loszumachen. Charlotte sah dieses Tattoo an seinem Handgelenk, und …
Die Katastrophe trat ein, ein Desaster, der ultimative Beziehungs-GAU.
#
Charlotte hatte es doch gar nicht böse gemeint. Weder hatte sie Champ verletzen wollen, noch ihn ärgern oder aufziehen. Aber als sie das Tattoo an seinem Unterarm sah, angefertigt von einem Künstler mit erbärmlich wenig Talent, das Tattoo eines Freundschaftsarmbandes, wie Grundschüler es sich voller Stolz umbanden, konnte sie nicht anders. Laut platzte es aus ihr heraus, ihr schallendes Lachen. Sie hatte nun einmal dieses ohrenbetäubende Organ, mit dem sie immer wieder in Fettnäpfchen trat, ihre Mitmenschen vor den Kopf stieß oder sie verunsicherte. Sie war nun mal eine extrovertierte Frohnatur mit dem Herzen auf der Zunge, die aussprach, was sie dachte, nicht unbedingt nach reiflicher Überlegung. Charlottes Freunde und Kollegen versicherten ihr stets, dass niemand wirklich sauer auf sie sein konnte. Aber bei Champ hatte ihr fröhlicher Ausbruch einen heftigen Wutanfall ausgelöst. Er war auf sie losgegangen, hatte ihren Kopf gegen die Wand der Kajüte geschlagen. Hatte gedroht, sie umzubringen. Champ hatte sie am Hals gepackt, dass ihr die Luft wegblieb, er hatte seine Faust in ihrem Haar vergraben und sie geschüttelt, so heftig, dass sie es in den Halswirbeln knacken hörte. Ihre anfängliche Verwirrung wich schnell Todesangst. Sie musste an Babys denken, die von überforderten Eltern zu Tode geschüttelt wurden. Sie sah Büschel ihres Haars auf dem Boden liegen, bevor es ihr gelang, sich loszureißen. Mit einem Satz sprang sie vom Boot. Blindlings rannte sie drauflos, weg, nur weg.
Und beging einen fatalen Fehler. Vielleicht hätte sie es geschafft, wenn sie einen Haken geschlagen und in Richtung Stadt gelaufen wäre. Dort hätte sie um Hilfe rufen können. Stattdessen rannte sie über den Strand, wo er sie durch die Einsamkeit jagte.
Dennoch wäre sie Champ beinahe entkommen. In der Zwischenzeit war leichter Nebel aufgezogen. Als sie einen Blick nach hinten riskierte, konnte sie Champ nirgends mehr erkennen. Wo steckte er? Hatte sie ihn womöglich abgehängt? Ihr Herz klopfte wie rasend, die Lungen brannten von der kalten Atemluft. Sie erreichte den Yachthafen von Horumersiel. Nur ein Kutter und ein Ausflugsboot lagen vor Anker. Laternen warfen ein gespenstisches gelbes Licht über die verwaiste Szenerie. Charlotte eilte weiter.
Vor ihr tauchten die Umrisse von Spielgeräten auf: eine Rutsche, ein Drehkarussell, ein Spielturm in Form eines Fischerbootes, auf dem man oben herumklettern und in das man unten hineinkriechen konnte. Das wäre ein gutes Versteck. Dumm, dass es nur einen Eingang gab. Aber sie brauchte eine Pause, sie konnte nicht mehr. Auf allen vieren kroch sie in den Bauch des Spielbootes. Sie passte gerade so hinein. Sie spähte kurz aus dem Bullauge, bevor sie sich hinkauerte, und anfing zu beten.
Eine Zeitlang passierte gar nichts. Vielleicht sollte sie einfach hier sitzen bleiben. Regungslos, wie ein Kind, das sich unter der Bettdecke verkroch und hoffte, dass das Monster es nicht finden würde, wenn es keinen Mucks von sich gab.
Kurze Zeit später hörte sie, wie sich jemand näherte: Champ, auf der Suche nach ihr. Charlotte schloss die Augen. Bitte, geh weiter. Bitte, geh einfach an dem Spielplatz vorbei. Seine Füße stapften durch den Sand. Er musste jetzt neben dem Spielturm sein. Nun wurden die Schritte wieder leiser. Charlotte zählte in Gedanken. Bei hundert würde sie nach draußen kriechen, bevor Champ auf der Suche nach ihr zurückkehrte.
Etwas berührte ihre Hand.
Charlotte schrie auf. Sie fuhr hoch und stieß sich heftig den Kopf. Vor ihr, am Eingang des Schiffsrumpfes, stand ein schwarz-weiß gefleckter Hund und beschnupperte sie.
»Geh weg!«, zischte Charlotte. Hatte Champ ihren Schrei gehört? Warum musste dieser dumme Hund ausgerechnet jetzt hier auftauchen?
Wie auch immer. Hier konnte sie nicht bleiben. Wenn Champ sie gehört hatte und umkehrte, würde er den Hund sehen, wie er schwanzwedelnd die Schnauze in den Bootsrumpf steckte. Als sie die Hand nach ihm ausstreckte, wich er vorsichtig zurück. Er war clever genug, sich nicht unter das Schiff locken zu lassen, wo er – genau wie sie möglicherweise – in der Falle saß. Sie war wütend auf dieses Tier, weil es sie, wenn auch unwissentlich und unbeabsichtigt, verraten konnte.
Sie streckte den Kopf nach draußen und lauschte. Nichts. Trotzdem, sie durfte sich nicht in falscher Sicherheit wiegen. Am Ende lauerte Champ irgendwo und wartete nur darauf, dass sie aus ihrem Versteck auftauchte. Sie musste verschwinden, bevor er aus dem Nebel gestürmt kam, um sich auf sie zu stürzen.
Charlotte spurtete los. Sie rannte in die Richtung, aus der sie gekommen war, doch dann bog sie scharf nach rechts ab, weil sie glaubte, im Nebel eine Bewegung zu sehen. Der Hund stob in einigem Abstand neben ihr her, seine Zunge hing aus dem Maul, und sie hatte fast den Eindruck, dass er dieses Wettrennen genoss.
Als sie den Campingplatz erreichte, duckte sie sich unter der Schranke durch. Mit hämmerndem Herzen hechtete sie über die Anlage. Hier würde doch hoffentlich jemand sein, Dauergäste, Wintercamper. Am hinteren Zaun standen die Wohnwagen. Einige von ihnen waren mit einer Plane überzogen. Als verschlössen sie die Augen vor Charlottes Misere. Das geht uns nichts an. Wir wollen nichts damit zu tun haben.
Inbrünstig auf Hilfe hoffend stellte sie sich auf die Zehenspitzen, versuchte in Fenster zu spähen. Nichts. Der Campingplatz war verlassen. Die ganze Welt hatte Charlotte verlassen. Keine Menschenseele zeigte sich. Niemand war hier, der ihr beistand, sie rettete. Mühsam unterdrückte sie ein Schluchzen. Verstecken oder weiter fliehen? Was war besser?
Wenn sie umkehrte, lief sie Gefahr, Champ direkt in die Arme zu rennen. Der Hund war damit beschäftigt, an den Wohnwägen zu schnuppern und sein Hundebein zu heben. Schließlich verschwand er in der Dunkelheit.
Charlotte legte sich platt auf den Boden und robbte unter einen Wohnwagen. Schnell kroch ihr die Kälte in die Knochen. Das würde sie eine Zeitlang aushalten, aber das Zähneklappern konnte sie nicht unterdrücken. Sie bildete sich ein, man könnte es kilometerweit hören.
Sie wartete eine gefühlte Ewigkeit auf dem feuchten, kalten Boden. Nichts passierte. Der Hund war nicht mehr zu sehen. Charlotte schöpfte Hoffnung. Schließlich beschloss sie, unter dem Wohnwagen hervorzukriechen.
Als sie um den Wohnwagen herumlief, stand Champ vor ihr. Seine Faust schnellte auf sie zu. Der Hieb gegen die Schläfe knockte ihr Bewusstsein aus.
#
Als sie wieder zu sich kam, hatte er sie in diese Kiste gezwängt.
Was hatte er mit ihr vor?
Ein heftiger Ruck riss sie aus ihren Gedanken. Sie waren gestrandet. Champ war aufgestanden. Sie konnte hören, wie er auf dem Boot herumlief.
Erschrocken riss sie die Augen auf, als die Kiste ruckartig bewegt wurde. Champ schob sie über den Boden. Plötzlich schaukelte ihre beengte Welt gewaltig. Schließlich drehte sich alles. Von jetzt auf gleich stand Charlotte kopfüber. Sie fürchtete, sich den Hals zu brechen, so stark wurde ihr Hals verrenkt; ihr ganzes Eigengewicht lastete auf dem Kopf. In dieser Position war es ihr überhaupt nicht mehr möglich, zu atmen. Hör auf damit, dachte sie, hör bitte bitte auf, bitte bitte!
Bald wusste Charlotte nicht mehr, wo oben und wo unten war. Die Kiste wurde hin- und hergekippt, gedreht, umgeworfen; ihre Knie und Ellenbogen prallten gegen die Kistenwände, sie stieß sich den Kopf und hatte schreckliche Angst, sie könnte sich die Nase brechen und wäre gezwungen, durch den geknebelten Mund zu atmen. Sie dachte an eine Foltermethode aus dem Mittelalter, als man Angeklagte in ein mit Nägeln gespicktes Fass steckte und den Berg hinunterrollte. Bei diesen Gedanken drohte sie ohnmächtig zu werden. Schleier wallten vor ihren Augen.
Und auf einmal fiel die Kiste.
Charlotte fühlte sich wie in einer Achterbahn, einen Augenblick befand sie sich im freien Fall, im nächsten Moment schlug die Kiste auf dem Boden auf. Schmerz schoss durch ihren Körper. Sie hatte sich mit Sicherheit etwas gebrochen. Vielleicht sogar sämtliche Knochen gebrochen. Aber hier an Land würde man sie wenigstens finden. Bald. Das hoffte sie inständig. Lange konnte sie nicht mehr durchhalten. Sie würde nicht mehr lange überleben.
Die Kiste wurde geöffnet.
Charlotte hatte Helligkeit erwartet. Stattdessen war es außerhalb der Kiste ebenfalls dunkel. Es musste mitten in der Nacht sein. Durch die Bewusstlosigkeit hatte sie jegliches Zeitgefühl verloren, sie wusste nicht, wie lange sie in der Kiste gesteckt hatte, aber sie hatte sich tröstliches Tageslicht erhofft, einen bewölkten Himmel, klare Luft. Sie hegte die Hoffnung, Menschen zu treffen, die ihre missliche Lage bemerkten, ihr wirres Haar, ihr geschwollenes Gesicht, in dem sich sicherlich schon ein Bluterguss gebildet hatte, und die Urinflecken auf der ehemals weißen Jeans.
Es war ihr nicht vergönnt. Stattdessen war rings um sie her diese trübe Nebelsuppe, durch die ein verschwommener Mond etwas Licht spendete wie eine staubige Glühbirne in einem Kellerverlies.
Champ packte sie am Arm und zerrte sie aus ihrem engen Gefängnis. Ihre Gliedmaßen, eingeschlafen und verrenkt, brüllten vor überwältigendem Schmerz. Aber sie war draußen.
Verstört blickte Charlotte sich um. Sie befanden sich im Watt. Das Ufer war nicht zu sehen. Das Boot war trockengefallen, der Rumpf steckte leicht schief im Schlick.
Jetzt nur nichts falsch machen, Charlotte. Wer wusste, was dann passierte, wie Champ reagieren würde, wenn sie etwas sagte, das ihm nicht passte!
Sie konnte sich kaum auf den Beinen halten. Sie sank in die Knie und wäre beinahe mit dem Gesicht in den Schlamm gestürzt.
Grob packte Champ ihre Schulter und hielt sie fest, bis sie in der Lage war zu stehen. Dann zog er den Knebel aus ihrem Mund. Lange Speichelfäden baumelten daran wie Kaugummi. Achtlos warf Champ den Knebel in den Schlick. Charlotte schmeckte kühle, salzige, saubere Luft und eine riesengroße Erleichterung. Sie konnte wieder richtig atmen. Sie versuchte zu sprechen, aber aus ihrer Kehle kam nur ein leises Krächzen. Sie hätte nicht um Hilfe rufen können, selbst wenn sie es gewollt hätte.
»Bitte«, krächzte sie. »Es ist genug. Ich kann nicht mehr. Es tut mir leid, ich wollte dich nicht …«
»Halt das Maul«, sagte er brutal. »Ich habe dir den Knebel nicht herausgenommen, damit du mich vollquatschst.«
Sie schwieg.
»Wieso läufst du nicht weg?«, sagte er lächelnd. »Ich an deiner Stelle würde versuchen, wegzulaufen.«
Und das versuchte sie. Blindlings stolperte sie drauflos. Doch ihre Muskeln gehorchten ihr nicht, und sie stürzte der Länge nach in den Dreck. Bitte, bitte, ich muss hier weg, das ist meine einzige Chance, dachte sie. Sie musste Land erreichen, irgendwie. Ihre Knie gaben nach, sie kämpfte sich wieder hoch. Sie stolperte, stürzte wieder, rappelte sich auf. Und Champ war die ganze Zeit hinter ihr. Sie hörte ihn lachen. Er machte sich lustig über sie, wie sie verzweifelt zu entkommen versuchte, unbeholfen wie eine Spinne, der ein sadistisches Kind zwei Beine ausgerissen hatte. Sie hatte keine Ahnung, wohin sie lief, überall waberte dieser Nebel. Champ bewegte sich anscheinend mühelos durchs Watt, sie hörte, wie er seine Gummistiefel bei jedem Schritt schmatzend aus dem schlammigen Boden zog.
Seine Hand packte sie im Nacken, als wäre sie ein verängstigtes Kaninchen.
»Weißt du, warum ich dir den Knebel weggenommen habe?«, sagte er.
Sie antwortete nicht.
»Damit ich dich besser schreien höre.« Er lachte.
Mühelos zerrte er sie zurück zum Boot.
»Rein mit dir.« Mit diesen Worten drückte er sie in die Kiste zurück, stopfte Arme und Beine hinterher, als wäre sie eine Schlenkerpuppe, und sie hatte nicht die Kraft, sich zur Wehr zu setzen. Gegen Champ hatte sie nicht die geringste Chance.
»Guten Appetit«, sagte er und warf ihr eine Handvoll Dreck ins Gesicht. Sie hustete und spuckte. Champ verschloss den Deckel der Kiste erneut.
Zuvor hatte sie gedacht, schlimmer könnte es nicht mehr kommen. Vor einer Stunde hatte sie geglaubt, den Gipfel des Grauens erklommen zu haben. Aber nun – nachdem sie die kurzzeitige Erleichterung gespürt hatte, als er sie ins Freie ließ, dem Irrglauben erlegen war, es wäre vorbei, nur, um kurz darauf zu erfahren, dass er nicht im Traum daran dachte, sie von ihren Qualen zu erlösen –, jetzt war ihre Todesangst ungleich schlimmer.
Etwas krabbelte über ihren Arm. Sie hatte sich fest vorgenommen, nicht zu schreien, um ihm diesen Gefallen nicht zu tun. Aber nun schrie sie doch, ein heiseres Krächzen. Der Dreck, mit dem er sie beworfen hatte: Ein Wattkrebs befand sich mit ihr in der Kiste. Champ wusste, wie sehr sie alles fürchtete, was krabbelte und kroch, das hatte sie ihm erzählt. Und der Krebs huschte über ihren Körper, über ihr Gesicht, verfing sich in ihrem Haar. Sie schrie und schrie, doch ihre heisere Stimme erstarb schnell, und sie konnte nur noch wimmern.
Dann drang Wasser durch die Ritzen der Kistenwände. Es dauerte nicht lange, bis der Arm, auf dem sie lag, vollkommen durchnässt war.
Nun gelang es nicht mehr, die Wahrheit zu verdrängen; die Wahrheit, die sie vor Entsetzen die ganze Zeit nicht hatte glauben wollen: Er würde sie hier liegenlassen in ihrem Sarg, bis die Flut ihn unter sich begrub. Champ würde ihr das Leben nehmen.
Oh Gott, sie wollte nicht sterben!
Aber es musste doch jemand kommen. Irgendjemand musste doch gesehen haben, wie das Boot so ungewöhnlich spät am Abend ablegte. Irgendjemand musste wissen, dass sie mit Champ unterwegs war. Oder nicht?
Mit grausamer Deutlichkeit wurde ihr bewusst, dass sie niemandem von ihrer keimenden Lovestory erzählt hatte. Es schien ihr noch zu früh zu sein, um damit herauszuplatzen. Mühsam hatte sie sich verkniffen, ihren Freundinnen von ihrem neuen Schwarm zu berichten. Sie und Champ hatten beschlossen, mit dem offiziellen Verkünden ihrer beginnenden Beziehung noch zu warten. Zu ihren Dates waren sie stets nach Wilhelmshaven gefahren, wo niemand sie kannte.
Wieder und wieder trat sie gegen die Kistenwand, hoffte, das Holz würde bersten. Aber die Bretter hielten stand. Charlotte wand sich, sie flehte, sie bettelte um ihr Leben, aber sie wusste nicht, ob ihr Peiniger überhaupt noch draußen stand, oder ob er längst wieder im Boot saß und auf den Pegelstand wartete, der ihm das Ablegen erlaubte.
Sie verrenkte den Hals, versuchte die Nase so weit wie möglich in die obere Kistenecke zu halten, wo es noch ein wenig Luft gab. Das Wasser stand ihr inzwischen buchstäblich bis zum Hals. Der Krebs war egal, es ging nur noch ums nackte Überleben.
Wasser schwappte über ihr Gesicht.
4.Unter der Treppe
Unterwegs hielt ich an einem Supermarkt an. Ich hatte keine Ahnung, wie lange ich den Hund behalten würde, aber ich konnte ihn nicht dauerhaft mit Rührei und Keksen füttern, zumal meine Vorräte inzwischen aufgebraucht waren. Erneut ließ ich ihn auf dem Rücksitz zurück.
Unschlüssig stand ich vor dem Regal mit Tiernahrung und fühlte mich wie erschlagen von den zehntausend verschiedenen Produkten. Hühnchen oder Rind? Sollte ich Trockenfutter kaufen oder Nassfutter? Ich entschied mich für beides. Halb-halb war bestimmt nicht verkehrt. Es gab auch Hundeschokolade und Hundekekse. Beides landete im Einkaufswagen. Schließlich kaufte ich noch eine rote Hundeleine, farblich passend zum Halsband.
Essengehen mit einem Vierbeiner war womöglich auch nicht so einfach. Vermutlich war es kein großer Aufwand, ein Restaurant zu finden, in dem Hunde geduldet wurden, aber ich wusste nicht, wie er sich, umgeben von Essensgerüchen und Menschen, die vor gefüllten Tellern saßen, verhalten würde. Am Ende räumte er einen Tisch mit der Schnauze ab, oder ein Kellner stolperte über ihn, oder er lieferte sich eine Hetzjagd mit einem Artgenossen durch die Gaststube. Darauf wollte ich es nicht ankommen lassen. Ich würde eben selbst kochen und im Ferienhaus essen. Also kaufte ich Nudeln und Zutaten für eine Tomatensoße, dazu wählte ich eine Flasche Rotwein. Dieser Hund stellte meine komplette Tagesgestaltung auf den Kopf.
Und ich stellte fest, dass es für mich in Ordnung war.
Der Hund wedelte so heftig mit dem Schwanz, als er mich am Autofenster auftauchen sah, dass ich glaubte, das Auto müsse jeden Moment anfangen zu wackeln. Ich lud meine Einkäufe in den Kofferraum und ließ den Hund ein wenig Trockenfutter aus der Hand fressen. Dann zückte ich mein Handy und suchte die Adresse meines Vermieters heraus: Axel Schulte, Bentgrasweg 3, Schillig. Ich war Axel bisher nur einmal kurz begegnet, als er mir die Schlüssel für das Ferienhaus überreichte. Ich überlegte, anzurufen und mein Kommen anzukündigen, zumal ich keine Ahnung hatte, ob er überhaupt zuhause war. Dann dachte ich, dass es besser wäre, den Hund direkt vorzustellen, damit er sich überzeugen konnte, um was für ein liebes Tier es sich bei dem Border Collie handelte.
#
Axel Schulte wohnte in einem hübschen Einfamilienhaus am Ortsrand von Schillig. In dem gepflegten Garten wuchsen Obstbäume und Palmlilien; ich sah Beete mit Kohl und Wintersalaten, alles akkurat angelegt. Axel Schulte stand auf dem Briefkasten, und darunter Ferienhaus Marina. Ich öffnete das hellblau gestrichene Gartentürchen, trat auf die Haustür zu und klingelte.
Es dauerte geraume Zeit, bis jemand öffnete. Axel Schulte war ein bärtiger Riese mit muskelbepackten Oberarmen und Schultern, so breit, dass sie den Türrahmen beinahe ausfüllten. Sein Alter war schwer zu schätzen, er konnte um die dreißig sein, vielleicht ein wenig älter.