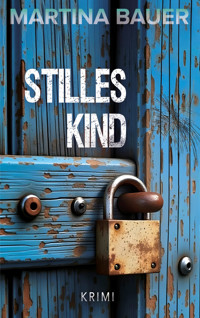2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In einem Auenwald beim nordbadischen Philippsburg wird die skelettierte Leiche der Schülerin Stella gefunden. Das Waldstück gilt als verflucht, seit im späten Mittelalter eine vermeintliche Hexe zu Tode gefoltert wurde. Die Polizei findet Hinweise auf einen Ritualmord und ermittelt in diese Richtung, leider ohne Erfolg. Stellas Mutter fürchtet um ihre jüngere Tochter Annie und bringt das Mädchen bei ihrer Tante unter, wo Annie aufwächst. Jahre später kehrt Annie in ihre Heimatstadt zurück. Sie spürt, dass Stellas Mörder immer noch hier ist. Er verfolgt sie, stellt ihr nach, ist ihr dicht auf den Fersen. Leserstimmen: „Ein spannend umgesetzter Thriller, der tiefe Einblicke in das Leben einer vom Schicksal gebeutelten Kleinfamilie gewährt. Eine durchwegs leidenschaftliche Erzählsprache, die den Leser von der ersten Seite an entführt.“ „Nach einem stimmungsvollen Prolog entfaltet sich die Handlung in aller Ruhe, malt zunächst ein kleinstädtisches Idyll, eine harmonische Familie netter Menschen, um sie dann – ebenfalls in aller Ruhe – kaltblütig zu zerlegen.“
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Schlechtes Blut
Über die Autorin
2013: Annie
1
Sommer 2003: Annie
2
Sommer 2003: Emily
3
Frühjahr 2013: Annie
4
Sommer 2003: Annie
5
Frühjahr 2013: Annie
6
Sommer 2003: Annie
7
Sommer 2003: Verena
8
Frühjahr 2013: Annie
9
Sommer 2003: Annie
10
Frühjahr 2013: Annie
11
Sommer 2003: Annie
12
Sommer 2003: Emily
13
Frühjahr 2013: Annie
14
Sommer 2003: Annie
15
Frühjahr 2013: Annie
16
Sommer 2003: Annie
17
Frühjahr 2013
18
Frühjahr 2013: Emily
19
Sommer 2003
20
Frühjahr 2013: Annie
21
Sommer 2003
22
Frühjahr 2013
„Höllenfahrt“
von Martina Bauer und L.S. Anderson
Schlechtes Blut
Ein Roman von Martina Bauer
Alle Rechte liegen bei der Autorin Martina Bauer
Copyright: © 2015 Martina Bauer, Guttenbergstr.1, 76889 Schweigen-Rechtenbach
Covergestaltung: Jacqueline Spieweg, FarbRaum4 (http://www.jspieweg.de/)
Datei: Fotolia (kevron2001)
Über die Autorin
Martina Bauer, geb. 1968, ist ausgebildete Industriekauffrau und Fachkrankenschwester für Intensivpflege und Anästhesiepflege. Sie lebt mit ihrem Mann und ihrem Sohn an der Südlichen Weinstraße. Mit dem Schreiben hat sie vor einigen Jahren begonnen, ihre bevorzugten Genres sind Crime, Mystery und Horror.
Alle Personen im nachfolgenden Text sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Die Legende von der Sumpfhexe ist ebenfalls frei erfunden.
Aber jeder Legende liegt ein Quäntchen Wahrheit zugrunde.
Nach der Kurzgeschichte
»Der Hexenwald«
von Martina Bauer
Und wenn sie nicht gestorben sind,
dann töten sie noch heute.
2013: Annie
Ich träume davon, auf einer blühenden Wiese begraben zu werden, mit duftenden Blumen und jungem grünen Gras über mir. Eine große Wiese soll es sein, mit einem einzelnen Baum in der Mitte, vielleicht eine alte Eiche oder eine ausladende Weide. Die Vögel sollen in der Krone zwitschern, und ein blauer Himmel soll sich darüber spannen, über den am Abend ein funkelnder Sternenhimmel zieht.
Die wenigsten machen sich so viele Gedanken über das Ende wie ich. Warum auch? Sterben ist etwas für alte Leute. Über den Tod nachzudenken, heißt, sich den Tag zu verderben. Der Tod lässt sich weder planen, noch lässt er mit sich handeln. Er wird kommen, ob es einem gerade in den Kram passt oder nicht. Die Menschen können nur beten und hoffen, dass er sich Zeit lässt und erst auf sie aufmerksam wird, wenn sie Ihr Leben gelebt haben und bereit für ihn sind.
Mich hat er schon aufgesucht. Selbstverständlich bin ich nicht tot, sonst wäre ich nicht in der Lage, meine Geschichte zu erzählen. Und mit fünfundzwanzig bin ich alles andere als alt.
Der Tod ist mein treuer Begleiter. Er ist immer in meiner Nähe und weht mir seinen eisigen, stinkenden Atem ins Gesicht. Der Tod ist wie ein ungeliebter Bruder, der mich der engen familiären Bande wegen an Sonntagen besucht und mich spöttisch über den Schweinebraten hinweg angrinst. Hier bin ich, Annie, sieh mich an. Du kannst mich nicht ausstehen, aber ich bin nun mal hier. Wir gehören zusammen, du und ich.
Nicht, dass ich es mir aussuchen kann. Die wenigsten haben eine Wahl.
Der Vater meiner Kindheitsfreundin Mona hat bereits zu Lebzeiten festgelegt, wie mit seinen sterblichen Überresten verfahren werden soll, wenn es so weit ist. Die Form des Grabsteins, der Wortlaut der Inschrift, die Ausrichtung der Bestattungsfeier: bei einem Notar wurde eine akribisch ausgearbeitete Verfügung hinterlegt. Mona und ich waren vielleicht zehn oder elf, als sie mir von dieser Planung erzählte. Wir saßen auf dem Bürgersteig vor der Villa Grün in der Sonne und schleckten Erdbeereis vom Eismann. Ich wunderte mich über Monas Vater.
»Ist dein Vater krank oder so?«, fragte ich.
»Nein. Es ist ihm einfach wichtig, dass alles nach seinen Wünschen läuft«, antwortete sie.
Ich war noch ein Kind; trotzdem ahnte ich bereits, dass der Tod nicht der beste Verhandlungspartner ist. Herr Kerners Planung kam mir vor wie Einkaufen mit Mama an der Fleischtheke. »Einmal hundert Gramm Aufschnitt, bitte. – Einmal verbrennen, bitte. Und nur richtige Blumen auf das Grab legen, keine künstlichen Gestecke.«
Ich wünsche Herrn Kerner, dass seine Hoffnungen erfüllt werden. Ich wünsche es ihm wirklich.
Ich erzählte meiner Schwester Stella am selben Abend von dem Gespräch mit Mona.
»Cool«, sagte sie. »Vielleicht mache ich das auch so, wenn ich alt bin. Und weißt du was? Ich lasse mich in einem offenen Sarg aufbahren, genau wie Oma. Dann zwinkere ich den Trauergästen zu und erschrecke sie zu Tode. Schau, so …« Stella kam ganz nah an mich heran und zwinkerte mit einem Auge. Ich kiekste und wand mich bei dieser Vorstellung.
Stella wurde nicht alt. Sie wurde ermordet und starb den schlimmsten Tod aus der Angebotspalette des Sensenmanns. Ihr Wunsch nach einer offenen Aufbahrung konnte nicht erfüllt werden. Für eine Zurschaustellung ihrer Leiche zur Betrachtung für die Hinterbliebenen ist von Stella nicht genug übrig geblieben.
Manchmal träume ich von einem Skelett auf einem Totenbett. In den knochigen Händen steckt ein Blumenstrauß, hineingelegt von den trauernden Angehörigen. Jedes Mal erwache ich schweißgebadet. Der Traum erinnert mich an den Tag, als Stella diese bescheuerte Idee hatte, mit der der Schrecken seinen Lauf nahm.
1
Sommer 2003: Annie
»Los, komm! Wir wollen eine Hexe jagen.«
Wie immer sprühte Stella vor Energie, aber so wie heute hatte ich sie nicht oft erlebt. Sie wirkte auf mich wie eine Stimmgabel, die von einem eifrigen Lehrer gegen eine Tischkante geschlagen wird, um seinen Schülern die Vibration vorzuführen. Man sieht das feine Beben nicht direkt, aber man kann es spüren.
»Was redest du da für einen Blödsinn?« Theatralisch pulte ich mit dem Zeigefinger in meinem linken Ohr, als versperrte etwas den Gehörgang. »Ich höre wohl nicht richtig. Ich habe »Hexen jagen« verstanden.«
»Du hast richtig gehört.« Stella strahlte mich an, als wäre die Hexenjagd an einem Samstagnachmittag eine besonders geniale Idee.
»Du spinnst doch!« So unauffällig wie möglich versuchte ich das Buch in meinem Rucksack zu verstauen. Stella sollte den Einband nicht sehen. Einen Teil meines Geburtstagsgeldes hatte ich in der kleinen Buchhandlung in der Söternstraße für meinen ersten Thriller ausgegeben: »Fräulein Smillas Gespür für Schnee« von dem dänischen Autor Peter Hoeg. Der Film über die herzlich-schroffe Glaziologin, die den Mord an einem kleinen Inuit-Jungen aufklärt, war vor kurzem im Fernsehen ausgestrahlt worden und hatte mich völlig begeistert. Wenn Stella das Buch in die Hände bekam, würde sie es wahrscheinlich beschlagnahmen und Mama erzählen, es wäre für mich nicht brauchbar. Es sei ein Buch für Erwachsene, wahnsinnig spannend, und wenig geeignet für ein ängstliches, zu Alpträumen neigendes Persönchen wie mich. Ich würde es mit Sicherheit wieder zurückbekommen, aber erst, wenn Stella es selbst gelesen hatte, und das konnte dauern.
Fräulein Smilla sollte mich in den Ferien bei meinen Spaziergängen mit unserer Retriever-Hündin Pebbles begleiten. Ich wollte mir ein stilles Plätzchen am Altrhein suchen und die Zeit mit Lesen vertreiben, während Pebbles durchs Gebüsch pirschte, Mäusen hinterherjagte und sich Unmengen Zecken einfing.
Stella nahm mir den Rucksack aus der Hand und holte das Buch heraus. Auf den Buchdeckel achtete sie gar nicht. »Das brauchst du heute nicht.«
»Hey.« Mein lahmer Protest war reine Gewohnheit. Wenn meine Schwester sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, zog sie es durch. Ihre Klassenkameraden kommandierte sie genauso herum wie die Mitglieder ihrer Clique. Zu diesem Zeitpunkt war sie drauf und dran, auch in unserer Familie das Kommando zu übernehmen. Sisyphos hätte schneller seinen Felsblock auf den Gipfelgrat des Mount Everest geschoben, als sich in einer Diskussion gegen Stella durchzusetzen. Sich mit meiner Schwester anzulegen, hieß, unnötige Energie zu verschwenden. Sie musste immer das letzte Wort haben.
Gespielt gelangweilt zuckte ich mit den Schultern. Ich hatte sowieso nichts Besseres zu tun. Mit dem Buch war ich in wenigen Tagen durch, und die Sommerferien hatten gerade erst begonnen. Meine Freundin Mona hing mit ihren Eltern auf Mallorca herum. Insgeheim freute ich mich über Stellas Gesellschaft an diesem Nachmittag. Nachdem sie jahrelang auf mich aufpasste und mich an ihrem Rockzipfel hatte mitschleppen müssen, kam es ausgesprochen selten vor, dass sie freiwillig etwas mit mir unternehmen wollte. Und seit einigen Wochen machte sie sich richtig rar. Ich hatte den Verdacht, dass ein Typ im Spiel war. Stella stritt das rigoros ab. Sie hielt sich sehr viel in ihrem Zimmer auf, wo sie über irgendwelchen Büchern und Unterlagen brütete, auch nach der Zeugnisverleihung am Ende des Schuljahres. Mit dem Telefon war sie nicht zugange. Ich habe ein feines Gehör, und ein Gespräch wäre mir nicht entgangen. Es wäre mir wohl auch nicht entgangen, wenn ich fast taub wäre, so fest, wie ich mein Ohr an ihre Zimmertür drückte, sobald sie darin verschwand. Aber da war nichts.
»Nun sag schon. Was hast du vor? Pebbles braucht Auslauf«, sagte ich.
»Den kann sie haben. Ich will etwas herausfinden. Ich möchte beweisen, dass es die Sumpfhexe wirklich gibt.«
Konzentriert betrachtete ich meine Fingernägel, als ginge mich das alles nichts an.
»Meine kleine Schwester hat mal wieder Schiss.« Stella warf ihr langes Haar mit einer lässigen Kopfbewegung zurück. Wie sie das immer hinkriegte. Wenn ich diese Bewegung zu imitieren versuchte, sah ich aus, als hätte ich einen epileptischen Anfall. Ich hatte es vor dem Spiegel immer wieder ausprobiert. Wie ein Bumerang rutschten meine widerspenstigen roten Zotteln sofort wieder nach vorne und kitzelten meine Wangen.
»Ich hab keinen Schiss. Aber ich habe keine Lust, nach Hexen zu suchen. Nur kleine Kinder glauben an Hexen.«
Für ihr breites Grinsen hätte ich meine Schwester erwürgen können. Ich wusste, woran sie dachte: an die Nächte, in denen ich weinend nach Mama gerufen hatte, weil ich von der Sumpfhexe träumte. Mama musste mir dann warmen Kaba machen und mich trösten, bis ich wieder eingeschlafen war, und das hatte manchmal ganz schön lange gedauert.
»Wir könnten ein bisschen am Altrhein abhängen und Schwäne füttern.«
»Du fütterst die Schwäne. Ich gehe auf die Jagd.« Sie kam mit ihrem Gesicht ganz nahe an meines heran und lächelte mich an. Offen, selbstsicher, überzeugend. In einem Wort: Stella.
»Wir lüften das Geheimnis«, flüsterte sie. »Lass uns herausfinden, was an den Gerüchten und Legenden über die Sumpfhexe dran ist. Wir werden die Philippsburger Geschichte neu schreiben, Annie!« Sie verstummte, als Mama aus der Küche kam.
»Wollt ihr noch weg?«
Mama trug ein neues, blau-weiß gestreiftes Sommerkleid. Es endete knapp über dem Knie. Mama sah darin aus wie ein junges Mädchen. Wahnsinnig hübsch.
»Ich gehe mit Marilyn zum Italiener. Wenn ihr wollt, könnt ihr nachkommen.«
»Wir wollen nicht stören. Wir wissen schließlich, dass du in den Kellner verknallt bist«, sagte Stella.
Mama winkte lachend ab. »Ach was, der ist doch erst Anfang zwanzig. Ich bin viel zu alt für den. Wie sehe ich aus?« Sie drehte sich im Kreis und präsentierte ihren schmalen Körper.
»Scharf wie eine Chilischote«, sagte Stella.
»Bleibt nicht zu lange weg, Mädels, in Ordnung?« Mama küsste jede von uns auf die Stirn. Sie roch gut, nicht nach einem Parfüm, sondern einfach nach Mama. Ich saugte ihn begehrlich ein, diesen Geruch. Sie trug ihn mit sich herum wie eine Aura. Selbst wenn sie an einem Hochsommertag stundenlang im Garten gearbeitet und Unkraut gejätet hatte, roch Mama einfach gut. Wenn Geborgenheit einen Geruch hätte, würde ich ihn Mama nennen.
»Ich passe auf Annie auf«, sagte Stella. Ich warf ihr einen giftigen Blick zu, aber Mama hörte schon gar nicht mehr zu. Sie drehte sich um und verschwand im Bad, wo ich ein Sprühen vernahm. Sie legte Trésor auf, um dem viel zu jungen Kellner zu gefallen.
Es war das letzte Mal, dass ich meine Mutter so sah – Wärme, Frohsinn und Geborgenheit ausstrahlend, - und es war das letzte Mal, dass ich diesen angenehmen, sauberen Geruch an ihr wahrnahm.
Wir holten unsere Fahrräder aus der Garage, während Pebbles aufgeregt hechelnd um unsere Beine strich und unsere Jeans vollsabberte. Sie freute sich auf einen kleinen Ausflug. Ich war die einzige in unserem Trio mit wackeligen Knien und einem Herzen, das aufgeregt in meiner Brust pochte, als wollte es anklopfen, um mir zu sagen: Bleibt zuhause.
*
Wir wohnten in einem kleinen und alten Häuschen, das wir Villa Grün nannten, in der Altrheinstraße am Rande Philippsburgs: Stella, Mama, Opa Klaus und ich. Am Ende der Altrheinstraße führt eine kleine Brücke über einen Altrheinarm auf die Rheinschanzinsel, die von den Einheimischen nur die Insel genannt wird. Ich liebte es, mit Pebbles über die Insel zu laufen und ein stilles Plätzchen zu suchen, wo ich in Ruhe abschalten, und Pebbles ihr Geschäft erledigen konnte.
Eine asphaltierte Straße führt über die Insel bis zum Philippsburger Kernkraftwerk und gabelt sich dort. Nach Westen führt sie Richtung Rheinsheim. Auf der anderen Seite verläuft sie um das Kernkraftwerk herum zu einer Gaststätte, dem Fischerhaus; dahinter beginnt die verwilderte und unberührte Auenlandschaft. Im Süden dieses Geländes sieht man häufig Naturliebhaber und Wanderer. Je weiter man nach Norden kommt, desto unzugänglicher wird das Gebiet. Menschen irren dort für gewöhnlich nicht herum. Schon gar keine Einheimischen. Die erzählen sich Geschichten über dieses Gebiet. Beunruhigende Geschichten.
Die Straße war menschenleer. Vor uns ragten die Kühltürme in den bleigrauen Himmel. Zusammen mit den Hochsicherheitszäunen wirkten sie abweisend wie eine Trutzburg, die uns zuzurufen schien: Bis hierher und nicht weiter. Stella radelte unbeirrt daran vorbei und bog auf den Hochwasserschutzdeich ab, mit dem ihr angeborenen Selbstvertrauen, das sie auch dann nicht erschrecken oder ausweichen ließ, als Pebbles spielerisch nach ihrem im Sommerwind flatternden Hosenbein schnappte. Ich fuhr hinter ihr, weil der Weg auf dem Damm ziemlich eng war, und bewunderte ihre Zielstrebigkeit. Mit sechzehneinhalb war Stella eineinhalb Jahre älter als ich, und ich bewunderte so ziemlich alles an ihr.
Wie eine gekrümmte Hakennase ragt der hinterste Zipfel der Insel in den Rhein hinein. Pappeln wachsen hier dicht an dicht, und der Boden ist von Röhricht und Schilf überwuchert. Bei Hochwasser ist dieses Gebiet überflutet. Es gibt keinen Weg hindurch, nur einen schmalen Trampelpfad, den man nur findet, wenn man von ihm weiß, und der sich nach wenigen Metern im Gestrüpp verliert. Es ist nicht verboten, das Waldstück zu betreten. Aber niemand tut es. Die Philippsburger erzählen sich, dass das Wäldchen verflucht sei, und der Geist einer Hexe dort herumspuke: Die Sumpfhexe. In der Nacht könne man sie manchmal schreien hören, sagten sie. Ich kannte diese Geschichte, seit ich sechs war. Ein Junge aus der Nachbarschaft, Hanjo, hatte sie mir erzählt und mir unzählige Alpträume beschert.
Natürlich glaubt angeblich niemand an die Spukgeschichte. Es gibt keine Geister und keine Gespenster, das weiß doch jeder. Trotzdem machen die Einheimischen einen großen Bogen um dieses Fleckchen Land, das sie den Hexenwald nennen. Das Schilf ist scharfkantig, es gibt jede Menge dorniges Gestrüpp. Der Boden ist tückisch, feucht und sumpfig; man weiß nie, ob man beim nächsten Schritt bis über die Knöchel im Schlamm versinkt. Wenn man die Leute fragt, behaupten sie, sie hätten Angst, sich im dichten Gestrüpp die Hose zu zerreißen. Es wimmelt von Zecken und Mücken, und das Wasser stinkt faulig durch die abgestorbenen Wasserpflanzen.
Als kleines Mädchen bin ich ein kurzes Stück den Trampelpfad entlanggelaufen. Nach wenigen Schritten bohrte sich dorniges Gestrüpp in mein Sommerkleid und schien umso fester an mir zu haften, je panischer ich mich befreien wollte. Es war, als wollte mich jemand festhalten und nicht wieder hergeben. Stella hatte mich schließlich befreit und auf den Weg zurückgebracht.
Die Erwachsen taten das Ammenmärchen von der Sumpfhexe mit einem Lächeln ab. Aber keiner, den ich kannte, hatte den Hexenwald je betreten. Und nun wollte meine große Schwester es tun.
Wir stellten unsere Fahrräder am Rand des Wäldchens ab. Stellas Gesicht glühte.
»Wir gehen jetzt da rein«, verkündete sie.
»Vergiss es. Ich mache nicht mit. Ich weiß immer noch nicht, was du vorhast.«
»Ich suche Spuren. Hinweise. Komm schon! Wir schauen uns um, dann gehen wir wieder.«
»Dann können wir es auch gleich bleiben lassen.«
»Du bist eine alte Spielverderberin.« Stella machte ein enttäuschtes Gesicht. Das konnte sie verdammt gut. Sie schob die Unterlippe ein winziges bisschen vor, wie ein kleines Kind, aber ihr Blick sprach Bände: Meine kleine Schwester gönnt mir nichts. Nicht einmal diese kleine Freude möchte sie mit mir teilen. Sie ist ein Feigling.
Das saß.
»Weißt du, womit ich mich in der letzten Zeit beschäftigt habe?«, fragte sie. »Mit dieser alten Geschichte, die dir früher solche Angst eingejagt hat. Es scheint sie wirklich gegeben zu haben, diese Frau, die in diesem Auenwald gestorben ist, und deren Geist angeblich hier herumspukt. Ich will es ganz genau wissen, und das geht nur, wenn ich da reingehe.«
Während ich fieberhaft über eine überzeugende Ausrede nachdachte, sagte Stella: »Ich habe mir gedacht, dass du mich hängen lässt. Na gut. Dann schicken wir erst mal Pebbles rein.«
»Und wenn ihr etwas zustößt?«, fragte ich atemlos.
»Was soll schon passieren? Sie ist eine Hündin, sie kann auf sich aufpassen.«
»Ja, aber … ich meine …«
»Die Sumpfhexe frisst kleine Kinder, was soll sie von einem Hund wollen?«
Darauf wusste ich keine passende Antwort. Reden war nie meine Stärke, und Stellas Fähigkeit, alles, was sie sagte, im Brustton der Überzeugung herauszubringen – was ihre Gesprächspartner stets vom Gesagten überzeugte, als wäre eine sichere und überzeugende Aussprache die Grundlage der Wahrheit schlechthin -, war an mir völlig verloren gegangen. Mir wurde klar, dass Stella sich das vorher ausgedacht hatte. Sie hatte Pebbles mit Absicht mitgenommen.
»Los, Pebbles!« Herrisch streckte Stella den Arm aus und zeigte auf das Wäldchen, das so scheinheilig und vermeintlich harmlos vor uns lag, und das mir dennoch so viel Furcht einflößte. Da war ich nicht die einzige. Pebbles‘ Nackenfell sträubte sich, sie klemmte den Schwanz zwischen die Hinterläufe und stieß ein jämmerliches Jaulen aus, das mir durch Mark und Bein ging. Stella hob die Stimme und schrie Pebbles an. Die Hündin duckte sich unterwürfig.
Wir liefen ein Stück mit Pebbles den Weg auf und ab, damit sie sich wieder beruhigte. Stellas Gekreische hatte ihr den Rest gegeben, aber es gelang uns schnell, sie abzulenken. Sie schnüffelte schon wieder eifrig auf dem Waldboden herum.
»Gib mir den Rucksack«, sagte Stella. Sie kramte kurz darin und beförderte eine Packung Kauknochen zutage.
Fies. Stella hatte alles durchdacht. Mir fiel ein, wie sie mir den Rucksack aus der Hand gezerrt hatte, um unbemerkt die Kauknochen hineinzupacken. Panik stieg in mir hoch, und ich startete einen letzten Versuch, Stella umzustimmen.
»Pebbles hat instinktiv gespürt, dass da drinnen irgendetwas nicht stimmt. Reicht dir das immer noch nicht als Beweis?«
Als Pebbles das Rascheln der Packung vernahm, spitzte sie aufgeregt die Ohren. Sie drehte sich im Kreis und sprang an Stella hoch. Bei Kauknochen vergaß sie regelmäßig ihre Erziehung – sie war ein lieber Hund, aber ziemlich verhätschelt -, und als Stella den Kauknochen in hohem Bogen in das Gestrüpp des Hexenwaldes feuerte, verschwand Pebbles mit einem Riesensatz darin.
*
Wie ein Leichentuch legte sich eine unheimliche Ruhe über die Insel, als hätte der Hexenwald nicht nur Pebbles, sondern auch alle Geräusche verschluckt. Kein Vögelchen zwitscherte, kein Zweig knackte. Meine Anspannung steigerte sich, als ich in Stellas Gesicht blickte. Sie war totenblass, die Augen weit aufgerissen; als wäre ihr eben erst bewusst geworden, was sie angerichtet hatte. Meinen vorwurfsvollen Blicken wich sie aus.
Die schwarzen Stämme der Pappeln glotzten uns an wie schwarze Skelette. Ich bildete mir ein, in der knorrigen Rinde Gesichter zu erkennen, schmerzverzerrte Fratzen, die ihr Leid hinausschrien.
Es dauerte eine Weile, bis wir zaghaft anfingen, nach Pebbles zu rufen. Insgeheim fürchteten wir, jemand - oder etwas - könnte durch unser Geschrei auf uns aufmerksam werden und aus dem Wäldchen herauskommen. Als wir uns erst einmal überwunden hatten, brüllten wir uns die Seelen aus dem Leib: »Peeebbles!!!«, schallte es über die wie ausgestorben wirkende Insel.
Pebbles kam nicht immer sofort angerannt, wenn sie gerufen wurde. Wenn etwas ihr Hundeinteresse geweckt hatte, setzte sie die Prioritäten anders, als man ihr das an einer guten Hundeschule beibringen würde, aber sie hätte zumindest mit einem Bellen geantwortet.
Außerdem waren da die Kauknochen.
Pebbles war beileibe nicht der klügste Hund auf Erden, zumindest behauptete Opa Klaus das immer, aber sie wusste ganz genau, dass mehr als ein Kauknochen in dem Päckchen war, das Stella immer noch in der Hand hielt, und es geistesabwesend immer wieder zusammendrückte, um Pebbles durch das Rascheln anzulocken. Sie konnte dieses Raschelgeräusch von dem Geraschel von Mülltüten oder Butterbrotpapier unterscheiden.
Es war nicht typisch für Pebbles, einfach zu verschwinden. Ihr musste etwas zugestoßen sein.
»Ich gehe Pebbles suchen«, sagte Stella bestimmt. Sie bat mich nicht, sie zu begleiten. Ich sagte kein Wort, als sie in den Hexenwald eindrang und zwischen den Büschen verschwand.
2
Sommer 2003: Emily
Die Pizza war lecker gewesen, der Rotwein süffig und lieblich, wie sie ihn gerne mochte. Emily Friedrichs Kopf fühlte sich leicht und gleichzeitig schwer an, als sie um kurz nach zehn die Haustür der Villa Grün aufschloss. Im Flur schwankte sie leicht. Gott, sie hatte einen zu viel erwischt, aber der Abend mit ihrer Freundin Marilyn war schön gewesen, sie hatten getratscht und gekichert wie zwei Teenager in der hintersten Schulbank.
Im Wohnzimmer fand sie ihren Vater alleine auf der Wohnzimmercouch liegend vor, wo er »Wetten dass« guckte. Thomas Gottschalk interviewte gerade Ozzy Osbourne. Emily schmunzelte.
»Sind die Mädchen oben?«, fragte sie, während sie die Sandalen von den Füßen streifte und quer durchs Wohnzimmer kickte. Ihr Vater warf ihr einen missbilligenden Blick zu, den sie ignorierte. Wenn man mit neununddreißig noch mit einem Elternteil zusammenwohnte, hatte man längst gelernt, solchen Blicken Nichtbeachtung zu schenken. Mit der Fernsehzeitschrift fächelte sie sich Luft zu. Gott, war dieser Sommer heiß. Und der Knackpo des Kellners hatte ihre Betriebstemperatur nicht unwesentlich erhöht.
»Ich dachte, die wären zu euch in die Pizzeria gekommen?«
»Sie wollten nicht.«
»Vielleicht sind sie bei einer Freundin.« Opa Klaus nahm die Fernbedienung und drückte den Ton lauter. Eindeutig wollte er nicht gestört werden.
Emily dachte sich nichts weiter dabei, dass die Mädchen noch nicht zurück waren. Sie waren zu zweit und hatten den Hund mit, da konnte kaum etwas schiefgehen. Vermutlich hatten sie irgendjemanden getroffen und sich verquatscht, auch wenn es untypisch für die beiden war: Emily kannte ihre Mädchen als pünktlich und zuverlässig.
Im Badezimmer betrachtete sie sich im Spiegel.
»Gar nicht so schlecht für dein Alter, Mädchen«, murmelte sie ihrem Spiegelbild zu. »Die Schönste bist du lange nicht, aber du siehst ganz okay aus.« Mit dem Gesicht ging sie ganz nahe an den Spiegel heran. Ihr langes, dunkelbraunes Haar fiel in der Mitte gescheitelt glatt über die Schultern. Ihre Augen waren groß und braun und ausdrucksvoll, und die Krähenfüße und Fältchen, die sich in den letzten Monaten in ihr Gesicht geschlichen hatten, machten es irgendwie interessanter, wie sie fand. Attraktiver. In dem blaugestreiften Matrosenkleid gefiel sie sich sowieso am besten. Es war kein teures Kleid; Emily verdiente keine Reichtümer in der Oberhausener Modeboutique, wo sie halbtags arbeitete; aber es war leicht tailliert geschnitten und unterstrich ihre schmale Figur, die sie problemlos halten konnte, obwohl sie zwei Kinder geboren hatte und gerne aß.
»Du könntest problemlos einen abkriegen«, hatte Marilyn gesagt. »Sieh dich endlich nach einem Mann um. Eine Menge Männer lassen sich scheiden in unserem Alter, wenn die Kinder erwachsen werden und sie merken, dass nichts mehr ihre Ehe zusammenhält. Wenn du zu lange wartest, kräht kein Hahn mehr nach dir.«
Marilyn hatte natürlich recht. Es hatte eine Zeit gegeben, da hatte Emily geglaubt, sich nie wieder verlieben, oder einem Mann Vertrauen schenken zu können. Dann schob sie die Mädchen als Alibi vor. Sie konnte sich nicht vorstellen, Stella und Annie einen Ersatzvater vor die Nase zu setzen, der zumindest biologisch rein gar nichts mit ihnen zu tun hatte.
Chaotisch genug, dass beide von verschiedenen Männern abstammten, und Emily trotzdem alleinstehend war, nachdem Stellas Vater gestorben, und Annies Erzeuger sie einige Zeit später sitzengelassen hatte. Ein dritter Mann, und sie wären eine von diesen Patchwork-Familien, die in letzter Zeit in Mode gekommen waren.
»Das seid ihr sowieso«, hatte Marilyn gesagt und an ihrem Barolo genippt. »Aber statt einem Lebensgefährten präsentierst du den Kids ihren Opa, der lieber in seiner Werkstatt herumschraubt, als sich mit ihnen zu beschäftigen. Wann hattest du eigentlich zum letzten Mal Sex? Als die Dinosaurier die Erde bevölkerten? Normal geht anders, Emily.«
Aber wenn sie wirklich jemanden kennenlernte, was machte sie dann mit Opa Klaus? Er war vor fünfzehn Jahren zu ihr in die Villa Grün gezogen, als Emily mit zwei kleinen Kindern alleine dastand; nach dem viel zu frühen Krebstod seiner Frau drohte er zu vereinsamen, und Emily konnte ihn schlecht abservieren, wenn sie sich neu orientierte.
Mit Opa Klaus war das so eine Sache. Sie konnte sich nicht erinnern, dass er nach dem Tod ihrer Mutter jemals auch nur ansatzweise Interesse an einer anderen Frau gezeigt hätte, obwohl er beileibe nicht alt gewesen war. Das war schon irgendwie seltsam.
Und noch seltsamer ist, dachte sie, dass ich genauso werde wie er. Emily seufzte und zwang sich, an etwas anderes zu denken.
Schwungvoll riss sie die Badezimmertür auf und erschrak, weil Opa Klaus direkt davor stand.
»Sie sind immer noch nicht zurück«, sagte er.
»Du hast doch gesagt, sie sind bei einer Freundin …«
»Ich habe gesagt, vielleicht sind sie bei einer Freundin.«
Es war Viertel vor elf. Stella kam für gewöhnlich um zehn nach Hause, wenn sie abends unterwegs war, außerdem gab sie immer Bescheid, wenn es einmal später werden sollte. Schon wegen Annie, die sie gerne wie ein kleines Mädchen behandelte und ein bisschen bevormundete, wäre sie wesentlich früher zurückgekommen.
»Ich rufe mal bei Selina an«, sagte Emily.
Stella und Annie waren nicht bei Selina. Sie waren auch bei keiner anderen Freundin, die Emily und Opa Klaus in der nächsten Stunde telefonisch zu erreichen versuchten, wobei sie einige Eltern aus dem Bett werfen mussten. Niemand hatte die Mädchen gesehen oder etwas von ihnen gehört, und ein Handy hatten sie nicht, obwohl sich Stella sehnlichst eines wünschte.
»Ich gehe sie suchen«, sagte Opa Klaus und nahm seine Autoschlüssel vom Sideboard, als ihn ein Geräusch an der Tür zusammenschrecken ließ. Ein Kratzen, ein Winseln. Opa Klaus öffnete die Tür. Pebbles stand mit hängendem Kopf davor. Als Emily sah, wer hinter der Hündin stand, fing sie an zu schreien.
3
Frühjahr 2013: Annie
Todernst drückt mir Ines das Telefon in die Hand. Sofort weiß ich, dass etwas passiert ist. Der gemütliche kleine Zug, der mich in den letzten Jahren durch das Leben gefahren hat, ist an der Endstation angekommen.
Die Nummer im Display ist mir vertraut, obwohl sie nur alle paar Monate darauf erscheint. Die Nummer, mit der ich aufgewachsen bin. Zuhause. Das Wort mit dem schalen Nachgeschmack. Mama ist dran. Das verwirrt mich, weil sonst meistens Opa Klaus anruft; Mama hat wegen der Arthritis Schwierigkeiten mit der Tastatur.
»Papa ist tot«, sagt sie. »Gestern Abend musste er ins Krankenhaus. Es war ein Herzinfarkt. Heute um die Mittagszeit ist er gestorben. Ich hätte früher angerufen, aber in der Eile habe ich vergessen, das Handy mit ins Krankenhaus zu nehmen, und die Nummer von eurem Laden weiß ich nicht auswendig.«
Ich schließe die Augen. Das Bild eines Sarges erscheint in meinem Kopf.
»Ist Verena nicht da?«, fragt sie.
Hättest du lieber mit deiner Schwester gesprochen als mit deiner Tochter, Mama?, denke ich.
»Verena macht Urlaub am Gardasee«, sage ich. »Ich komme nach Hause, Mama.«
Ich drücke sie weg, ohne ihre Antwort abzuwarten. Den Hörer weiterhin ans Ohr gepresst und »Ja, ja, natürlich« murmelnd, durchquere ich eiligen Schrittes den Supermarkt, um in mein Büro zu gelangen und gleichzeitig den Fragen der Mitarbeiterinnen zu entgehen, die mich neugierig anstarren.
Der weiche, lederbezogene Bürostuhl federt sanft, als ich mich hineinplumpsen lasse. Die Tränen hängen hinter meinen Augen fest, wo ich sie deutlich spüren kann. Sie treiben mir die Hitze in die Wangen und schnüren mir den Hals zu, bereiten mir körperliche Schmerzen, aber ich schaffe es nicht, sie fließen zu lassen.
Ines schlendert kaugummikauend herein. »Stress?«, fragt sie mitfühlend.
»Mein Großvater ist gestorben. Ich muss heimfahren, meine Mutter schafft das nicht alleine. Kommt ihr ein paar Tage ohne uns klar?« Ich bin stellvertretende Filialleiterin in diesem Supermarkt, der von meiner Tante Verena geführt wird.
»Aber hallo«, sagt Ines. Sicher kommen wir klar, wir werden eine Zigarette nach der anderen qualmen und Pause machen bis zum Abwinken.
Aber ich weiß, dass sie darauf achten, dass zumindest eine der Kassen immer besetzt ist, und die neu angelieferte Ware ordentlich in die Regale geräumt wird. Sie schaffen es, den Laden am Laufen zu halten. Ich kenne die Frauen seit Jahren und vertraue ihnen.
Ich gebe Ines die Ladenschlüssel und ein paar Anweisungen. »Null Problem«, sagt sie. »Verlass dich auf uns.« Sie wird mir fehlen. Genau wie die anderen Frauen, die Mitarbeiterinnen aus dem Supermarkt. Ich habe nicht viel außer ihnen.
»Alles in Ordnung mit dir?«, fragt Ines forschend.
»Ja, ja, alles klar.« Ich nicke und umarme sie kurz. Wir hätten Freundinnen werden können, waren aber nur gute Bekannte. Feste Beziehungen sind nicht meine Stärke.
*
Die Fensterhöhlen des Wohnbunkers, in dem ich in den letzten Jahren gelebt habe, glotzen mich abweisend an wie die Eingänge eines verlassenen Bienenstocks. Meine Wohnung befindet sich im zweiten Stock dieses Bunkers, der am Stadtrand von Heilbronn neben einer ganzen Reihe dieser hässlicher Kästen steht. Einer sieht aus wie der andere. Unterschiede gibt es nur an den Gardinen sowie bei den Blumenkübeln auf den winzigen Balkonen. Hier habe ich mich versteckt. Hier fragt mich keiner, warum ich, eine scheinbar ganz normale Frau Mitte Zwanzig, nur selten Besuch bekomme und am liebsten alleine bin. Niemand schert sich um seine Nachbarn. Dennoch ist die Gegend sicher. Die Wohnblocks werden von einem Hausmeister in Schuss gehalten, und die Hausverwaltung wählt die Mieter sorgfältig aus. Der Hausflur ist frisch getüncht, die Briefkästen leuchten in hübschem Rot. In meinem befinden sich heute nur Werbeprospekte. Wie so oft.
Von den Zimmerpflanzen abgesehen, ist meine Wohnung eher zweckmäßig als gemütlich eingerichtet. Weder gibt es Bilder an den Wänden, noch steht unnützer Nippes herum. Vom hypermodernen Fernsehapparat abgesehen, für den ich eine ordentliche Stange Geld ausgegeben habe, erinnert die Wohnung an eine geräumige Mönchszelle.
Mit Hilfe meiner Urlaubspackliste, die ich letztes Jahr für eine Geschäftsreise erstellt habe, packe ich alles in meinen Koffer, was ich für ein paar Tage brauche. Anschließend stopfe ich wahllos Zeug in die Sporttasche, die die Frauen aus dem Supermarkt mir zum Geburtstag geschenkt haben, und die ich bis jetzt kein einziges Mal benutzt habe. Dann sind die Plastiktüten dran, die ich unter der Spüle meiner winzigen Küchenzeile aufbewahre. Den Rest werde ich später holen.
Zuletzt gehe ich von Pflanze zu Pflanze, streichele ihre Blätter und spreche mit jeder von ihnen. Ich gieße sie alle nochmal, weil ich nicht weiß, wann ich wieder dazu komme. Sie sehen traurig aus, aber das bilde ich mir bestimmt nur ein.
»Bald komme ich euch holen«, sage ich. »Im Sommer stelle ich euch in den Garten. Das wird euch gefallen. In Philippsburg ist es viel schöner als hier.« Lügnerin, flüstert eine Stimme in meinem Kopf.
Ich rufe Verena an und informiere sie, was passiert ist. Dann fahre ich nach Hause.
*
In Philippsburg angekommen, nehme ich mir die Zeit für eine kurze Rundfahrt durch meine Heimatstadt. Viel hat sich nicht verändert. Am Kreisel zur Abfahrt auf die Rheinschanzinsel steht ein Storch in seinem Nest auf einem Strommast. Die Kühltürme des Kernkraftwerks ragen plump über der Stadt auf, einer dampfend wie ein riesenhafter Drache, der andere grau und tot. Hie und da steht ein neues Haus auf einem zuvor unbebauten Grundstück. Die kleinen Geschäfte an der Söternstraße sind überwiegend dieselben wie vor zehn Jahren. Ich spähe bei Fußgängern und Passanten nach einem bekannten Gesicht, entdecke aber niemanden, den ich kenne. Ich sehe nur Fremde, obwohl ich mir einbilde, dass alle meinem roten Golf hinterherstarren, was natürlich Unsinn ist.
Villa Grün wirkt kleiner auf mich als damals. Es scheint, als wäre das Haus ein Stück von der Straße weggekrochen und hätte sich ein, zwei Meter nach hinten verschoben, als versuchte es sich zu verstecken. Vermutlich liegt das an dem Apfelbaum im Vorgarten, der wesentlich größer geworden ist, und die alte Villa kleiner aussehen lässt. Früher hat ihn Opa Klaus jedes Frühjahr zurückgeschnitten, damit er den Sonnenstrahlen nicht im Weg steht. Vermutlich hat ihm das in letzter Zeit zu viel Mühe bereitet. Bei den wenigen Telefonaten hat er nicht erwähnt, dass es ihm nicht gut geht. Er hat überhaupt nicht viel gesagt, und wenn, dann habe ich ausweichend geantwortet.
»Die Oleander sind voller Blattläuse«, sage ich, als Mama die Tür öffnet. Ich bin befangen, vermeide den Augenkontakt und widme meine Aufmerksamkeit den kümmerlichen Sträuchern. Es ist ein unbeholfener Versuch, meine Verlegenheit zu überspielen, weil ich ihr zum ersten Mal seit zehn Jahren gegenüberstehe. Zum ersten Mal, seit sie mich weggeschickt hat, als fünfzehnjähriges, verstörtes und unglückliches Mädchen.
»Ach ja, die Oleander. Ich werde Frau Kreuzer bitten, sie mit Schädlingsbekämpfungsmittel zu spritzen.«
»Um den Garten werde ich mich kümmern.«
Auch der Flur wirkt enger auf mich als früher. Die Luft ist miefig und regelrecht schwer, als wäre sie immer noch mit Trauer geschwängert. Ich trete ein.
Wir schauen uns an, Mama und ich.
»Gut siehst du aus«, sage ich.
Sie lacht. »Das ist ja wohl ein Witz. Ich sehe schaurig aus. Mein Körper geht vor die Hunde«, sie tippt sich an die Stirn, als wollte sie mir den Vogel zeigen, »aber hier oben bin ich in Ordnung, also versuch erst gar nicht, mich auf den Arm zu nehmen.«
»Ich meine nur … ich hab’s mir schlimmer vorgestellt.«
»Jetzt hör aber auf.« Sie winkt unwirsch ab.
Mamas Haar ist immer noch lang und dunkel. Der Farbton unterscheidet sich leicht von dem, an den ich mich erinnere, er ist gleichmäßiger, künstlicher. Gefärbt. Das kräftige Dunkelbraun steht im Kontrast zu ihrer fahlen, ungesund aussehenden Haut. Mama steht leicht gebückt. Ich sehe Falten in ihrem Gesicht, keine Altersfältchen oder Krähenfüße, sondern Falten der Bitterkeit und des Schmerzes. Ihre Kleidung ist labberig, ausgewaschen und billig, und sie ist dünn wie ein Spargel.
Umständlich dreht sie sich um und humpelt in die Küche, wobei sie sich an den Wänden abstützt. Für ihre Gehhilfe ist es in der Villa Grün zu eng. Ich folge ihr und nehme meinen alten Lieblingsplatz am Fenster ein.
»Papa hat sich nach der Frühschicht hingelegt«, beginnt sie zu erzählen, während sie Kaffee macht. »Das war ungewöhnlich für ihn, aber ich habe mir nichts dabei gedacht. Nach einer Weile ist er aufgestanden, um zu duschen. Ich habe ihn ganz vergessen, weil der Henssler gerade auf ZDF gekocht hat.« Sie holt meine alte Lieblingstasse – rot mit weißen Punkten – aus dem Küchenschrank und stellt die Zuckerdose vor mir ab. Gerührt registriere ich, dass sie sich daran erinnert, wie ich meinen Kaffee gerne trinke: schwarz und sehr süß. Ihre Finger sind verkrümmt. Das Halten der vollen Tasse bereitet ihr sichtlich Mühe.
»Erst am Ende der Sendung ist mir aufgefallen, dass es ganz still war im Bad. Die Dusche hat nicht gerauscht. Ich bin hin und hab an die Tür geklopft; keine Antwort, auch nicht auf mein Rufen. Also hab ich die Tür aufgemacht, und da lag er auf den Fliesen. Sein Gesicht war ganz blau.« Sie beginnt zu weinen. »Gottseidank hatte er nicht abgeschlossen.«
Ich warte geduldig, bis sie sich wieder ein wenig beruhigt hat.
»In der Aufregung bin ich auch noch gestürzt, als ich zum Telefon eilen wollte, um den Notarzt zu rufen«, sagt sie kopfschüttelnd, als wäre sie deswegen wütend auf sich. »Ich habe es alleine auf die Beine geschafft, aber das hat ein paar Minuten gedauert. Diese Krankheit ist der allerletzte Mist.« Sie nimmt einen Schluck Kaffee.
»Im Krankenhaus ist Papa nicht wieder zu sich gekommen. Sein Gehirn hat zu wenig Sauerstoff abgekriegt, weil er nicht geatmet hat, als ich ihn gefunden habe. Wäre ich nicht gestürzt …«
»Das ist doch nicht deine Schuld. Wer weiß, wie lange er schon so dagelegen hat.«
»Er ist heute früh gegen fünf gestorben. Die Ärzte konnten nichts mehr für ihn tun«, sagt sie.
Ich erinnere mich, wie ich vor zehn Jahren hier an diesem Küchentisch Verena gegenübersaß und zu begreifen versuchte, dass meine Schwester nie wieder zurückkommen würde. Auf dem Tisch liegt immer noch eine rotkarierte Wachstuchtischdecke, vermutlich in der fünften Tischdecken-Generation.
»Wie lange bleibst du hier?«, fragt Mama.
»Ich ziehe bei dir ein«, sage ich. »Du kannst doch nicht alleine leben, mit deinen schlimmen Beinen und Händen.«
Wenige Wochen nach Stellas Tod begann Mama über schlimme Schmerzen in den Gelenken zu klagen. Die Ärzte diagnostizierten rheumatoide Arthritis. Ihr Zustand hat sich in den letzten Jahren rapide verschlechtert. Mama kann nur noch mit Mühe laufen.
»Mit dem Silberpfeil – den hast du bestimmt draußen stehen sehen - schaffe ich es mindestens bis zur nächsten Straßenkreuzung. An einem guten Tag jedenfalls.« Sie seufzt. »Die Treppe ins Obergeschoss bin ich seit Ewigkeiten nicht hochgestiegen. Du wirst in deinem Zimmer erst mal abstauben müssen.«
Nicht nur mein Zimmer, denke ich. Villa Grün hat einen Hausputz bitter nötig.
»Und was ist mit deiner Arbeit?«, fragt sie.
»Verena muss meine Stelle neu besetzen. Sie ist übrigens auf dem Weg von Italien hierher. Ich habe sie angerufen. Sie kommt am späten Abend an.«
Mama nickt. »Ich bin froh, dass du gekommen bist. Es gibt so viel, um das ich mich kümmern muss. Versicherungen müssen gekündigt werden. Eine Menge Papierkram. Papas Auto müssen wir abmelden oder verkaufen. Dann die ganze Kondolenz, die Beerdigung, seine Sachen … Das ist alles so schwierig ohne Auto, ich kann nicht fahren mit meinen Beinen, und das Internet ist einfach nicht mein Ding.«
»Du klingst wie eine alte Frau.« Ich muss schmunzeln. »Dabei bist du noch keine Fünfzig.«
»Ich fühle mich wie eine alte Frau. Wenn du hättest, was ich habe, würdest du es verstehen.«
»Gerade für dich wäre ein Austausch in sozialen Netzwerken ideal.« Das sagt die richtige, denke ich im Stillen.
»Du meinst so etwas wie eine Online-Selbsthilfegruppe für Verkrüppelte? Bleib mir damit fort.«
Mama verliert kein Wort darüber, warum sie mich weggeschickt hat. Sie fragt auch nicht, wie es mir in den letzten Jahren ergangen ist, geschweige denn entschuldigt sie sich bei mir. Sie nimmt einfach hin, dass ich mein bisheriges Leben aufgeben werde, um mich um sie zu kümmern. Mir ist das recht. Wenn sie begänne, mit dem Fingernagel die kärglich verschorfte Wunde aufzukratzen, würde ich vermutlich sofort abreisen.
*
Am Fuß der Treppe ins Obergeschoss befindet sich eine Nische. Im Winter oder bei schlechtem Wetter stellt Mama ihre Gehhilfe, den »Silberpfeil«, dort ab, um sie vor der Witterung zu schützen. Mit dem dunkelbraunen Teppichboden wirkt die Nische düster, obwohl sich an der Wand ein Fenster befindet. Ein schwerer Vorhang dämpft das hereinfallende Tageslicht.
Damals stand noch eine kleine, altmodische Kommode an der Wand. Das Geweih eines jungen Hirsches lag darauf. Klaus wollte es an einer Halterung befestigen und als Wandhaken über der Kommode anbringen, wie er es im Haus eines Arbeitskollegen gesehen hatte. Ich muss an den fürchterlichen Unfall denken, der wenige Wochen nach Stellas Tod geschah. Ein Junge aus meiner Schule war die Treppe hinuntergestürzt und auf der Kommode gelandet. War sie zu Bruch gegangen, als er mit seinem vollen Gewicht dagegen krachte? Ich weiß es nicht mehr. An das entsetzte, weit aufgerissene Auge des Jungen erinnere ich mich in allen Details. Es war das linke Auge. Im rechten steckte die Spitze des Geweihs, weit genug, um in sein Gehirn einzudringen und den Jungen zu töten. Wild strampelnd lag er auf dem Boden neben der Kommode, mit den Beinen halb auf der Treppe. Man hat mir später versucht einzureden, es seien Reflexe gewesen, aber ich bin sicher, er hat da noch gelebt, vielleicht hat er mit dem gesunden Auge sogar das Geweih aus seinem Schädel herausragen sehen.
Ich habe geschrien und nicht mehr damit aufgehört. Kurz darauf hat Verena mich zu sich geholt.
Um in mein Zimmer zu gelangen, muss ich diese Nische passieren. Ich werde mich daran gewöhnen müssen. Beklommen steige ich die Treppe hoch ins Obergeschoss. Langsam, als würde oben ein Gespenst auf mich warten. Als würde dort das Wesen hausen, das Mama krank gemacht und Opa Klaus getötet hat. Das Wesen, das die Luft zum Stinken bringt, das Staub auf die Möbel legt und Schwermut auf die Seele. Außer einem kleinen Bad befinden sich neben meinem nur noch Stellas Zimmer und das Schlafzimmer von Opa Klaus hier oben.
Mein Zimmer sieht aus, wie ich es vor zehn Jahren verlassen habe. Irgendwann hat jemand aufgeräumt, hat herumliegende Stifte und Kugelschreiber ordentlich in einen Becher und meine Bücher ins Regal gestellt. Meine Plüschtiere wirken zerknautscht und geknickt, einsam und vergessen. Traurig schauen mich angestaubte Knopfaugen an.
Ich hole Bettwäsche aus dem Schrank und beziehe das Bett neu. Die Bezüge riechen gruselig nach Mottenkugeln, aber für die erste Nacht wird es gehen. Dann gehe ich wieder zu Mama ins Erdgeschoss. Sie sitzt am Küchentisch und starrt aus dem Fenster. Ein Sonnenstrahl, der den Weg durch die Wolken gefunden hat, scheint ihr direkt ins Gesicht und lässt sie uralt und verbittert aussehen.
*
Nach dem Abendessen zieht es mich nach draußen.
Ich ziehe die Kapuze meines Hoodies über den Kopf, vorgeblich wegen der steifen Brise, aber in Wirklichkeit möchte ich nicht erkannt werden. Ich bilde mir ein, die Leute würden sich mit morbider Begeisterung auf mich und die Geschichte mit Stella stürzen, wie damals, obwohl es schon zehn Jahre her ist. Oder mich nach Details über Opa Klaus‘ Tod ausfragen. Ich bin nicht in der Stimmung, darüber zu reden.
In einem Vorgarten am Ende der Altrheinstraße werkelt ein Mann herum. Er sieht mich schon von weitem kommen, hält aber erst inne, als ich vor seinem Gartentor stehe. Seine gespielte Gleichgültigkeit erinnert mich an früher und amüsiert mich. Er hebt den Kopf, und als er bemerkt, dass ich ihn beobachte, kommt er auf den Gehsteig heraus.
»Lang ist’s her«, sagt Hanjo. »Schön, dich wiederzusehen.« Seine Wangen glühen. Er scheint sich riesig zu freuen.
»Fett biste geworden.« Freundschaftlich kneife ich in Hanjos Schmerbäuchlein, das sich fröhlich über seiner Jeans wölbt.
»Low waiste ist total in.« Er grinst. Dann wird er ernst. »Mein Beileid, Annie.«
Fast erwarte ich, dass Hanjo sagen wird: Dein Opa war ein total klasse alter Knacker. Aber das tut er nicht.
»Danke dir.« Ich nicke. »Ich werde für immer hier bleiben, Hanjo.«
»Es geht nicht ohne Philippsburg, was?« Er lässt seinen Blick über die Häuser in der Altrheinstraße schweifen, als wären sie der Grund für meine Rückkehr. »Ich hab’s gewusst. Du gehörst hierher. Willst du reinkommen auf ein Bier?« Hanjos Eltern sind vor ein paar Jahren weggezogen und haben ihm das Haus überlassen.
»Ich will Mama nicht so lange alleine lassen«, lüge ich. Sie würde sich bestimmt nicht beschweren, wenn ich länger weg bliebe, aber ich will noch ein wenig alleine sein. Nicht, dass ich das in den letzten Jahren selten gewesen war. Aber ab sofort wird es nichts Selbstverständliches mehr sein.
»Wir sehen uns, Hanjo. Darf ich auf dich zukommen, wenn wir Hilfe im Garten oder am Haus benötigen?«
»Allzeit bereit.« Er salutiert. Ein Feldwebel hätte ihn wegen seiner Wampe kritisiert. Ich versuche, ihn nicht allzu direkt anzustarren. Hanjo ist alles andere als hässlich. Aber er hat wenig Gespür dafür, sich zu präsentieren, anderen zu gefallen. Er liebt mich, das weiß ich. Dennoch hat er meine Vorschläge in Sachen Stilberatung früher geflissentlich ignoriert.
»Ich sitze den ganzen Tag auf dem Hintern und verkaufe Kredite. Gegen ein bisschen Bewegung habe ich nichts einzuwenden, schon gar nicht, wenn ich dir dabei helfen kann.«
»Super«, sage ich. »Bis bald.«
Ich winke Hanjo noch einmal zu und spaziere weiter. Als ich die Abzweigung zur Insel erreiche, kommt mir eine unangenehme Vorstellung: Hanjo und ich, wie wir in dreißig, vierzig Jahren immer noch unsere Stellung in der Altrheinstraße halten, ich alleine in der Villa Grün und er am anderen Ende der Straße in seinem Elternhaus, einsam in seinem Vorgarten werkelnd, um nur ja nichts zu verpassen.
Es fühlt sich an wie im Gefängnis.
Ich weiß, dass es dazu nicht kommen wird. Ich wurde nicht geboren, um alt zu werden.
4
Sommer 2003: Annie
»Annie … bitte, wach endlich auf!«
Vor meinen Augen wurde eine Art Bühnenvorhang aufgezogen. Ich blinzelte ins Sonnenlicht. Ich lag in meinem Bett; meine Tante Verena saß im schicken schwarzen Hosenanzug daneben auf einem Stuhl und hielt eine Tasse in der Hand, die sie mir an die Lippen führte. Das ist die falsche Tasse, dachte ich, ich trinke immer aus der roten mit den weißen Punkten.
»Du musst etwas essen und trinken, Kindchen.«
Kindchen! Ich setzte mich auf. Einen Moment lang hatte ich das Gefühl, in einen anderen Körper geschlüpft zu sein. Statt meinem gewohnten Pyjama trug ich ein fremdes Nachthemd, aus dem meine Arme und Beine dünn und zerbrechlich wie Streichhölzer herausragten. Vorsichtig bewegte ich alle viere. Ja, sie gehörten zu mir, das war ich, und ich war schrecklich abgemagert, irgendwie über Nacht.
»Bist du wach? Gottseidank!«, rief sie. Dann nahm sie mich überschwänglich in die Arme und verkleckerte meine Bettdecke mit Kakao.
»Du warst tagelang weg, wie in Trance. Hast kaum reagiert und nur sehr wenig gesprochen. Du hast nichts zu dir genommen, außer hin und wieder einem Schluck Wasser. Wir wollten dich heute ins Krankenhaus bringen und an den Tropf hängen lassen.«
Auf meinem Nachttisch stand ein Teller mit kleingeschnittenen Marmeladebrotstückchen. Energisch schob mir Verena ein Stück in den Mund und füllte warmen Kakao hinterher. Ich schluckte brav, um nichts zu verschütten, kaute mechanisch. Reiterchen fürs Kindchen, dachte ich und fühlte mich, als wäre ich drei Jahre alt.
»Bin ich krank oder so?«
Verena seufzte. »Irgendwie schon …«
»Was ist das für ein Nachthemd?«
»Eins von mir. Ich hab mich nicht zurechtgefunden in deinem Schrank. Den werden wir mal gründlich aufräumen müssen.«
»Wo ist Mama?«
»Unten«, sagte Verena. »Es geht ihr nicht gut.«
»Wieso?« Ich ließ meinen Blick durchs Zimmer schweifen. Meine Plüschtiere, längst nicht mehr in Gebrauch, saßen in einer Reihe auf dem Bücherregal und starrten mich an. Was ist los? fragten ihre Knopfaugen. Was ist geschehen?
»Annie, kannst du dich an irgendwas erinnern?«
»An was denn?«
»Es ist etwas Schreckliches passiert.« Verena begann zu weinen. Ich habe sie nie zuvor weinen sehen.
Verena fing sich schnell wieder. »He, kommt ihr mal hoch?«, rief sie Richtung Zimmertür. »Annie ist aufgewacht!«
Es polterte auf der Treppe. Opa Klaus stürmte herein. »Ist sie aufgewacht?«, fragte er.
»Ja«, sagte Verena, »das siehst du doch.«
»Wie lange habe ich denn geschlafen?«, fragte ich und schaute auf meinen Wecker. Halb zehn. »Ist doch gar nicht spät.«
»Ganz schön lange.« Opa Klaus umarmte mich linkisch. »Kannst du aufstehen?«
»Ich glaub schon, wenn mir jemand hilft. Aber ich will mir was anziehen.«
»Ich warte draußen«, sagte Opa.
Ich war total wackelig auf den Beinen. Verena bugsierte mich in meine Klamotten. Sie zog und zerrte dabei an mir herum, als würde ein ungeduldiges Kleinkind seine Puppe anziehen.
»Autsch!«
»Tut mir leid. Ich habe dich zwei Tage lang gewaschen und umgezogen.« Sie musterte mich prüfend. »Jetzt kannst du es wieder alleine.«
Auf dem Flur nahmen mich Opa Klaus und Verena in die Mitte. Sie mussten mich stützen, weil ich echt geschwächt war. Stellas Zimmertür war geschlossen. »Ist Stella nicht zuhause?«, fragte ich.
»Vorsicht an der Treppe«, sagte Verena statt einer Antwort. Ich ließ Opa Klaus los und klammerte mich stattdessen am Geländer fest. Es war so still im Haus, ganz ungewohnt. Sonst hörte man immer was. Mamas Radio, Stellas Lachen, oder irgendein Sägen oder Schleifen in Opa Klaus‘ Werkstatt.
Heute war Totenstille.
»Guten Morgen, Annie.«
Mama saß auf der Wohnzimmercouch. Kerzengerade und irgendwie steif, wie eine Schaufensterpuppe, die man dort hingesetzt hat, und die jeden Moment umkippen kann. Sie war käsebleich im Gesicht und sah auch sonst irgendwie komisch aus.
»Warum bist du nicht in der Schule?«, fragte Mama.
»Sie nimmt Medikamente«, sagte Verena zu mir. »Setz dich hin, Kindchen.« Sie drückte mich in einen Sessel, postierte sich rechts von mir und Opa Klaus links, Mama saß mir gegenüber, und dann erzählten sie mir, was geschehen war.
Opa Klaus begann mit brüchiger Stimme zu reden.
»Letzten Samstag seid ihr losgezogen – Stella, du und der Hund. Spätabends bist du mit Pebbles heimgekommen«, sagte er. »Wir haben die Polizei verständigt, weil du uns nicht sagen konntest, wo Stella steckt. Am nächsten Morgen haben sie angefangen, nach ihr zu suchen. Sie hatten einen Suchhund dabei, der schließlich Witterung aufnahm…«
»Es war eine Hündin«, sagte Verena schniefend. »Sie hieß Pauline. Ein lustiger Name für einen belgischen Schäferhund, findest du nicht auch? Noch dazu für einen Spürhund?«
»Bitte unterbrich mich nicht. Dort, wo der Pfad in die Auenlandschaft hineinführt, ganz am Ende der Insel, haben sie eure Fahrräder gefunden. Sie standen ordentlich abgestellt nebeneinander auf dem Weg.« Er rieb sich die Augen. »Die Polizisten haben das Gebiet abgesucht und schließlich Stella gefunden. Sie ist tot, Annie.«
»Nein, ist sie nicht«, sagte Mama. »Die haben nur ein paar Knochen gefunden.«
»Es war Stellas Leichnam«, sagte Verena.
»Stella ist nicht tot, sie macht nächstes Jahr ihren Schulabschluss«, sagte Mama.
»Emily …«
»Seid still, seid doch still!«, schrie ich und sprang auf. In diesem Moment kehrte die Erinnerung zurück: Stella, wie sie den Kauknochen warf. Stella, die in den Hexenwald ging und vom Unterholz verschluckt wurde. Vor meinen Augen wurde es schwarz. Meine Beine knickten ein. Ich ging zu Boden.
*
In der Villa Grün ging es zu wie in einem Taubenschlag. Nachbarn, Bekannte und eine Menge fremde Leute gaben sich die Türklinke in die Hand. Wir hatten den ganzen Tag Besuch. Jede freie Fläche im Haus war überhäuft mit Beileidskarten und Geschenken. Alle möglichen Sachen; Blumen, Bücher, Weinflaschen und noch mehr Blumen. Außerdem gab es Unmengen zu Essen. In der Küche und im Esszimmer häuften sich Töpfe mit Suppe, Teller mit Kuchen, selbstgebackenem Brot und allen möglichen anderen Leckereien. Die Leute schienen zu glauben, wir müssten uns vor lauter Trauer über Stellas Verlust eine Fettschicht anfressen.
Verena hatte alle Hände voll zu tun. Sie nahm den Besuchern die Blumen ab und stellte sie in Vasen. Sie kümmerte sich um das Essen, das ansonsten vergammelt wäre. Einen Teil fror sie ein oder bot es den Kondolierenden an. Einige nahmen das Angebot dankbar an und mampften mit vollen Backen, während sie zwischen zwei Bissen fade Parolen wie »Alles wird gut« von sich gaben, oder von der Aufstellung einer Bürgerwehr schwadronierten, die den Täter ausfindig machen, aufknüpfen und Gott weiß was mit ihm anstellen sollte. Mit einer Selbstverständlichkeit wühlten sie in unserem Schmerz herum, glaubten zu wissen, was wir empfinden und erdulden mussten.
Die meisten Besucher waren mir völlig gleich, egal, ob ich sie kannte oder nicht. Ich schaute weg, wenn mich jemand ansah, und nickte stumm, wenn mir irgendeiner die Hand drückte. Alle redeten wohlwollend auf mich ein. Ich hörte nicht hin. So ging es den ganzen Nachmittag. Ich wünschte, ich hätte die Möglichkeit, in den halbkomatösen Zustand der letzten Tage zurückzukehren, für den Rest meines Lebens.
Ein winziger Lichtblick in diesen grauenhaften Stunden war meine Freundin Mona, die mittlerweile aus Mallorca zurückgekehrt war.
»Annie, oh my God!«, schluchzte sie immer wieder. Klug und patent stand sie den Besuchern Rede und Antwort, forderte mich dazu auf, mein Haar zu kämmen und die Zähne zu putzen – Dinge, die mir angesichts der Tatsache, dass meine geliebte Schwester nie wieder zurückkommen würde, unsagbar banal erschienen. Stündlich zwang sie mir ein Glas Wasser ein, das sie mir mütterlich-energisch an die Lippen hielt, bis ich brav ausgetrunken hatte. Ich hätte das Trinken schlichtweg vergessen.
*
Später am Abend, als wir unter uns waren, saß ich mit Verena in der Küche. Das Licht war gedämpft, die Uhr an der Wand tickte leise. Mama lag in ihrem Bett. Verena hatte ihr ein Beruhigungsmittel gegeben, weil sie den Besuchern von Stella erzählt hatte, als wäre diese noch am Leben.
»Sie hat gesagt, dass sie morgen mit Stella einkaufen gehen würde, und dass Stella nächste Woche vorhat, mit ein paar Freundinnen am Freyersee zu zelten. Sie hat ohne Punkt und Komma wirres Zeugs geredet, den ganzen Nachmittag. Ich hab’s einfach nicht mehr ausgehalten.«
Ich saß vor einem Teller Champignoncremesuppe. Sie wärmte mich von innen; ich fror, obwohl Verena beteuerte, dass die Sommerhitze kaum auszuhalten sei. Trotzdem bekam ich nur wenig runter. In der rechten Hand hielt ich den Löffel, in der linken eine Scheibe Brot. So hatte ich es als Kind immer gemacht. Ich fing an, mit dem Brot herumzuspielen.
»Papa will nicht recht, dass ich es dir erzähle, aber ich finde, du bist alt genug, um alles zu wissen.« Sie sprach, während ich gedankenverloren die Tischdecke vollkrümelte und eine Spur aus Brotkrumen um den Teller legte.
Pauline hatte die Polizisten zu einem halb ausgetrockneten Tümpel auf der Rheinschanzinsel geführt. Dort bargen die Beamten ein menschliches Skelett. Es lehnte am Rande der sumpfigen Mulde im brackigen Wasser an einem umgestürzten Baumstamm im Hexenwald. Am Rande des Tümpels lagen eine rosa karierte, ärmellose Bluse, helle ausgewaschene Denims und Sandalen sowie Unterwäsche und eine Uhr von Swatch: Stellas Sachen.
»Dann kommt Stella also nie wieder?«, fragte ich zaghaft, obwohl ich die Antwort wusste.
»Nein, Annie, deine Schwester kommt nicht mehr zurück.« Sie legte mir die Hand auf die Schulter. »Du musst jetzt stark sein. Deiner Mutter geht’s überhaupt nicht gut. Sie gehört ins Krankenhaus, aber sie will nicht. Sie ist nicht in der Lage, dir eine Mutter zu sein momentan, und ich weiß nicht, wie lange das so geht, psychologische Betreuung hin oder her. Und Papa kennst du ja.«
Verena hat sich mit Opa Klaus nie besonders gut verstanden. Sie war der Meinung, dass er sich zu wenig um die Erziehung seiner Enkeltöchter, beziehungsweise früher seiner Töchter, kümmerte, und alles den Frauen überließ.
»Bleibst du bei uns in Philippsburg?«, fragte ich.
»Noch ein, zwei Wochen, länger ist es mir nicht möglich. Ich habe ein Geschäft, um das ich mich kümmern muss.«
»Wir schaffen das nicht ohne dich.«
»Natürlich schafft ihr das«, sagte Verena, aber sie klang wenig überzeugt.
*
Nach einer nicht enden wollenden, schlaflosen Nacht beobachtete ich am nächsten Morgen durch das Fenster am Fuß der Treppe im Flur eine Frau, die aus einem dunkelblauen Wagen stieg. Ich saß auf einer Stufe, wo ich die Beine gegen die Wand und den Rücken gegen das Treppengeländer drückte. So waren Stella und ich manchmal dagesessen, jede auf einer eigenen Stufe, hatten aus dem Fenster geschaut und gekichert, über die Schule geschimpft und über Bekannte gesprochen.
Die Frau visierte unser Haus an. Sie war mittelgroß und trug einen schicken blonden Kurzhaarschnitt. Sie kam mir vage bekannt vor. Energisch strich sie sich den Pony aus der Stirn und marschierte durch den Garten auf die Villa Grün zu, wobei ich sie aus dem Blickfeld verlor. Es klingelte.
Pebbles lief winselnd zur Tür und kratzte daran. Stufe für Stufe rutschte ich die Treppe hoch, wo sie mich nicht sehen konnte, falls sie einen Blick durchs Fenster warf.
Jemand hatte vergessen, den Türschnapper zu sperren. Die Tür wurde aufgedrückt. Die Frau kraulte Pebbles am Hals. Pebbles wandte sich von ihr ab und trottete mit hängendem Kopf davon. Die Hündin hatte jemand anderes erwartet. Vielleicht hatte sie gehofft, dass Stella zurückkäme.
»Ist jemand zu Hause?«, rief die Blonde.
Schritte polterten heran: Opa Klaus. »Wir haben gerade meine Tochter ins Bett gebracht. Sie schläft sehr viel.«
Keiner von ihnen schaute zu mir hoch. Sie schüttelten einander die Hand und verschwanden in der Küche. Opa Klaus zog die Tür hinter sich zu, was ungewöhnlich war. Das konnte nur eines bedeuten: was besprochen wurde, war nicht für meine Ohren bestimmt. Ich wollte aber mitbekommen, worüber sie redeten. Blitzschnell und so leise wie möglich schlich ich auf Zehenspitzen die Treppe hinunter und legte mein Ohr an die Tür, um zu lauschen. Ich hörte Opa Klaus hantieren, danach ertönte das Rauschen der Kaffeemaschine.
»Gibt es etwas Neues?«, fragte er.
»Wie geht es Frau Friedrich?«, fragte die Frau zurück.
»Es geht ihr sehr schlecht«, antwortete Opa Klaus. »Der Hausarzt meint, sie hätte eine schwere Depression. Er hat Kontakt zu einem Therapeuten in Bruchsal aufgenommen. Morgen hat sie den ersten Termin bei ihm.«
»Dann lassen wir sie besser schlafen«, sagte die Frau. »Ihre andere Tochter, ich meine Verena Friedrich, hat mich angerufen, weil sie glaubt, dass Annie jetzt vernehmungsfähig wäre?«
Pebbles strich um meine Beine und winselte leise. Ich kraulte die Hündin hinter den Ohren, sagte »Pssst« und kitzelte sie am Bauch, aber sie blieb unruhig. Vermutlich musste sie raus. Ich fürchtete, Opa Klaus und die Besucherin könnten die Tür klappen hören, wenn ich Pebbles in den Garten ließ; außerdem hatten wir sie trainiert, dort nicht ihr Geschäft hinzumachen. Ich bedeutete Pebbles mit der Hand, zu warten, aber die Ärmste verstand meine Geste natürlich nicht. Ihr Schwanz klopfte beim Wedeln auf den Boden, und sie versuchte mir das Gesicht abzulecken. Unwirsch schob ich sie weg.
»Ich weiß nicht … Annie ist erst seit gestern wieder sie selbst.«
»Na gut, aber es gilt einen Mordfall aufzuklären, in dem sie eine wichtige Zeugenaussage zu machen hat.«
»Wenn es nach mir ginge – ich hätte Sie noch nicht angerufen. Verena hat das über meinen Kopf hinweg entschieden.«
Eine Weile Schweigen. Dann sprach die Frau erneut. »Uns liegt mittlerweile die DNA-Analyse vor. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass es sich bei der Verstorbenen zweifelsfrei um Ihre Enkeltochter Stella Friedrich handelt.«
Es war einen Moment still. Die Tränen schossen wie kleine Wasserfälle aus meinen Augen.
Nach einer Weile sprach Opa Klaus wieder. Seine Stimme klang brüchig. »Anfangs hatten wir uns an die unsinnige Hoffnung geklammert, das Skelett müsste von einer anderen Person stammen. Schließlich kann ein Mensch nicht innerhalb weniger Stunden sein ganzes Fleisch, seine Muskeln und Sehnen verlieren. Aber als der Zahnarzt ihr Gebiss identifiziert hat, habe ich alle Zuversicht verloren. Jetzt haben wir Gewissheit.«
»Auch der Obduktionsbericht liegt uns vor.«
»Obduktionsbericht? Was kann man an Knochen schon feststellen?«, fragte Opa Klaus.
»Herr Friedrich, wir haben Spuren an den Knochen gefunden. Spuren von Zähnen. Bissspuren …«
»Dann haben die Ratten ihr Fleisch abgenagt«, sagte Opa leise. »Es wimmelt von Ratten auf der Insel.«
Ich drückte das Ohr fester gegen die Tür. Pebbles‘ drängendes Winseln machte es nicht einfacher, etwas zu verstehen.
»Das ist es nicht«, sagte die Frau. »Unsere Experten sind der Meinung, dass die Spuren von menschlichen Zähnen stammen.«
Ich presste beide Hände auf den Mund, um nicht zu schreien. Pebbles jaulte auf, meine jähe Bewegung musste sie erschreckt haben.
»Verstehe«, murmelte Opa Klaus. »Verstehe.«
»Verstehe?«, fragte die Frau verunsichert. »Herr Friedrich … bitte setzen Sie sich wieder. Geht es Ihnen gut? Wir ermitteln natürlich intensiv in diese Richtung. Die Anzeichen sprechen für einen Ritualmord. Wir werden herausfinden, wer das getan hat, das verspreche ich Ihnen. Der Leichnam Ihrer Enkelin wurde übrigens zur Beerdigung freigegeben.«
Einen Moment Stille. Die Tür wurde aufgerissen. Ich zuckte erschrocken zusammen. Opa Klaus erschrak noch mehr, als er mich auf dem Boden kauern sah.
»Annie, was machst du denn da?« Er schien geschockt. Die Frau sprang auf und kam auf mich zu.
»Ich wollte Bescheid sagen, dass ich mit Pebbles rausgehe …«, stammelte ich. »Irgendwie bin ich gestolpert …«
Opa Klaus wirkte besorgt. Die Frau ließ mich nicht aus den Augen. In diesem Moment kam Verena aus Mamas Schlafzimmer. Sie hatte knallroten Lippenstift aufgetragen und verbreitete einen blumigen Parfümduft.
»Warum haben Sie nicht auf mich gewartet? Ich wollte zuhören.«
Ich hatte den Eindruck, dass der Polizistin diese Unterbrechung nicht recht behagte. Sie ignorierte Verena und hatte nur Augen für mich.
»Mein Name ist Petra Höllinger«, sagte sie zu mir. »Wir haben uns vor wenigen Tagen bereits kennengelernt, aber da ging es dir sehr schlecht. Erinnerst du dich an mich?«
»Ich weiß nicht … ich glaube nicht.«
»Wie geht es dir heute, Annegret?«
»Bitte, nennen Sie mich Annie«, sagte ich. »Ich hasse meinen richtigen Namen.« Die Antwort kam automatisch über meine Lippen. In meinem Kopf blitzten Zähne auf. Zähne, die an Stellas Knochen nagten.
»Natürlich, Annie. Ich möchte mich gerne mit dir unterhalten. Wäre dir das recht?«
»Von mir aus.«
»Ich bleibe dabei«, sagte Verena.
»Musst du nicht«, sagte ich. »Ich schaff das schon.«
Opa Klaus sagte leise etwas zu Verena. Nach einigem Hin und Her entschieden sich die beiden, mich mit Frau Höllinger alleine zu lassen. Sie wollten mit Pebbles spazieren gehen. Ich wusste, was Opa Klaus Verena erzählen würde. Er würde von Zähnen erzählen.
Ich setzte mich Frau Höllinger gegenüber auf einen Küchenstuhl. Die Füße zog ich an und legte das Kinn auf die Knie.
»Möchtest du etwas trinken?«, fragte Frau Höllinger.
»Orangensaft.«