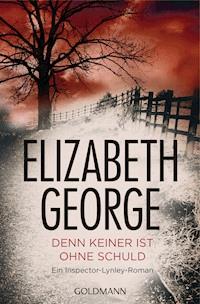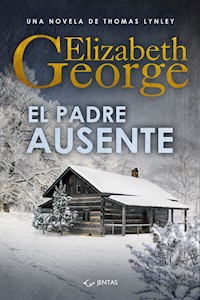9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Inspector-Lynley-Roman
- Sprache: Deutsch
Eine Verlobungsfeier, die zum Alptraum wird.
Was als fröhliches Verlobungswochenende von Lynley mit der Fotografin Deborah im Freundes- und Familienkreis auf Howenstow, dem feudalen Stammsitz der Ashertons, geplant war, entpuppt sich nach und nach als Alptraum. Im nahe gelegenen Dorf wird ein junger Journalist bestialisch ermordet - und alle Spuren führen nach Howenstow, zum gräflichen Verwalter zu Lynleys Gästen, ja sogar zu seinem eigenen Bruder. Auf der Suche nach dem Täter verfangen sich Lynley und St. James mit jedem Schritt mehr in einem schmerzhaften Netz aus lange unterdrückten Feindseligkeiten, nicht eingestandenen Schuldgefühlen und scheinheiliger Moral.
Das Prequel zur Inspector-Lynley-Reihe
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 653
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Buch
Was als fröhliches Verlobungswochenende von Thomas Lynley mit der Fotografin Deborah im Freundes- und Familienkreis auf Howenstow, dem feudalen Stammsitz der Ashertons, geplant war, entpuppt sich nach und nach als Alptraum. Im nahegelegenen Dorf wird ein junger Journalist bestialisch ermordet – und alle Spuren führen nach Howenstow: zum gräflichen Verwalter, zu Lynleys Gästen, ja sogar zu seinem eigenen Bruder. Auf der Suche nach dem Täter verfangen sich Lynley und St. James mit jedem Schritt mehr in einem fatalen Netz aus lange unterdrückten Feindseligkeiten, nicht eingestandenen Schuldgefühlen und scheinheiliger Moral. Als zwei weitere Menschen sterben müssen, werden die Beteiligten unwillentlich Zeugen eines grausamen Falls von Selbstjustiz. Für jeden entwickeln sich die Ereignisse zum Prüfstein sowohl der eigenen Selbstwahrnehmung als auch ihrer familiären und gesellschaftlichen Bindungen. Täter und Opfer sind sie alle, die vornehmen Damen und Herren ebenso wie die Menschen, die ihnen seit Generationen dienen …
Die Inspector-Lynley-Romane in chronologischer Reihenfolge:
Mein ist die Rache • Gott schütze dieses Haus • Keiner werfe den ersten Stein • Auf Ehre und Gewissen • Denn bitter ist der Tod • Denn keiner ist ohne Schuld • Asche zu Asche • Im Angesicht des Feindes • Denn sie betrügt man nicht • Undank ist der Väter Lohn • Nie sollst du vergessen • Wer die Wahrheit sucht • Wo kein Zeuge ist • Am Ende war die Tat • Doch die Sünde ist scharlachrot • Wer dem Tode geweiht • Glaube der Lüge • Nur eine böse Tat • Bedenke, was du tust • Wer Strafe verdient • Was im Verborgenen ruht
Elizabeth George
Mein ist die Rache
Ein Inspector-Lynley-Roman
Deutsch von Mechtild Sandberg-Ciletti
Die Originalausgabe erschien 1991 unter dem Titel »A Suitable Vengeance« bei Bantam Books, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © der Originalausgabe 1991 by Susan Elizabeth George
Published by arrangement with Bantam Books, a division of Bantam Doubleday
Dell Publishing Group, Inc., New York
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 1992
by Blanvalet Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Covergestaltung: UNO Werbeagentur, München
Covermotiv: Trevillion / © Paul Knight
Gestaltung der Umschlaginnenseiten: UNO Werbeagentur, München
Motiv der Umschlaginnenseiten: Trevillion / © Paul Knight
Th · Herstellung: AS
Satz- und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-12026-9V006
www.goldmann-verlag.de
Für meinen Ehemann Ira Toibin voll Dankbarkeit für zwanzig Jahre Geduld, Unterstützung und Anhänglichkeit
Ein Liebender muss schlucken manche bitt’re Pill’, Aber am schlimmsten ist’s, wenn er vergessen will! Wie soll ich von der Sünde lassen, Und doch bewahren das Gefühl? Wie kann ich denn den Frevel hassen, Und zugleich lieben meine Frevlerin? Wo zieh’ ich die Grenze zwischen ihr und uns’rer Missetat? Lieb’ ich sie noch?
NÄCHTE IN SOHO
Prolog
Tina Cogin verstand es, aus dem wenigen, das sie hatte, das Beste zu machen. Dieses Talent war ihr angeboren.
Mehrere Stockwerke über dem dumpfen Dröhnen des nächtlichen Verkehrs bewegte sich ihre nackte Silhouette faunisch über die Wände des halbdunklen Zimmers, und sie beobachtete lächelnd, wie jede ihrer Bewegungen den Schattenriss veränderte, so dass immer neue Formen von Schwarz und Weiß entstanden, wie bei einem Rorschach-Test. Und was für ein Test, dachte sie, während sie eine Geste lockender Verheißung mimte. Was für ein Anblick für irgendeinen Psycho!
Erheitert über ihre Begabung zur Selbstironisierung, trat sie zur Kommode und musterte verliebt ihren Bestand an Dessous. Um den Genuss zu verlängern, zögerte sie wie unschlüssig, ehe sie ein auffallendes Ensemble aus schwarzer Seide und Spitzen herausnahm. Büstenhalter und Höschen, ein französisches Modell, raffiniert geschnitten und unauffällig ausgepolstert. Sie legte beides an. Ihre Finger erschienen ihr ungeschickt, den Umgang mit so zarten Wäschestücken zu wenig gewöhnt.
Sie begann leise zu summen, ohne erkennbare Melodie: Ausdruck ihrer Vorfreude auf den Abend, auf drei Tage und Nächte uneingeschränkter Freiheit und das erregende Abenteuer, die Straßen Londons unsicher zu machen, ohne genau zu wissen, was diese milden Sommernächte bringen würden. Sie schob einen langen lackierten Fingernagel unter den Klebeverschluss einer Strumpfpackung, aber als sie die Strümpfe herausschüttelte, blieben sie an ihrer Hand hängen, deren Haut rauer war, als sie sich gern eingestand. Das Material zog Fäden. Sie fluchte einmal kurz, löste den Strumpf von ihrer Haut und untersuchte den Schaden, ein kleines Loch, aus dem eine Laufmasche werden konnte, hoch oben am Innenschenkel. Sie musste noch vorsichtiger sein.
Den Blick auf ihre Beine gesenkt, zog sie die Strümpfe hoch und seufzte voll Behagen. Das Material glitt so leicht über ihre Haut. Sie liebte dieses Gefühl – wie die Zärtlichkeiten eines Liebhabers – und strich genüsslich mit den Händen von den Fesseln über die Waden und Oberschenkel bis zu den Hüften hinauf. Straff, dachte sie, schön. Und hielt inne, um ihren Körper im Spiegel zu bewundern, ehe sie einen schwarzen Seidenunterrock aus der Kommode zog.
Das Kleid, das sie aus dem Schrank nahm, war schwarz, mit hohem Kragen und langen Ärmeln. Sie hatte es einzig gekauft, weil es sich wie flüssige Nacht um ihren Körper schmiegte. In der Taille war es mit einem Gürtel zusammengenommen, auf dem Oberteil glitzerte jettschwarze Perlenstickerei. Sie hatte es in Knightsbridge gekauft und hatte so viel Geld dafür hingelegt – ganz abgesehen von all ihren anderen Ausgaben –, dass sie sich nun für den Rest des Sommers den Luxus, mit dem Taxi zu fahren, nicht mehr leisten konnte. Aber eigentlich machte das nichts. Tina wusste, dass es Dinge gab, die sich letzten Endes immer bezahlt machten.
Sie schob die Füße in die schwarzen hochhackigen Pumps, dann erst schaltete sie endlich die Lampe neben der Bettcouch ein. Ins Licht sprang ein einfaches Ein-Zimmer-Apartment, das den unbezahlbaren Luxus eines eigenen Badezimmers bot. Bei ihrem ersten Besuch in London damals – frisch verheiratet und auf der Suche nach einem Rückzugsort – hatte sie den Fehler begangen, ein Zimmer in der Edgware Road zu nehmen, wo sie sich das Bad mit einer ganzen Etage grinsender Griechen hatte teilen müssen, die sämtlich an jeder kleinsten Verrichtung ihrer täglichen Toilette begierig Anteil genommen hatten. Nach dieser Erfahrung hätte nichts sie mehr dazu bewegen können, das Badezimmer mit einer anderen Person zu teilen, auch wenn die zusätzlichen Kosten für ein eigenes Bad zunächst eine beträchtliche Zusatzbelastung bildeten.
Sie prüfte noch einmal kritisch ihr Make-up und fand alles in Ordnung: die Augen so geschminkt, dass ihre Farbe betont und ihre Form korrigiert wurde, die Brauen zum Bogen gebürstet und nachgezogen; die Wangenknochen kunstvoll mit Rouge bestäubt, um die Linien des kantigen Gesichts weicher zu machen; die Lippen mit Stift und Pinsel konturiert, um ihnen die Schwellung sinnlicher Verlockung zu geben. Sie schüttelte ihr Haar aus, das so schwarz war wie ihr Kleid, und bauschte ein wenig die feinen Fransen, die ihr in die Stirn fielen. Sie lächelte. Nicht übel. Nein, weiß Gott, nicht übel.
Mit einem letzten Blick durch das Zimmer nahm sie die schwarze Handtasche, die sie auf das Bett geworfen hatte, und vergewisserte sich, dass sie nur Geld, ihre Schlüssel, den Zettel mit dem Namen des Nachtlokals und zwei kleine Plastikbeutel mit dem Stoff darin hatte. Dann ging sie.
Eine kurze Fahrt mit dem Aufzug, dann trat sie aus dem Haus in die Großstadtnacht, erfüllt von Maschinen- und Menschengerüchen. Wie immer warf sie, ehe sie in Richtung Praed Street losging, einen beifälligen Blick auf die graue Steinfassade des Hauses und die Worte Shrewsbury Court Apartments über der doppelflügeligen Tür, Tor zu ihrem Versteck und ihrer Zuflucht, dem einzigen Ort, an dem sie sie selbst sein konnte.
Sie wandte sich ab und ging den Lichtern des Paddington-Bahnhofs entgegen, um von dort mit der District Line bis Notting Hill Gate zu fahren und dann mit der Central Line weiter zur Tottenham Court Road, die Freitagabend im betäubenden Dunst der Abgase und an den schiebenden Menschenmengen zu ersticken drohte.
Rasch ging sie zum Soho Square. Hier drängten sich die Kunden der Peep-Shows, eine wogende Masse lüsterner Sensationsjäger, die mit grölenden Stimmen in allen denkbaren Akzenten und Dialekten obszöne Bemerkungen über die aufreizenden Darbietungen von Bein, Busen und mehr tauschten. An einem anderen Abend hätte Tina vielleicht einen oder mehrere von ihnen als Kandidaten für eine amüsante Begegnung in Betracht gezogen. Aber nicht heute. Heute Abend war alles vorgegeben.
In der Bateman Street sah sie über einem unappetitlich riechenden italienischen Restaurant das Schild hängen, nach dem sie Ausschau gehalten hatte. Kat’s Kradle stand darauf, und ein Pfeil wies in eine unbeleuchtete kleine Gasse gleich um die Ecke. Sie ging zur Tür und stieg die kurze Treppe hinunter, die so schmutzig war wie die Gasse, und wo es nach Alkohol, Erbrochenem und defekter Kanalisation roch.
Für ein Nachtlokal war es noch früh. Im Kat’s Kradle war nicht viel los, nur ein paar Gäste saßen an den Tischen rund um die Tanzfläche von der Größe einer Briefmarke. Die kleine Band, Saxophon, Klavier und Schlagzeug, stimmte ein melancholisches Jazzstück an, während die Sängerin an einen Hocker gelehnt rauchte und mit gelangweilter Miene auf ihren Einsatz wartete.
Es war sehr düster in dem Raum, der nur von einem schwachen bläulichen, auf die Band gerichteten Scheinwerfer, Kerzen auf den Tischen und einem Licht über der Bar erleuchtet war. Tina schob sich auf einen Hocker vor dem Tresen, bestellte einen Gin Tonic und stellte fest, dass dieses Bumslokal, so verwahrlost es war, ein echt idealer Treffpunkt war, das Beste, was Soho für ein heimliches Rendezvous zu bieten hatte.
Das Glas in der Hand, musterte sie ihre Umgebung: schattenhafte Gestalten, Zigarettenqualm, gelegentliches Aufblitzen eines Schmuckstücks oder der Flamme eines Feuerzeugs. Stimmengewirr, Gelächter, Geldgeklimper, Paare, die sich auf der Tanzfläche bewegten. Aber dann sah sie ihn, einen jungen Mann, der allein an einem Tisch in der hintersten Ecke saß. Sie lächelte.
Typisch Peter, so einen Schuppen zu wählen, wo er sicher sein konnte, dass ihm niemand von der Familie oder seinen feudalen Freunden über den Weg lief. Im Kat’s Kradle brauchte er nicht zu fürchten, missverstanden zu werden.
Tina beobachtete ihn. Vorfreude flatterte in ihrem Magen, während sie auf den Moment wartete, da er sie hinter Rauchschwaden und tanzenden Körpern entdecken würde. Aber er hatte überhaupt kein Auge für sie, sondern starrte unverwandt zur Tür, hob nur ab und zu die Hand und griff sich nervös in das kurzgeschnittene blonde Haar. Minutenlang beobachtete Tina ihn mit Interesse, während er schnell hintereinander zwei Drinks bestellte und sie hinunterkippte. Sie sah, wie sein Mund mit jedem Blick auf die Uhr, mit der wachsenden Qual des Verlangens immer schmäler wurde. Er war, soweit sie es erkennen konnte, ziemlich schäbig angezogen für den Bruder eines Earl: eine abgetragene Lederjacke, Jeans und ein T-Shirt mit dem verwaschenen Aufdruck Hard Rock Café. Von einem Ohr hing ihm ein goldener Ohrring herunter, den er von Zeit zu Zeit berührte wie einen Talisman. Unablässig kaute er an den Fingern seiner linken Hand, und mit der Rechten, die zur Faust geballt war, schlug er sich ab und zu beinahe krampfhaft auf die Hüfte.
Als eine Gruppe lauter Deutscher in das Lokal kam, sprang er auf, fiel aber gleich wieder auf seinen Stuhl zurück, als sich zeigte, dass die Person, auf die er wartete, nicht dabei war. Er zog eine Packung Zigaretten aus der Jackentasche, schüttelte eine Zigarette heraus, griff in seine Taschen, brachte aber weder Feuerzeug noch Zündhölzer zum Vorschein. Einen Augenblick später schob er seinen Stuhl zurück, stand auf und kam zur Bar.
Direkt in Mamas Arme, dachte Tina und lächelte in sich hinein. Manche Dinge im Leben waren eben Bestimmung.
Als Justin Brooke am Soho Square den Triumph in eine Parklücke manövrierte, sah Sidney St. James deutlich, wie stark seine Anspannung war. Sein ganzer Körper war verkrampft. Die Hände umfassten das Steuer mit einem verräterischen Bemühen um Kontrolle, das jeden Moment zu versagen drohte. Er versuchte es vor ihr zu verbergen. Das Verlangen zuzugeben, wäre ein Schritt zum Eingeständnis der Abhängigkeit gewesen. Und er war nicht abhängig. Nicht er, Justin Brooke, Wissenschaftler, Lebemann, Empfänger von Auszeichnungen.
»Du hast das Licht angelassen«, sagte Sidney unbewegt. Er reagierte nicht. »Das Licht, Justin.«
Er schaltete es aus. Sidney merkte, ohne hinsehen zu müssen, wie er sich ihr zuwandte, und einen Augenblick später fühlte sie seine Finger an ihrer Wange. Sie wollte von ihm abrücken, als seine Hand ihren Hals hinunterglitt zu ihren kleinen Brüsten. Stattdessen spürte sie die erregende Antwort ihres Körpers, der sich unter seiner Berührung öffnete, als wäre er ein eigenständiges Wesen, über das sie keine Kontrolle hatte.
Ein leichtes Zittern seiner Hand verriet ihr, dass seine Zärtlichkeit vorgetäuscht war, nichts weiter als ein Versuch, sie zu beschwichtigen, ehe er seinen widerlichen kleinen Kauf tätigte. Sie stieß ihn weg.
»Sid.« Justin brachte ein respektables Maß sinnlicher Erregtheit zustande, aber Sidney wusste, dass Geist und Körper schon in der schlecht beleuchteten Gasse am Südende des Platzes waren. Ihm lag viel daran, es vor ihr zu verbergen. Und darum neigte er sich jetzt zu ihr, wie um zu demonstrieren, dass in diesem Moment nicht das Verlangen nach der Droge sein Leben beherrschte, sondern das Begehren nach ihr. Sie wappnete sich gegen seine Berührung.
Seine Lippen, seine Zunge glitten über ihren Hals und ihre Schultern. Seine Hand umschloss liebkosend ihre Brust. Er murmelte ihren Namen. Er drehte sie zu sich her. Und es war wie immer – Glut, Auflösung, brennende Preisgabe aller Vernunft. Sidney verlangte nach seinem Kuss. Ihre Lippen öffneten sich, ihn zu empfangen.
Stöhnend zog er sie näher an sich, streichelte sie, küsste sie. Sie schob die Hand seinen Schenkel hinauf, um die Liebkosung zu erwidern. Und da wusste sie Bescheid.
Sie stieß ihn weg und sah ihn im trüben Licht der Straßenbeleuchtung wütend an.
»Das ist wirklich toll, Justin. Dachtest du, ich würde es nicht merken?«
Er wandte sich ab. Ihr Zorn steigerte sich.
»Los, geh schon, kauf deinen verdammten Stoff. Deshalb sind wir doch hergekommen, stimmt’s? Oder wolltest du mir vielleicht weismachen, es hätte einen anderen Grund?«
»Du willst doch, dass ich auf diese Fete mitkomme, oder nicht?«, fragte Justin scharf.
Es war immer derselbe Versuch, Schuld und Verantwortung abzuwälzen, aber diesmal spielte Sidney nicht mit.
»Fang mir bloß nicht damit an. Ich kann auch allein hingehen.«
»Warum tust du’s dann nicht? Warum hast du mich dann angerufen, Sid? Oder warst das heute Nachmittag vielleicht nicht du am Telefon, honigsüß und ganz heiß auf einen Bums am Ende des Abends.«
Sie sagte nichts. Sie wusste, dass es stimmte. Immer wieder, ganz gleich, wie oft sie schwor, dass sie genug von ihm hatte, kehrte sie zu ihm zurück, hasste ihn, verachtete sich selbst und ging doch immer wieder zu ihm zurück. Es war, als besäße sie auch nicht eine Spur von Willenskraft, die nicht an ihn gebunden war.
Dabei – was hatte er schon zu bieten? Er war kein warmherziger Mensch. Er sah nicht gut aus. Er war verschlossen. Er war nichts von dem, was sie sich einmal erträumt hatte. Er war nicht mehr als ein interessantes Gesicht, in dem jeder einzelne Zug mit allen anderen im Streit um die Vorherrschaft zu liegen schien. Olivdunkle Haut. Schwerlidrige Augen. Eine schmale Narbe, die der Linie seines Unterkiefers folgte. Er war nichts, nichts … außer seine Art, sie anzusehen, sie zu berühren und ihren knabenhaften Körper zu entzünden, so dass sie sich schön und lebendig fühlte. Sie fühlte sich leer. Die Luft im Auto schien ihr erstickend heiß zu sein.
»Ich hab manchmal schon daran gedacht, alles zu verraten«, sagte sie leise. »Das ist angeblich das einzige Mittel der Heilung.«
»Was zur Hölle redest du da?« Sie sah, wie seine Hand sich ballte.
»Wenn Menschen, die dem Abhängigen wichtig sind, es erfahren. Seine Familie. Seine Arbeitgeber. Damit er erst mal total ins Leere fällt. Dann …«
Justin packte sie am Handgelenk und drehte ihr den Arm herum. »Daran brauchst du nicht mal zu denken. Das sag ich dir. Denn wenn du das tust, Sid, ich schwör’s dir – wenn du das tust …«
»Hör auf! So kann es doch nicht weitergehen. Was gibst du jetzt dafür aus? Fünfzig Pfund am Tag? Hundert? Oder mehr? Justin, wir können ja nicht mal mehr auf ein Fest gehen, ohne dass du …«
Abrupt ließ er ihren Arm los. »Dann steig aus. Such dir einen anderen. Lass mich in Frieden.«
Ja, das war die Antwort, die einzige Antwort. Aber Sidney wusste, dass sie das nicht schaffen würde, und dachte voll Selbstverachtung, dass sie es wahrscheinlich nie schaffen würde, sich von ihm zu lösen.
»Ich will dir doch nur helfen.«
»Dann halt die Klappe. Lass mich jetzt da rübergehen, das Zeug besorgen, und dann hauen wir ab.«
Er stieß die Tür auf und knallte sie hinter sich zu.
Sidney ließ ihn bis fast zur Mitte des Platzes gehen, ehe sie ebenfalls ausstieg. »Justin!«
»Bleib, wo du bist.« Seine Stimme klang ruhiger, aber nicht, weil er sich tatsächlich ruhiger fühlte, das wusste sie, sondern weil der Platz voller Menschen war und Justin Brooke nicht der Mensch war, der gern Aufsehen erregte.
Sie achtete nicht auf seine Worte, sondern lief ihm nach, obwohl sie wusste, dass sie genau das nicht tun sollte, ihm noch dabei helfen, sich die Drogen zu besorgen. Sie redete sich ein, wenn sie nicht da wäre, um aufzupassen, würde er vielleicht verhaftet oder betrogen werden oder es würde noch Schlimmeres passieren.
»Ich komme mit«, sagte sie, als sie ihn eingeholt hatte.
Die Starrheit seiner Züge verriet ihr, dass er einen Zustand erreicht hatte, in dem ihm alles egal war.
»Wie du willst.« Er steuerte auf die finstere Öffnung der Gasse zu.
Baugerüste machten die Gasse noch dunkler und enger, als sie sowieso schon war. Sidney verzog angewidert das Gesicht über den penetranten Uringeruch. Es war noch schlimmer, als sie erwartet hatte.
Unbeleuchtete Häuser ragten zu beiden Seiten düster in die Höhe. Die Fenster waren vergittert, und in den Türnischen drückten sich vermummte, stöhnende Gestalten herum, die jene Art verbotener Geschäfte machten, die die Nachtlokale dieser Gegend offensichtlich nur zu gern förderten.
»Justin, wohin willst du …«
Brooke hob abwehrend die Hand. Von vorn hörten sie jetzt die heiseren Flüche eines Mannes. Sie schallten vom Ende der Gasse herauf, wo neben einem Lokal eine Backsteinmauer etwas hervorsprang und eine geschützte Nische bildete. Zwei Gestalten wälzten sich dort auf dem Boden. Die unten liegende war eine schwarz gekleidete Frau, die ihrem wütenden Angreifer weder an Körpergröße noch an Kraft gewachsen zu sein schien.
»Du dreckige …« Der Mann – blond, wie es schien, und dem Klang seiner Stimme nach zu urteilen außer sich vor Wut – schlug mit den Fäusten auf sie ein.
Sidney rannte los. Als Brooke sie aufhalten wollte, rief sie: »Nein! Es ist eine Frau!« und rannte weiter zum anderen Ende der Gasse.
Sie hörte Justins keuchenden Atem hinter sich. Keine drei Meter vor dem kämpfenden Paar überholte er sie. »Bleib weg da! Lass mich das machen!«, sagte er grob.
Er packte den Mann bei den Schultern, grub seine Finger in die Lederjacke. Als er ihn in die Höhe riss, bekam die Frau unter ihm die Arme frei und hob sie instinktiv, um ihr Gesicht zu schützen. Brooke schleuderte den Mann nach rückwärts.
»Ihr seid wohl beide verrückt geworden! Wollt ihr die Polizei auf den Hals bekommen?«
Sidney drängte sich an ihm vorbei. »Peter!«, rief sie. »Peter Lynley!«
Brooke blickte von dem jungen Mann zu der Frau, die mit hochgeschobenem Kleid und zerfetzten Strümpfen seitlich auf dem Boden lag. Er kauerte nieder und umfasste ihr Gesicht, als wollte er sich ihre Verletzungen genauer ansehen.
»Mein Gott!«, murmelte er. Mit einem Ruck ließ er sie los, sprang auf und fing plötzlich an zu lachen.
Die Frau richtete sich auf die Knie auf. Sie packte ihre Handtasche und griff sich einmal kurz an den Hals.
Dann begann auch sie zu lachen.
NACHMITTAGE IN LONDON
1
Lady Helen Clyde war umgeben von Zeugnissen von Tod und Gewalt. Beweisstücke diverser Verbrechen lagen auf den Tischen; Fotografien von Leichen hingen an den Wänden; scheußliche Souvenirs waren in Glasvitrinen ausgestellt, darunter ein besonders schreckliches in Gestalt eines Haarbüschels, an dem noch ein Fetzen von der Kopfhaut des Opfers hing. Aber diesem makabren Ambiente zum Trotz schweiften Helens Gedanken immer wieder zu leiblichen Genüssen.
Um sich abzulenken, prüfte sie die Kopie eines Polizeiberichts, der vor ihr auf dem Arbeitstisch lag. »Es passt alles zusammen, Simon.« Sie schaltete das Mikroskop aus. »B negativ, AB positiv, 0 positiv. Da werden sich die Freunde von der Polizei bestimmt freuen.«
»Hm«, war das Einzige, was Simon Allcourt-St. James dazu zu sagen hatte.
Wenn er in seine Arbeit vertieft war, wurde er immer einsilbig, aber jetzt fand Helen ihn besonders abweisend. Es war nach vier, und sie verspürte seit mindestens einer Viertelstunde das dringende Bedürfnis nach einer Tasse Tee. Ohne Rücksicht darauf begann St. James mehrere Flaschen aufzuschrauben, die in einer Reihe vor ihm standen. Sie enthielten winzige Fasern, die er analysieren wollte, um aus diesen unendlich kleinen, blutgetränkten Fasern einen Teppich an Fakten zu weben.
Helen, die wusste, was bevorstand, seufzte nur. Durch das offene Fenster drang die Spätnachmittagssonne ins Labor. Helens Blick glitt auf den von einer Backsteinmauer umschlossenen alten Garten hinunter, in dem ungehindert wuchernde Blumen ein buntes Bild boten. Wege und Rasenflächen waren von Unkraut überwachsen und verwildert.
»Du solltest dir mal jemanden nehmen und den Garten herrichten lassen«, sagte Helen. Sie wusste sehr wohl, dass er in den letzten drei Jahren nicht mehr gepflegt worden war. Und sie wusste auch, warum.
»Ja.« St. James nahm eine Pinzette und einen Kasten mit Objektträgern. Irgendwo unten im Haus klappte eine Tür.
Endlich, dachte Helen und stellte sich vor, wie Joseph Cotter jetzt aus der Küche im Souterrain die Treppe heraufstieg, in den Händen ein Tablett mit frischen scones, buttrigen Sahneklümpchen, Erdbeertörtchen und Tee. Leider jedoch ließen die Geräusche, die folgten – ein Holpern und Poltern, begleitet von angestrengtem Grunzen –, nicht darauf hoffen, dass mit Tee zu rechnen war. Helen ging um einen von St. James’ Computern herum und warf einen Blick in den holzgetäfelten Flur.
»Was ist denn?«, fragte St. James, als donnerndes Krachen durch das Haus schallte, Metall auf Holz, ein Geräusch, das für das Treppengeländer nichts Gutes verhieß. Schwerfällig rutschte er von seinem Hocker. Sein geschientes linkes Bein landete mit dumpfem Aufprall auf dem Boden.
»Es ist Cotter. Er kämpft mit einem Riesenkoffer und irgendeinem Paket. – Soll ich Ihnen helfen, Cotter? Was schleppen Sie denn da herauf?«
»Es geht schon, Mylady«, antwortete Cotter von unten.
»Aber was um Himmels willen …?«
Helen merkte, wie St. James sich hastig abwandte. Er kehrte an seine Arbeit zurück, als hätte keine Störung stattgefunden und Cotter keine Hilfe nötig.
Gleich darauf bekam sie die Erklärung. Als Cotter seine Gepäckstücke über den ersten Treppenabsatz bugsierte, traf ein Lichtstrahl, der durch das Fenster fiel, ein großes Etikett, das auf den Schiffskoffer aufgeklebt war. Selbst vom obersten Stockwerk aus konnte Helen die dicken schwarzen Lettern entziffern: »D. Cotter/USA«. Deborah kam nach Hause, und bald schon, wie es aussah. Und da stand St. James, als wäre überhaupt nichts los, über seine Fasern und Objektträger geneigt!
Helen lief die Treppe hinunter. Cotter winkte ab.
»Ich komme schon zurecht«, versicherte er. »Machen Sie sich keine Mühe.«
»Ich mach’ mir die Mühe gern. So gern wie Sie.«
Cotter lächelte über ihre Antwort. Er machte sich die Mühe, weil die Tochter zurückkehrte, die er liebte. Er reichte Helen das breite, flache Paket, das er sich unter den Arm geklemmt hatte. Den Koffer ließ er nicht los.
»Deborah kommt nach Hause?«, fragte Helen leise.
Cotter antwortete im gleichen Ton: »Ja, heute Abend.«
»Simon hat mir kein Wort davon gesagt.«
Cotter fasste den schweren Schiffskoffer fester. »War wohl nicht anders zu erwarten«, meinte er kurz.
Gemeinsam stiegen sie die verbleibenden Treppen hinauf. Cotter hievte den Schiffskoffer ins Zimmer seiner Tochter auf der linken Seite des Flurs, während Helen an der Tür zum Labor stehenblieb. Sie lehnte das Paket an die Wand und trommelte leicht mit den Fingern darauf, den Blick auf den Freund gerichtet. St. James sah nicht von seiner Arbeit auf.
Das war immer seine wirksamste Abwehr gewesen. Arbeitstische und Mikroskope wurden zu Wehrmauern, die keiner erklimmen konnte, unermüdliche Arbeit zum Betäubungsmittel, das den Schmerz über den Verlust dämpfte. Helen betrachtete das Labor und sah es ausnahmsweise nicht als das Zentrum seines beruflichen Lebens, sondern als den Zufluchtsort, der es ihm geworden war: ein großer Raum, der leicht nach Formaldehyd roch; an den Wänden anatomische Atlanten, Diagramme und Regale; auf dem Boden alte, knarrende Holzdielen; in der Decke ein großes Oberlicht, durch das milchiges Sonnenlicht fiel, das dem Raum eine unpersönliche Atmosphäre gab. Die Einrichtung bestand aus Tischen und hohen Hockern, Mikroskopen, Computern und einer Vielfalt von Geräten. Links führte eine Tür in Deborah Cotters Dunkelkammer. Sie war während der Jahre ihrer Abwesenheit immer geschlossen geblieben. Helen überlegte, was St. James tun würde, wenn sie sie jetzt öffnete und so gewissermaßen das verbotene Tor zu den Tiefen seiner Seele aufrisse, in die er keinen einen Blick tun lassen wollte.
»Deborah kommt heute Abend nach Hause, Simon. Warum hast du mir das nicht gesagt?«
St. James nahm einen Objektträger aus dem Mikroskop und schob einen anderen hinein. Er stellte das Objektiv schärfer ein und machte sich nach längerer Betrachtung dieser neuen Probe einige kurze Notizen.
Helen beugte sich über den Arbeitstisch und knipste das Licht des Mikroskops aus. »Sie kommt nach Hause«, sagte sie leise. »Du hast den ganzen Tag kein Wort darüber verloren. Warum nicht, Simon? Sag es mir.«
Anstatt ihr zu antworten, sah St. James über ihre Schulter hinweg an ihr vorbei. »Was gibt es, Cotter?«
Helen drehte sich herum. Cotter stand mit gerunzelter Stirn an der offenen Tür und wischte sich das Gesicht mit einem weißen Taschentuch. »Sie brauchen Deb heute Abend nicht vom Flughafen abzuholen, Mr. St. James«, sagte er hastig. »Lord Asherton holt sie ab. Er nimmt mich mit. Er hat mich vor einer knappen Stunde angerufen.«
Einen Moment lang war nur das Ticken der Wanduhr zu hören, dann begann irgendwo draußen ein Kind laut und zornig zu weinen.
St. James erwachte aus seiner Reglosigkeit. »Gut«, sagte er. »Das trifft sich gut. Ich habe noch einen ganzen Berg Arbeit vor mir.«
Helen war bestürzt. Seine Worte schienen ihr alles, was sie für selbstverständlich gehalten hatte, auf unglückliche Weise auf den Kopf zu stellen. Die naheliegende Frage auf der Zunge, blickte sie von St. James zu Cotter. Aber die abwehrende Zurückhaltung der beiden Männer warnte sie davor, sie auszusprechen. Dennoch sah sie, dass Cotter bereit war, mehr zu sagen. Er schien auf irgendeinen Nachsatz von St. James zu warten. Doch St. James fuhr sich nur mit der Hand durch das widerspenstige schwarze Haar und schwieg. Cotter trat von einem Fuß auf den anderen.
»Dann geh ich jetzt wieder an die Arbeit.« Mit einem Nicken ging er aus dem Zimmer, aber seine Schultern krümmten sich wie unter einer Last, und sein Schritt war schwer.
»Hab’ ich das richtig verstanden«, sagte Helen. »Tommy holt Deborah vom Flughafen ab. Tommy, nicht du?«
Es war eine durchaus verständliche Frage. Thomas Lynley, Lord Asherton, war nicht nur ein alter Freund von St. James, sondern auch von Helen, und in seiner Eigenschaft als Kriminalbeamter, der seit zehn Jahren bei New Scotland Yard tätig war, auch ein Berufskollege. Als Freund wie als Kollege war er häufiger Gast in St. James’ Haus in der Cheyne Row. Aber seit wann, fragte sich Helen, kannte er Deborah Cotter so gut, dass er und nicht St. James sie nach drei Jahren Ausbildung in Amerika vom Flughafen abholte? Dass er ganz selbstverständlich ihren Vater anrief und ihn vor vollendete Tatsachen stellte, als wäre er – in was für einer Beziehung stand Tommy eigentlich zu Deborah?
»Er hat sie in Amerika besucht«, antwortete St. James. »Mehrmals. Hat er dir das nie erzählt, Helen?«
»Was?« Helen war perplex. »Woher weißt du das denn? Doch bestimmt nicht von Deborah. Und Tommy weiß doch, dass du immer …«
»Cotter hat es mir letztes Jahr erzählt«, unterbrach St. James. »Ich vermute, er machte sich Gedanken über Tommys Absichten, wie das wohl jeder Vater tun würde.«
Sein trockener, distanzierter Ton sprach Bände. Sie empfand tiefes Mitleid mit ihm.
»Die drei Jahre ohne sie waren schlimm für dich, nicht wahr?«
St. James zog ein anderes Mikroskop über den Tisch und konzentrierte seine Aufmerksamkeit auf die Entfernung eines Staubkorns, das besonders hartnäckig auf dem Objektiv zu haften schien.
Helen, die ihn schweigend beobachtete, sah, wie die Zeit und seine unselige Invalidität nach Kräften zusammenwirkten, um von Jahr zu Jahr das Bild, das er von sich als Mann hatte, immer mehr ins Verächtliche zu verzerren. Sie wollte ihm sagen, wie unrichtig und ungerecht eine solche Einschätzung war. Wie sehr er sich selbst unrecht tat. Aber das wäre Bemitleidung zu nahe gekommen, und niemals hätte sie ihn durch eine Äußerung von Mitgefühl verletzt, da er es nicht wollte.
Das Geräusch der zufallenden Haustür ersparte es ihr, überhaupt etwas sagen zu müssen. Auf der Treppe waren eilige Schritte zu hören, so schnell und leicht, dass sie nur die eine Person ankündigen konnten, die genug Schwung besaß, die steilen Stufen wie im Flug zu bewältigen.
»Ich wusste doch, dass ich dich hier finden würde.« Sidney St. James drückte ihrem Bruder einen Kuss auf die Wange, ließ sich auf einen Hocker fallen und sagte statt einer Begrüßung zu Helen: »Das ist ja ein tolles Kleid, Helen. Ist es neu? Wie schaffst du es nur, nachmittags um Viertel nach vier so todschick auszusehen?«
»Ganz im Gegensatz zu dir.« St. James musterte demonstrativ den ungewohnten Aufzug seiner Schwester.
Sidney lachte. »Lederhosen. Wie findest du sie? Ein Pelz gehörte auch noch dazu, aber den hab’ ich dem Fotografen hinterlassen.«
»Ein etwas schweres Outfit für den Sommer«, bemerkte Helen.
»Ja, grässlich nicht?«, stimmte Sidney vergnügt zu. »Seit heute Morgen um zehn lassen sie mich in Lederhosen und Pelzmantel und sonst nichts auf der Albert Bridge rumturnen. In verführerischer Pose auf dem Dach eines museumsreifen Taxis, während der Fahrer – ehrlich, ich möchte wissen, wo sie diese Dressmen immer herbekommen – mich beäugt wie ein lüsterner Spanner. Ach ja, und hier und dort natürlich ein Hauch nacktes Fleisch. Mein nacktes Fleisch. Der Fahrer dagegen braucht nur ein Gesicht zu machen wie Jack the Ripper. Ich hab’ mir das Hemd hier von einem der Techniker ausgeborgt. Wir machen jetzt Pause, da habe ich gedacht, ich komm mal auf einen Sprung vorbei.« Neugierig sah sie sich um. »Und? Es ist vier vorbei. Wo bleibt der Tee?«
St. James wies mit dem Kopf auf das Paket, das Helen an die Wand gelehnt stehengelassen hatte. »Wir sind heute Nachmittag ein bisschen aus dem Trott.«
»Deborah kommt heute Abend nach Hause, Sid«, sagte Helen. »Hast du es gewusst?«
Sidneys Gesicht leuchtete auf. »Wirklich? Na endlich! Dann sind das sicher ihre Aufnahmen. Wunderbar! Komm, linsen wir mal rein.« Sie sprang vom Hocker, schüttelte das Paket, als wäre es ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk, und machte sich dann kurzerhand ans Auspacken.
»Sidney!«, mahnte St. James.
»Was denn? Du weißt genau, dass es ihr nichts ausmachen würde.« Sidney warf das braune Packpapier weg, löste die Schnur, die die schwarze Mappe zusammenhielt, und griff nach dem ersten Bild auf dem Stapel, der darin lag. Nach eingehender Betrachtung pfiff sie beifällig durch die Zähne. »Mann, das Mädchen kann wirklich mit der Kamera umgehen.«
»Das Bad«, stand flüchtig hingeworfen auf dem unteren Rand des Bildes. Es war eine Aktstudie von Deborah im Halbprofil zur Kamera. Sie hatte die Komposition mit bewundernswertem Blick zusammengestellt: eine niedrige Wanne mit Wasser; der zarte Bogen ihres Rückens; in der Nähe ein Tisch, auf dem neben Kamm und Haarbürste ein Krug stand; diffuses Licht spielte auf ihrem linken Arm, dem linken Fuß, der Rundung der Schulter. Es war eine Kopie von Degas’ Bild »The Tub«.
Helen blickte auf und sah St. James wie beifällig nicken. Er ging zu seinem Arbeitstisch zurück und begann, in einem Haufen von Berichten zu blättern.
»Habt ihr’s gewusst?«, fragte Sidney ungeduldig.
»Was denn?«, entgegnete Helen.
»Dass Deborah mit Tommy zusammen ist. Tommy Lynley. Mamas Köchin hat’s mir erzählt, ob ihr’s glaubt oder nicht. Und wenn’s stimmt, was sie gesagt hat, dann ist Cotter ziemlich in Harnisch darüber. Ehrlich, Simon, du musst ihm mal Vernunft beibringen. Und Tommy genauso. Ich finde es absolut unfair von ihm, dass er Deb mir vorzieht.« Sie kletterte wieder auf den Hocker und brachte ihn mit leichtem Anstoß zum Kreiseln. »Ach, dabei fällt mir ein. Ich muss euch unbedingt von Peter erzählen.«
Helen war erleichtert über den Themenwechsel. »Von Peter?«, hakte sie sogleich nach.
»Stellt euch das vor.« Sidney gestikulierte mit beiden Händen, um ihrem Bericht dramatischen Effekt zu geben. »Peter Lynley und eine Schöne der Nacht – ganz in Schwarz, mit wallender schwarzer Mähne wie eine Abgesandte aus Transsylvanien – in einer finsteren Hintergasse in Soho. Wir haben ihn in flagranti ertappt.«
»Tommys Bruder Peter?«, fragte Helen, die Sidneys Neigung kannte, wesentliche Details zu übersehen. »Das kann nicht sein. Er ist doch in Oxford.«
»Offensichtlich gibt es Dinge, die ihn weit mehr interessierten als sein Studium. Zum Teufel mit Geschichte und Literatur.«
»Was redest du da, Sidney?« St. James ließ sich von seinem Hocker herunter und begann, im Labor hin und her zu gehen.
Sidney schaltete Helens Mikroskop ein und riskierte einen Blick durch das Objektiv. »Puh! Was ist denn das?«
»Blut«, antwortete Helen. »Also, wie war das nun mit Peter Lynley?«
Sidney stellte die Schärfe ein. »Das war – warte mal. Freitagabend. Ja, stimmt. Ich musste Freitagabend zu so einer piekfeinen kleinen Cocktailparty im West End, und an dem Abend hab’ ich Peter gesehen. Im Nahkampf mit einer Nutte. Sie wälzten sich beide auf der Erde. Wenn das Tommy gesehen hätte!«
»Tommy ist schon das ganze Jahr nicht sehr glücklich über Peter«, sagte Helen.
»Als wüsste Peter das nicht!« Sidney warf ihrem Bruder einen flehenden Blick zu. »Was ist denn nun mit dem Tee? Darf man noch hoffen?«
»Immer. Erzähl weiter.«
Sidney schnitt ein Gesicht. »Viel mehr gibt’s nicht zu erzählen. Justin und ich sahen plötzlich Peter, der sich im Dunkeln mit dieser Frau prügelte. Sogar ins Gesicht hat er sie geschlagen. Justin zog ihn weg, und die Frau fing plötzlich an, wie eine Irre zu lachen. Ganz merkwürdig, sag ich euch. Wahrscheinlich war sie hysterisch. Aber ehe wir uns um sie kümmern konnten, rannte sie weg. Wir haben Peter dann heimgefahren. Er hat eine miese kleine Bude in Whitechapel, Simon, und vor der Tür wartete ein Mädchen mit gelben Augen und dreckigen Jeans auf ihn.« Sidney schüttelte sich. »Wie dem auch sei, mit mir hat Peter kein Wort über Tommy oder Oxford oder sonst was gesprochen. Wahrscheinlich war ihm das alles ziemlich peinlich. Er hat bestimmt nicht damit gerechnet, dass ausgerechnet Freunde ihn erwischen würden.«
»Und was hattest du dort zu suchen?«, fragte St. James. »Oder war Soho Justins Idee? Was ist mit Brooke, Sid?«
Sidney richtete eine wortlose Entschuldigung an Helen, ehe sie ihrem Bruder trotzig in die Augen sah. Die Ähnlichkeit der beiden war auffallend – dasselbe lockige schwarze Haar, dieselben schmalen, scharfen Gesichtszüge, dieselben blauen Augen. Sie wirkten wie die beiden Seiten ein und derselben Medaille: Sprühende Lebhaftigkeit auf der einen, resignierte Ruhe auf der anderen Seite.
Sidney jedoch schien davon nichts wissen zu wollen. »Hör auf, mich zu bevormunden, Simon«, sagte sie.
Das Schlagen einer Uhr riss St. James aus dem Schlaf. Es war drei Uhr morgens. Einen Moment lang – zwischen Schlaf und Wachen gefangen – wusste er nicht, wo er war, bis der Schmerz eines verspannten Muskels, der sich in seinem Nacken zusammenkrampfte, ihn vollends wach machte. Er richtete sich in seinem Sessel auf und erhob sich, langsam und mühevoll in seinen Bewegungen. Vorsichtig streckte er sich und ging zum Fenster, das zur Cheyne Road hinuntersah.
Das Mondlicht lag silbern auf den Blättern der Bäume, fiel auf die renovierten Häuser gegenüber, auf das Carlyle-Museum, die Kirche an der Ecke. In den letzten Jahren war neues Leben in dieses Viertel am Fluss eingezogen und hatte es aus seiner Bohème-Vergangenheit erweckt. St. James liebte es.
Er kehrte zu seinem Sessel zurück. Auf dem Tisch neben ihm stand sein Glas, in dem noch ein Rest Brandy war. Er trank ihn aus, schaltete die Lampe aus und ging aus dem Arbeitszimmer durch den schmalen Flur zur Treppe.
Langsam stieg er sie hinauf. Bei jeder Stufe das kranke Bein nachziehend, die Hand fest am Geländer, um sich zu stützen, belächelte er müde das einsame, unrealistische Aufheben, das er um Deborahs Rückkehr gemacht hatte.
Cotter war seit Stunden vom Flughafen zurück gewesen, aber seine Tochter hatte nur ein kurzes Gastspiel gegeben und sich die ganze Zeit in der Küche aufgehalten. In seinem Arbeitszimmer konnte St. James Deborahs Lachen hören, die Stimme ihres Vaters, das Kläffen des Hundes. Er konnte sich vorstellen, wie die Katze vom Fensterbrett sprang, um sie zu begrüßen. Eine halbe Stunde hatte das Wiedersehen gedauert. Dann war nicht Deborah heraufgekommen, um ihn zu begrüßen, sondern Cotter, um ihm betreten mitzuteilen, dass Deborah noch einmal mit Lord Asherton weggefahren sei. Mit Thomas Lynley, St. James’ ältestem Freund.
Cotters Verlegenheit über Deborahs Verhalten drohte die ohnehin peinliche Situation nur noch zu verschlimmern.
»Sie sagte, sie wäre gleich wieder da«, hatte Cotter gestammelt. »Sie sagte …«
St. James wollte ihn zum Schweigen bringen, aber er wusste nicht wie. Schließlich bereitete er der Sache ein Ende, indem er auf die Zeit verwies und erklärte, er wolle zu Bett gehen. Cotter ließ ihn in Frieden.
Da er wusste, dass er bestimmt nicht schlafen könnte, blieb er jedoch im Arbeitszimmer und versuchte sich mit der Lektüre einer Fachzeitschrift abzulenken, während die Stunden vergingen und er auf ihre Rückkehr wartete. Seine Vernunft sagte ihm, dass ein Zusammentreffen jetzt sinnlos sei. Der Narr in ihm – in einem Aufruhr von Gefühlen – sehnte sich danach.
Wie kann man nur so albern sein, dachte er auf dem Weg nach oben. Aber als wollte sein Körper dem widersprechen, was der Intellekt ihm riet, ging er nicht zu seinem eigenen Zimmer, sondern zu dem Deborahs ganz oben im Haus. Die Tür stand offen.
Es war ein kleiner Raum, kunterbunt eingerichtet. Ein alter Eichenschrank, liebevoll restauriert, lehnte auf schiefen Beinen an der Wand. Auf dem Toilettentisch stand einsam eine rosarot geränderte Belleek-Vase. Ein früher farbenprächtiger Teppich, den Deborahs Mutter wenige Monate vor ihrem Tod selbst geknüpft hatte, bildete ein helles Oval auf dem Fußboden. Das schmale Messingbett, in dem Deborah seit ihrer Kindheit geschlafen hatte, stand unter dem Fenster.
In den drei Jahren ihrer Abwesenheit hatte St. James das Zimmer nicht ein Mal betreten. Aber jetzt trat er widerstrebend ein und ging zum offenen Fenster. Ein sanfter Wind raschelte in den weißen Vorhängen. Selbst hier oben konnte er den zarten Duft der Blumen im Garten riechen.
Während er hinuntersah, bog ein großer silberner Wagen aus der Cheyne Row kommend um die Ecke und hielt vor der alten Gartenpforte. St. James erkannte den Bentley und seinen Fahrer, der sich der jungen Frau an seiner Seite zuwandte und sie in die Arme nahm.
Das Mondlicht schien ins Wageninnere, und unfähig, sich von der Stelle zu rühren, selbst wenn er gewollt hätte – was nicht der Fall war –, beobachtete St. James, wie Lynley den Kopf zu Deborah hinunterneigte. Sie hob den Arm und zog ihn an sich, an ihren Hals, an ihre Brust.
St. James zwang sich, den Blick vom Wagen zum Garten zu wenden. Seine Augen brannten. Seine Haut selbst schien zu schmerzen.
Er kannte Deborah seit ihrer Geburt. In seinem Haus in Chelsea war sie aufgewachsen, das Kind eines Mannes, der für St. James Pfleger, Bediensteter und Freund zugleich war. In der finstersten Zeit seines Lebens war sie ihm ständige Gefährtin gewesen und hatte ihn aus den dunkelsten Tiefen der Verzweiflung gerettet. Doch jetzt …
Sie hat gewählt, dachte er und versuchte sich angesichts dieser Erkenntnis einzureden, dass er nichts fühlte, dass er es hinnehmen konnte, dass er Verlierer sein und weitermachen konnte.
Er überquerte den Flur und ging in sein Labor, wo er eine starke Lampe einschaltete, deren gebündeltes Licht auf einen Untersuchungsbericht fiel. Er mühte sich, das Papier zu lesen – ein erbärmlicher Versuch, sein Haus in Ordnung zu bringen. Dann hörte er den Wagen anspringen und wenig später Deborahs Schritte im unteren Flur.
Er machte noch ein Licht an und ging zur Tür, von einer plötzlichen Angst überkommen, von der Furcht, nichts sagen zu können, keine Ausrede dafür zu finden, warum er morgens um drei Uhr noch auf war. Aber ihm blieb gar keine Zeit zu überlegen. Deborah kam beinahe so rasch die Treppe heraufgeflogen wie am Nachmittag Sidney.
Sie nahm die letzte Stufe und fuhr zusammen, als sie ihn sah. »Simon!«
Zum Teufel mit seiner Rolle, alles schweigend hinzunehmen. Er hob eine Hand, und sie kam in seine Arme. Es war wie selbstverständlich. Sie gehörte an diesen Platz. Sie wussten es beide. Ohne weitere Überlegung senkte St. James den Kopf, um ihren Mund zu suchen, und fand stattdessen ihr Haar. Das unverwechselbare Aroma von Lynleys Zigaretten hing darin, bittere Erinnerung daran, wer sie gewesen und wer sie geworden war.
Der Geruch brachte ihn zur Besinnung, und er ließ sie los. Er sah, dass Zeit und räumliche Entfernung ihn verleitet hatten, ihre Schönheit in einem verklärten Licht zu sehen, ihr körperliche Eigenschaften zuzuschreiben, die sie nicht hatte. Er gestand sich ein, was er immer gewusst hatte. Schön im landläufigen Sinn war Deborah nicht. Weder besaß sie die aristokratische Eleganz Helens, noch die apart herausfordernden Züge Sidneys. Sie strahlte vielmehr Wärme und Zuneigung aus, wache Aufmerksamkeit und Witz, lauter Qualitäten, die sich in der Lebendigkeit ihrer äußeren Erscheinung vom kupferroten, eigenwilligen Haar bis zu den Sommersprossen auf ihrem Nasenrücken spiegelten.
Doch sie hatte sich verändert. Sie war zu dünn, und ein unerklärlicher Hauch von Bedauern schien gleich unter der Oberfläche ihrer Gelassenheit zu liegen. Dennoch sprach sie mit ihm wie immer.
»Hast du so lange gearbeitet? Du bist doch nicht extra meinetwegen aufgeblieben?«
»Es war die einzige Möglichkeit, deinen Vater zu bewegen, zu Bett zu gehen. Er dachte, Tommy könnte dich womöglich noch in dieser Nacht entführen.«
Deborah lachte. »Typisch Dad. Hast du das auch geglaubt?«
»Tommy war dumm, es nicht zu tun.«
Die Verstellung, mit der sie einander begegneten, schmerzte ihn. Mit einer schnellen Umarmung hatten sie geschickt Deborahs ursprüngliche Gründe, England zu verlassen, umgangen, als wären sie übereingekommen, die alte Beziehung zu spielen, obwohl sie beide wussten, dass es keine Rückkehr gab. Aber für den Augenblick war Scheinfreundschaft besser als Trennung.
»Ich habe etwas für dich.«
Er führte sie durch das Labor und öffnete die Tür zu ihrer Dunkelkammer. Sie griff nach dem Lichtschalter, und St. James hörte ihren Ausruf der Überraschung, als sie das neue Farbvergrößerungsgerät sah, das am Platz ihres alten Schwarz-Weiß-Geräts stand.
»Simon! Das ist ja – wie lieb von dir! Wirklich … das war doch nicht … und du bist extra meinetwegen aufgeblieben.«
Röte lief über ihr Gesicht. Sie hatte es nie verstanden, sich in peinlichen Momenten zu verstellen.
Der Türknauf unter seiner Hand fühlte sich kalt an. Der Vergangenheit zum Trotz hatte St. James angenommen, sie würde sich über das Geschenk freuen. Sie aber war bestürzt. Er hatte wohl mit dem Kauf des Geräts unwissentlich eine unsichtbar gezogene Grenze zwischen ihnen überschritten.
»Ich wollte dir gern einen schönen Empfang bereiten«, sagte er. Sie blieb stumm. »Du hast uns gefehlt.«
Deborah strich mit der Hand über die glatte Oberfläche des Geräts. »Ich hatte vor meiner Rückkehr eine Ausstellung in Santa Barbara. Weißt du das? Hat Tommy es dir erzählt? Ich habe ihn angerufen, weil – na ja, das ist doch das, was man sich immer erträumt. Dass die Leute kommen und ihnen die Sachen gefallen. Und sie vielleicht sogar etwas kaufen … Ich war unheimlich aufgeregt. Ich hatte die Abzüge mit einem der Vergrößerungsgeräte in der Schule gemacht, und ich weiß noch, wie ich überlegt habe, ob ich mir die neuen Kameras, die ich mir wünsche, überhaupt je leisten könnte … Und jetzt hast du mir dieses teure Gerät geschenkt …«
Sie trat zurück und sah sich in der Dunkelkammer um, musterte die Flaschen mit Chemikalien, die Kartons mit den Papiervorräten, die neuen Wannen für Entwickler- und Fixierbad. »Du hast für alles gesorgt. Ach, Simon, das ist mehr als – wirklich, das habe ich nicht erwartet. Alles ist – genau wie ich es brauche. Vielen Dank. Ich verspreche dir, ich komme jeden Tag her, um zu arbeiten.«
»Du kommst her?« St. James brach abrupt ab. Er hätte wissen müssen, was kommen würde, als er die beiden zusammen im Auto beobachtet hatte.
»Weißt du es noch nicht?« Deborah schaltete das Licht aus und kehrte ins Labor zurück. »Ich habe ein Apartment in Paddington. Tommy hat es im April für mich gemietet. Hat er dir das nicht erzählt? Und Dad auch nicht? Gleich morgen ziehe ich um.«
»Morgen? Jetzt schon? Heute?«
»Ja, genau genommen heute. Du lieber Gott, wir beide werden morgen schön ausschauen, wenn wir noch länger aufbleiben. Ich geh jetzt lieber. Gute Nacht, Simon. Und danke dir. Vielen Dank.« Sie drückte kurz ihre Wange an seine, streichelte flüchtig seine Hand und ging.
Das war’s also, dachte St. James, der ihr unbewegt nachblickte.
Dann ging er zur Treppe.
Sie hörte ihn gehen. Keine zwei Schritte von der geschlossenen Tür ihres Zimmers entfernt, lauschte Deborah seinen Schritten. Es war ein Geräusch, das sie ihr Leben lang nicht vergessen würde. Das leichte Aufsetzen des gesunden Beins, der schwere Aufprall des kranken. Die Hand auf dem Geländer, weiß vor Anspannung. Das stoßweise Atmen bei dem Bemühen, das Gleichgewicht zu halten. Und all diese Anstrengung mit einem Gesicht, das nichts verriet.
Sie wartete, bis sie seine Zimmertür eine Etage tiefer hörte, ehe sie zum Fenster ging.
Drei Jahre, dachte sie. Er war noch schmäler geworden, hager und krank sah er aus, und die scharfen Gesichtszüge waren gezeichnet von der Geschichte seines Leidens. Das Haar immer zu lang. Sie erinnerte sich an das seidige Gefühl, wenn es durch ihre Finger glitt. Der grüblerische Blick, der zu ihr sprach, auch wenn Simon selbst nichts sagte. Der Mund, der zärtlich den ihren berührte. Sensible Hände, Künstlerhände, die die Konturen ihres Gesichts nachzeichneten, die sie in seine Arme zogen.
»Nein. Nie wieder.«
Deborah flüsterte die Worte ruhig in den aufziehenden Morgen. Sie wandte sich vom Fenster ab und legte sich in Kleidern auf ihr Bett.
Denk nicht daran, sagte sie sich. Denk an gar nichts.
2
Immer war es derselbe elende Traum, eine Wanderung von Buckbarrow zum Greendale Tarn in einem Regen, so erfrischend und rein, dass er nur Einbildung sein konnte. Rauhe Felsen erklomm er, rannte ausgelassen über das weite Hochmoor, schlitterte wie der Wind den Hang hinunter, um lachend und außer Atem an dem kleinen Bergsee zu halten. Dieser glückliche Überschwang, diese kraftvolle Bewegung des ganzen Körpers, das Pulsen des Bluts in den Gliedern – er spürte es alles, fühlte es selbst im Schlaf.
Und dann das Erwachen, die niederschmetternde Rückkehr in die Realität. Wenn man dalag und zur Decke hinaufstarrte und Trostlosigkeit in Gleichgültigkeit abzumildern wünschte. Aber niemals fähig war, den Schmerz ganz zu ignorieren.
Die Tür zu seinem Schlafzimmer wurde geöffnet. Cotter kam mit dem Morgentee. Er stellte das Tablett auf den Nachttisch und warf St. James einen verstohlenen Blick zu, ehe er die Vorhänge aufzog.
Das Morgenlicht wirkte wie ein Stromschlag, der ihm direkt ins Gehirn fuhr. St. James zuckte zusammen.
»Ich hole Ihnen Ihre Medizin«, sagte Cotter. Er kam ans Bett, um St. James Tee einzuschenken, ehe er im Badezimmer nebenan verschwand.
Allein zog St. James sich hoch, bis er aufrecht im Bett saß. Jedes Geräusch schien in seinem dumpf schmerzenden Schädel ungeheuer verstärkt zu werden. Das Klappern der Tür des Apothekerschränkchens war ein Gewehrschuss, das Rauschen des Wassers das Donnern einer Lokomotive.
Cotter kehrte mit einem Fläschchen in der Hand zurück.
»So.« Er reichte St. James zwei Tabletten und wartete schweigend, bis dieser sie geschluckt hatte. Dann fragte er wie nebenbei: »Haben Sie Deb gestern Abend noch gesehen?«
Als sei ihm die Antwort im Grunde gar nicht wichtig, ging Cotter wieder ins Badezimmer, um, wie St. James wusste, die Temperatur des einlaufenden Badewassers zu prüfen. Es war eine völlig unnötige Aufmerksamkeit. Indem er das Herr-und-Diener-Spiel spielte, versuchte er Desinteresse vorzutäuschen.
St. James gab überreichlich Zucker in seinen Tee und trank. Dann lehnte er sich in die Kissen zurück und wartete darauf, dass die Tabletten ihre Wirkung tun würden.
Cotter erschien wieder an der Badezimmertür.
»Ja, ich habe sie gesehen.«
»Ziemlich verändert, nicht wahr?«
»Das war zu erwarten. Sie war lange weg.« St. James gab noch einmal Zucker in seine Tasse. Er zwang sich, Cotter in die Augen zu sehen. Der entschlossene Ausdruck auf Cotters Gesicht verriet ihm, dass dieser nur auf eine Aufforderung wartete, ihm Enthüllungen zu machen, die er lieber nicht hören wollte.
Cotter blieb stur an der Tür stehen. St. James gab nach. »Was ist denn?«
»Lord Asherton und Deb.« Cotter strich sich das dünne Haar glatt. »Ich hab’ immer gewusst, dass Deb eines Tages einen Mann finden würde, Mr. St. James, ich bin ja nicht weltfremd. Aber ich wusste doch, wie sie zu Ihnen stand – na ja, da dachte ich wahrscheinlich …« Cotters Zutrauen schien einen Moment zu schwinden. Er zupfte ein Stäubchen von seinem Ärmel. »Ich mach’ mir Sorgen um sie. Was will ein Mann wie Lord Asherton von Deb?«
Sie heiraten, natürlich. Die Antwort stellte sich reflexartig ein, aber St. James sprach sie nicht aus, obwohl er wusste, dass er damit Cotter die ersehnte Beruhigung vermittelt hätte. Stattdessen ertappte er sich bei der Versuchung, vor Lynley zu warnen, seinen alten Freund als einen Dorian Gray zu zeichnen. Er war angewidert von sich selbst. Schließlich sagte er nur: »Es ist wahrscheinlich nicht das, was Sie glauben.«
Cotter strich mit zwei Fingern den Türpfosten hinunter, als prüfe er ihn auf Staub. Er nickte, aber überzeugt war er offensichtlich nicht.
St. James griff nach seinen Krücken und stand vom Bett auf. Er ging durch das Zimmer und hoffte, Cotter würde das als Zeichen verstehen, dass die Diskussion beendet war.
»Deb hat sich eine Wohnung in Paddington genommen. Hat sie Ihnen das erzählt? Sie lässt sich von Lord Asherton aushalten wie irgendein Flittchen.«
»Ganz sicher nicht«, entgegnete St. James, während er den Gürtel um seinen Morgenrock knotete.
»Woher hat sie dann das Geld?«, fragte Cotter. »Wer bezahlt die Wohnung, wenn nicht er?«
St. James ging ins Badezimmer. Er drehte die Wasserhähne zu und überlegte, wie er dem Gespräch ein Ende bereiten könnte.
»Dann müssen Sie mit ihr sprechen, Cotter, wenn Sie das wirklich glauben. Verschaffen Sie sich Klarheit.«
»Wenn ich das glaube? Sie glauben es doch auch, Sie brauchen es gar nicht zu bestreiten. Ich seh’s Ihnen an.« Cotter kam in Fahrt. »Ich habe versucht, mit dem Kind zu reden. Aber es kam nichts dabei raus. Sie zog gestern wieder mit ihm ab, ehe ich überhaupt eine Gelegenheit fand, mit ihr zu sprechen. Und heute Morgen ist sie auch schon wieder weg.«
»Schon? Mit Tommy?«
»Nein. Allein. Nach Paddington.«
»Dann fahren Sie zu ihr. Sprechen Sie mit ihr. Sie freut sich vielleicht über eine Gelegenheit, mit Ihnen allein sein zu können.«
Cotter ging an ihm vorbei und begann mit übertriebener Sorgfalt, das Rasierzeug bereitzulegen. St. James beobachtete ihn argwöhnisch; er ahnte, dass das Schlimmste noch bevorstand.
»Ja, ein richtiges, handfestes Gespräch. Genau das hab’ ich mir auch gedacht. Aber ich bin nicht der Richtige. Als Vater hat man nicht genug Abstand. Sie wissen, was ich meine.«
Er wusste es nur zu gut. »Sie wollen doch nicht etwa vorschlagen …«
»Deb hat Sie sehr gern. Schon immer.« Cotters Miene verriet die Herausforderung hinter seinen Worten. Er scheute auch eine kleine emotionale Erpressung nicht, wenn sie den Weg freimachte, den er für den richtigen hielt. »Wenn Sie Deb nur zur Vorsicht mahnen würden. Mehr verlange ich gar nicht.«
Zur Vorsicht mahnen? Wie würde das denn laufen? Lass die Finger von Tommy, Deborah. Sonst heiratet er dich am Ende noch. Ausgeschlossen.
»Nur ein Wort«, insistierte Cotter. »Sie hat Vertrauen zu Ihnen. Genau wie ich.«
St. James unterdrückte einen Seufzer. Wäre nur nicht Cotters unerschütterliche Loyalität in all den Jahren seiner Krankheit gewesen! Stünde er nur nicht so tief in Cotters Schuld. Der Tag der Abrechnung kommt eben immer.
»Na gut«, sagte St. James. »Vielleicht schaffe ich es noch heute irgendwann, wenn Sie ihre Adresse haben.«
»Die hab’ ich«, antwortete Cotter. »Und Sie werden sehen, Deb wird gern auf Sie hören.«
Ganz bestimmt, dachte St. James mit grimmigem Spott.
Das Haus, in dem Deborah eine Wohnung gemietet hatte, trug den Namen Shrewsbury Court Apartments. St. James fand es ohne große Mühe in Sussex Gardens, ein hohes Gebäude mit einer fleckenlosen grauen Steinfassade, zwischen zwei ziemlich schäbigen Pensionen eingezwängt, vorn durch ein Eisengitter von der Straße abgezäunt.
St. James ging den schmalen Betonweg entlang zur Tür und drückte auf den Klingelknopf neben dem Namen Cotter. Der elektrische Türöffner summte, und er trat in ein kleines Foyer mit schwarz-weiß gefliestem Boden. Es war blitzsauber, und ein schwacher Geruch nach Desinfektionsmitteln verhieß, dass es auch so bleiben würde. Nicht weit vom Aufzug war eine Tür mit einem diskreten Schild, auf dem concierge stand – als wolle man durch das französische Wort auf die Vornehmheit des Hauses hinweisen.
Deborahs Wohnung war in der obersten Etage. Im Aufzug wurde St. James noch einmal mit aller Klarheit bewusst, wie absurd die Situation war, in die Cotter ihn gebracht hatte. Deborah war jetzt eine erwachsene Frau. Sie würde sich keine Einmischung in ihr Leben bieten lassen. Am wenigsten von ihm.
Sie öffnete sofort auf sein Klopfen, als hätte sie den ganzen Nachmittag nichts anderes getan, als auf sein Kommen zu warten. Freude schlug jedoch augenblicklich in Überraschung um, als sie ihn sah, und erst nach einem kurzen Zögern trat sie von der Tür zurück, um ihn einzulassen.
»Simon! Ich hatte ja keine Ahnung …« Sie bot ihm die Hand, schien es sich anders zu überlegen und senkte sie wieder. »Das ist wirklich eine Überraschung. Ich erwartete … das ist wirklich … du bist … Was red ich da für Unsinn! Bitte, komm doch herein.«
Das enge kleine Ein-Zimmer-Apartment verdiente kaum die Bezeichnung Wohnung. Doch es war hübsch eingerichtet. Die Wände waren hellgrün gestrichen, frisch wie ein Frühlingshauch. An einer von ihnen stand eine Bettcouch aus Rattan mit einer bunten Decke und vielen Kissen, an einer anderen hing eine Auswahl von Deborahs Fotografien, Aufnahmen, die St. James nie gesehen hatte, die sie wohl aus Amerika mitgebracht hatte. Aus der Stereoanlage unter dem Fenster klang gedämpfte Musik. Debussy. L’Après-midi d’un Faune.
St. James drehte sich um, um eine Bemerkung über das Zimmer zu machen – wie anders es sei als ihr kunterbuntes Jungmädchenzimmer zu Hause –, und bemerkte eine kleine Nische links von der Tür: die Küche mit einem kleinen Tisch, der für zwei zum Tee gedeckt war.
Natürlich, er hätte es sofort merken müssen, als er gekommen war. Gewöhnlich trug sie nicht am helllichten Nachmittag ein zartes Sommerkleid.
»Du erwartest Besuch. Entschuldige. Ich hätte vorher anrufen sollen.«
»Ich hab noch gar keinen Anschluss. Es macht doch nichts. Wirklich. Wie findest du die Wohnung? Gefällt sie dir?«
Sie entsprach genau ihrem Wesen: ein ruhiger, von ihrer Weiblichkeit geprägter Raum, in dem ein Mann sich nichts anderes wünschen würde, als an ihrer Seite zu liegen und den Tag zu vergessen, um die Freuden der Liebe zu genießen. Aber das war wohl kaum die Antwort, die Deborah von ihm wünschte. Um ihr keine geben zu müssen, ging er auf die Fotografien zu.
Mehr als ein Dutzend hingen da, aber sie waren so gruppiert, dass sein Blick sofort auf das Schwarz-Weiß-Porträt eines Mannes gezogen wurde, der mit dem Rücken zur Kamera stand, den Kopf im Profil, Haar und Haut – beide von Nässe glänzend – in starkem Kontrast zum ebenholzschwarzen Hintergrund.
»Tommy ist sehr fotogen.«
Deborah trat zu ihm. »Ja, nicht wahr? Ich habe versucht, seine Muskulatur herauszuarbeiten, aber ich bin mir nicht sicher, ob es gelungen ist. Die Beleuchtung stimmt irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht. Einmal gefällt’s mir, und dann find ich es wieder so plump wie ein Foto aus dem Verbrecheralbum.«
St. James lächelte. »Du bist immer noch so streng mit dir, Deborah.«
»Ja, wahrscheinlich. Nie zufrieden. Das ist mein Schicksal.«
»Ich fand eine Aufnahme gut. Dein Vater auch. Wir holten Helen zur weiteren Begutachtung. Und dann hast du deinen Erfolg jedes Mal damit gefeiert, dass du die Aufnahme wegwarfst und uns alle drei zu hoffnungslosen Banausen erklärtest.«
Sie lachte. »Wenigstens hab’ ich nicht um Komplimente gebuhlt.«
»Nein. Das hast du nie getan.« Er wandte sich wieder der Wand zu, und die unbefangene Heiterkeit des kurzen Wortwechsels verflüchtigte sich.
Neben dem Schwarz-Weiß-Porträt hing eine Studie ganz anderer Art. Auch sie zeigte Lynley, nackt in einem alten schmiedeeisernen Bett, das zerknitterte Bettzeug über dem Unterkörper. Ein Bein angezogen, den Ellbogen aufs Knie gestützt, blickte er zu einem Fenster, vor dem Deborah stand, den Rücken zur Kamera, das Sonnenlicht leuchtend auf der Rundung ihrer rechten Hüfte. Gelbe Vorhänge bauschten sich wie Schaum, zweifellos, um das Selbstauslöserkabel zu verstecken, das ihr gestattet hatte, diese Aufnahme zu machen. Das Bild wirkte völlig spontan, als hätten sie beim Erwachen an Lynleys Seite das Spiel des Lichts, der Kontrast von Vorhängen und Morgenhimmel, zu der Aufnahme gereizt.
St. James starrte das Bild an und versuchte so zu tun, als könne er es unter rein ästhetischen Gesichtspunkten bewerten, und wusste doch die ganze Zeit, dass er in ihm nur die Bestätigung von Cotters Verdacht sehen konnte. Er hatte trotz der nächtlichen Szene, die er beobachtet hatte, immer noch an einem dünnen Fädchen Hoffnung festgehalten. Es zerriss vor seinen Augen. Er sah Deborah an.
Zwei rote Flecken brannten auf ihren Wangen.
»Was bin ich für eine schlechte Gastgeberin! Möchtest du etwas trinken? Einen Gin Tonic vielleicht? Oder Whisky? Und Tee hab’ ich auch da. Tee hab’ ich massenhaft. Ich wollte gerade …«
»Nein. Nichts. Du erwartest Besuch. Ich bleibe nicht lang.«
»Bleib doch zum Tee. Ich stell noch ein Gedeck hin.« Sie ging in die winzige Küche.
»Nein, Deborah, bitte«, sagte St. James hastig, der sich die Szene lebhaft vorstellen konnte: peinliche Höflichkeit bei Tee und Biskuits, während Deborah und Lynley die ganze Zeit wünschten, er würde endlich gehen. »Es passt nicht.«
Deborah, die schon Tasse und Untertasse aus dem Schrank genommen hatte, drehte sich nach ihm um. »Es passt nicht? Wieso? Es ist doch nur …«
»Hör zu, Vögelchen.« Er wollte nur loswerden, was er zu sagen hatte, nur seine unerfreuliche Pflicht tun, das Versprechen halten, das er ihrem Vater gegeben hatte, und schnellstens verschwinden. »Dein Vater sorgt sich um dich.«
Deborah stellte die Tasse ab. Sie schob sie auf der Arbeitsplatte hin und her. »Ach, so. Du bist sein Abgesandter. Gerade in dieser Rolle hätte ich dich am wenigsten erwartet.«
»Ich habe ihm versprochen, mit dir zu reden, Deborah.«
Er sah, wie die Röte ihrer Wangen sich vertiefte. Vielleicht lag es an seinem Ton. Sie presste die Lippen zusammen, ging zur Couch und setzte sich.
»Also gut. Fang an«, sagte sie und faltete die Hände.
St. James sah die ersten Anzeichen eines Wutausbruchs in ihrem Gesicht flackern. Er hörte erwachenden Widerspruch in ihrer Stimme. Aber er ignorierte beides. Er wollte nur hinter sich bringen, wozu er sich verpflichtet fühlte. Er versicherte sich selbst, dass nur sein Cotter gegebenes Versprechen ihn davon abhielt zu gehen, ohne Deborah die Besorgnis ihres Vaters klar vor Augen geführt zu haben.
»Dein Vater macht sich Sorgen wegen dir und Tommy«, begann er, wie ihm schien, durchaus vernünftig.
Sie konterte: »Und du? Machst du dir auch Sorgen?«
»Mich geht das nichts an.«
»Ach ja. Ich hätte es wissen müssen. Und jetzt, wo du bei mir warst und die Wohnung gesehen hast, wirst du da Meldung machen und die Bedenken meines Vaters für ungerechtfertigt erklären? Oder muss ich erst etwas tun, um die Prüfung zu bestehen?«
»Du hast mich missverstanden.«
»Du platzt hier herein, um mich zu überprüfen. Was habe ich da missverstanden?«
»Es geht nicht darum, dich zu überprüfen, Deborah.« Er fühlte sich in die Defensive gedrängt. So hatte das Gespräch nicht ablaufen sollen. »Aber deine Beziehung zu Tommy …«