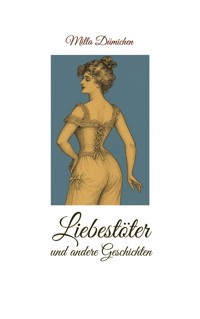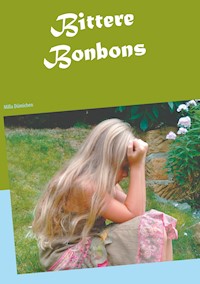Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Brief, der nach über siebzig Jahren mit "Mein lieber Oskar ..." beginnt, lässt die ebenfalls noch in Russland geborene Tochter einer deutschstämmigen Mutter nicht los. Für Milla Dümichen ist er der Anlass, mit diesem Buch einen Bogen vom Anfang des 20. Jahrhunderts bis in unsere Tage zu schlagen. Sie erzählt am Beispiel ihrer Mutter von Freud und Leid der deutschen Auswanderer nach Russland in dieser Zeit. Von Glück und Liebe in der neuen Heimat und von Tod und unsäglichem Leiden während der Verbannung in Straf- und Arbeitslager in und nach beiden Weltkriegen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 358
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Ein Wort vorweg
Kapitel 1
Alma
Kapitel 2
Katarina
Alma
Ed
Alma
Ed
Alma
Kapitel 3
Alma
Kapitel 4
Alma
Kapitel 5
Alma
Kapitel 6
Alma
Kapitel 7
Alma
Kapitel 8
Alma
Kapitel 9
Alma
Kapitel 10
Alma
Kapitel 11
Alma
Kapitel 12
Alma
Kapitel 13
Linda
Alma
Kapitel 14
Alma
Kapitel 15
Alma
Kapitel 16
Alma
Kapitel 17
Linda
Alma
Kapitel 18
Alma
Kapitel 19
Alma
Kapitel 20
Alma
Kapitel 21
Alma
Kapitel 22
Doc
Kapitel 23
Alma
Linda
Alma
Kapitel 24
Alma
Kapitel 25
Alma
Kapitel 26
Nachweise
Ein Wort vorweg
Die Autorin dieses Buches lernte ich vor Jahren im Redaktionsteam des Füllhorn kennen. Milla Dümichen war bereits eine feste Größe in diesem Magazin für Soester Bürgerinnen und Bürger und überzeugte auch mich schnell mit ihren Geschichten, die das Leben schreibt, wie sie ihre Beiträge gerne nennt. Mir gefielen ihr fröhliches Wesen, ihre Fähigkeit, im Alltagsleben Beobachtetes in kleine Episoden zu formen, und vor allem ihre uneitle Offenheit für Anregungen. Besonders galt das für die sprachlichen Feinheiten des Deutschen. Als ehemaliger Deutschlehrer imponierte es mir, wie sicher sich Milla in einer Sprache bewegte, die sie erst als Vierzigjährige neu erlernen musste. Ihre Muttersprache war das Russische, als sie mit ihrer Mutter, einer Russlanddeutschen, die ihre Schullaufbahn noch mit Deutsch abgeschlossen hatte, 1992 aus Georgien nach Deutschland kam. Sie flohen, als der seit 1990 schwelende Kaukasuskonflikt zwischen Georgiern, Südosseten und Abchasen in einen Krieg ausartete.
Nur ihr erkennbar russischer Akzent, Reste grammatischer Wendungen, wie sie im Russischen für den Gebrauch der Artikel und Fälle gelten, und oft lustige Bedeutungsverwechslungen geben auch heute noch Zeugnis über ihre sprachliche Herkunft. Dieses Ärgernis für sie bekämpft sie offensiv mit der Bitte, sie in solchen Fällen gnadenlos zu korrigieren. Auf diese Weise pflegen wir seither eine Partnerschaft, die mit ihrer Umformung des westfälischen Pumpernickels zu Pimpernuckel entstand.
Mit viel Vergnügen begleitete ich daher ihre ersten Veröffentlichungen „Bittere Bonbons“ sowie „Pustekuchen und andere Delikatessen“ mit ihren Erlebnissen in der alten und neuen Heimat.
Diese Geschichten ließen Milla nicht ruhen. Besonders die Freude darüber, wie sehr ihre geliebte Mutter es genossen hat, nach so viel Leid in Verbannung und Arbeitslagern ihre letzten 25 Jahre im Sehnsuchtsland Deutschland verbringen zu dürfen, drängte sie, die Geschichte der entrechteten Russlanddeutschen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts am Beispiel ihrer Mutter zu erzählen. Nun liegt dieses Herzensprojekt Milla Dümichens als fiktives Tagebuch von Alma Peel vor. Und ich verhehle so manche Träne nicht, die ich bei der Durchsicht des Textes nicht halten konnte.
Rudolf Köster, Gründungsmitglied der BördeAutoren
1
Als ich meine Mutter im Dezember 2014 fragte, was sie sich zu Weihnachten wünscht, ist es eher eine Höflichkeit. Seit Jahren schon hatte sie beteuert, sie brauche nichts, sie habe alles. Sie genoss ihre zentral gelegene betreute Wohnung mit Fahrstuhl, deren Süd-West-Ausrichtung sie den ganzen Tag mit hellem Sonnenschein verwöhnte. Auf den Fensterbänken und ihrem Balkon pflegte sie mit Begeisterung ihre unzähligen Pflanzen.
Viele ihrer jetzigen Nachbarinnen hatten im Luxus gelebt. Urlaub in Italien und Österreich, Pelzmäntel, Autos, Häuser in bester Lage. So was besaß meine Mutter nie. Aber im Gegensatz zu ihr waren nicht wenige Bewohner dort auf fremde Hilfe angewiesen, weil sich aus unterschiedlichen Gründen niemand aus ihrer Familie um sie kümmerte.
Da stand meine Mutter ein bisschen besser da: Sie hatte mich. Und das war ihr viel wichtiger als mehr Rente oder teure Möbel. Denn so kam sie in den Genuss, durch Wald und Feld ins Grüne gefahren zu werden und – was ihr sehr gefiel, – in Boutiquen einkaufen zu können. Mit einem Rollator und per Bus wäre das zu weit und zu umständlich gewesen. Sie genoss diese Unternehmungen mit mir.
Vor allem das Shoppen. Jede Bluse, jeder Pullover wurde genau betrachtet und bewundert. Diese Sternstunden für sie waren ihr wichtig. Ihr Leben lang hatte sie nur Arbeit und Mangel gekannt und so etwas nicht gehabt. Doch nun wurden ihre Jugendträume im hohen Alter wahr. Mit meinem Zuspruch leistete sie sich das ein oder andere moderne Kleid. Endlich konnte sie ihre Sehnsucht nach Plissee-Röcken stillen. Inzwischen besaß sie um ein Dutzend solcher Röcke in verschiedenen Farben. So konnte auch sie punkten. Die schicken Kleider ihrer Nachbarinnen hatten ein bisschen an Glanz verloren.
Auch ihr ausgezeichnetes Gedächtnis und ihre Fähigkeit zu erzählen, kamen nun zutage. Sie zitierte Gedichte, die sie in der Grundschule gelernt hatte, sie spielte ausgezeichnet Mensch ärgere dich nicht und konnte gut singen.
Und sie hatte mich, ihre Tochter, die sie fast jeden Tag besuchte. Meine Mutter wurde beneidet und gelobt. Die kleine Halbwaise, die ihr Leben lang geschubst, erniedrigt und ausgenutzt worden war, stand jetzt im Mittelpunkt.
An dem Tag, als ich Mama fragte, was sie sich zu Weihnachten wünsche, fiel mir auf, wie klein, wie zierlich sie geworden war. Geschrumpft um mehrere Zentimeter und etliche Kilo. Ich drückte sie sanft an meine Brust. In meinem Alter war sie kräftig und flink gewesen. Sie hatte nie Zeit, sich im Spiegel zu betrachten. Immer werkelte sie im Garten und im Stall, Winter und Sommer. Immer ein Kopftuch – unter dem Kinn nach hinten geschlungen und geknotet. Ich habe ihre wunderschönen kastanienbraunen Haare damals selten gesehen, nur dann, wenn sie diese wusch und in der Sonne trocknen ließ. Sie leuchteten rötlich und fühlten sich weich und geschmeidig an. Meine Mutter hatte ihr geheimes Pflegerezept: Regenwasser mit ein paar Tropfen Essig.
Ich betrachtete sie von der Seite und mir wurde schwer ums Herz. Sie war 97. Sie war fest davon überzeugt, ein himmlischer Schutzengel habe ihr geholfen, die sibirische Kälte, Arbeit bis zum Umfallen, Krankheiten und Verluste zu überstehen. Im Ersten Weltkrieg geboren, im zweiten vier Jahre Zwangsarbeit geleistet, ihre große Liebe verloren, gehungert, gebangt, sich gefügt und überlebt. Sie war doch noch so jung damals. Was war mit ihren Gefühlen, sexuellen Bedürfnissen? Das alles ist mir besonders dann durch den Kopf gegangen, wenn ich ihr beim Duschen half. Schmaler Rücken, hängende Brüste, dünne Beine. Doch sie lachte vergnügt. Noch ging es ihr gut, noch genoss sie die Zeit, als gebe es kein Morgen.
Wie lange noch? Ich wollte ihr jeden Wunsch erfüllen und ließ nicht locker. Hakte nach mit der Frage nach einem Weihnachtsgeschenk. Als sie mir antwortete, musste ich erst mal staunen: Sie wünschte sich ein Buch, das ein russisches Archiv neulich veröffentlicht hatte. Ich bestellte es, und als es eine Woche später mit der Post kam, hatte ich schon vergessen, worum es ging.
„Heimatbuch“ stand auf der Titelseite. Ich blätterte kurz darin – lauter Namen und Orte, die mir nichts sagten. In den Weihnachtsvorbereitungen hatte ich nicht viel Zeit, um das Buch zu lesen, und so wickelte ich es in ein buntes Weihnachtspapier und schrieb „Alma“ darauf.
Als ich es unter den Weihnachtsbaum legte, konnte ich nicht ahnen, dass es unser letztes gemeinsames Weihnachtsfest werden sollte. Ein halbes Jahr später verließ sie uns für immer.
Mehrere Wochen ließ ich mir Zeit mit der Wohnungsräumung. Seit Mamas Tod hatte alles plötzlich einen anderen Wert, jede Notiz, jedes Foto, jeder Gegenstand. Sollte ich es weggeben? In einen Container werfen Unter Bedürftige verteilen? Nein, noch konnte ich nicht loslassen, ich war noch nicht so weit. Vielleicht bald, vielleicht irgendwann, redete ich mir ein.
Eine Holzkiste, die ich im Schlafzimmer in einer Kommode fand, nahm ich mit nach Hause. In ihr hatte sie ihre wichtigen Dokumente aufbewahrt. Dutzende Schulhefte, einige Bilder und eine Unzahl loser Blätter liegen darin, obendrauf das Heimatbuch und ein Brief.
„24. Dezember 2014
Mein liebster Oskar! Heute Nacht habe ich von dir geträumt, seit langem mal wieder. Hand in Hand sind wir im Wald spazieren gegangen zu unserem Lieblingsplatz. Wir haben uns geliebt. Ich schloss meine Augen, und als ich glaubte, in deinen Armen verbrennen zu müssen, löstest du plötzlich deine Umarmung und warst weg. Die schwankenden Zweige deuteten die Richtung, in die du verschwunden warst.
Ich rief dir nach und lief dir hinterher. Aber du antwortetest mir nicht. Die stacheligen Äste zerkratzten meine nackten Beine und mein Gesicht. Ich blieb stehen und wischte mir das Blut vom Gesicht. Eine innere Stimme sagte mir: Du bist weg, dieses Mal für immer. Für immer.
Ich werde wach, weil ich keine Luft mehr kriege. Ich bin durchgeschwitzt und mein Herz rast heftig. Einen Moment überlege ich, wo ich bin. Der Mond beleuchtet nur sparsam mein Zimmer, den Nachttisch und die Wanduhr. Zwei Uhr. Meine Füße sind eiskalt trotz Wollsocken.
Ich versuche die Fetzen meines Albtraums festzuhalten, aber es gelingt mir nicht. Ein schöner und doch schrecklicher Traum war das. Ich rede mir ein, es ist nur ein Traum, nichts weiter, doch ein unbehagliches Gefühl, dass es um eine Botschaft ging, bleibt noch eine Weile in mir haften.
Liegen bleiben macht keinen Sinn, ich werde nicht wieder einschlafen können. Ich ziehe mir meinen Bademantel über mein verschwitztes Nachthemd und öffne die Balkontür. Frischer, würziger Nelkenduft weht vom Balkon herein. Ich atme tief ein. Dieser vertraute Duft begleitet mich über Jahrzehnte. Wo ich auch wohne, einen Topf mit Nelken auf dem Balkon gönne ich mir. Den bepflanze ich noch selbst.
Und überhaupt geht es mir gut, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, die ich noch selbst erledigen kann. Mir zum Beispiel die Fingernägel selbst schneiden oder ein Süppchen allein kochen können, das macht mich glücklich und zufrieden. Noch vergesse ich nicht, die Kochplatten auszuschalten, wie es meiner Nachbarin schon passiert ist.
Der Spiegel im Bad zeigt mir eine alte Frau mit zerzaustem Haar und welkem Gesicht. Alt bin ich geworden. Ein Schatten meiner selbst. Meine ehemals welligen, kastanienbraunen Haare sind grau und dünn geworden. Mein Gesicht ist mit Falten und Furchen gezeichnet, eingegraben in 97 Jahren.
Ich habe es mir nicht ausgesucht, so lange zu leben. Manchmal wollen meine Beine nicht weiterlaufen. In der Hüfte zieht es, pocht der Schmerz, krabbelt langsam nach unten in die Knie, so wie jetzt. Ich leg mich wieder hin, spanne die Muskeln an und lasse sie wieder los. Und noch einmal. Die Übungen sind nicht schwer, doch sehr wichtig. Nach kurzer Zeit vergeht der Schmerz, wenn auch nicht für immer.
Ich setze mich in meinen Sessel und schau mir die Fruchtstände meiner Balkonpflanzen an, die ich in den Winter hinein als Futtermöglichkeit für die Vögel stehen lasse. Bald werden die kleinen Sänger nichts mehr dort finden und ich werde das übrig gebliebene Gestrüpp entsorgen. So wie mich. Ich bin am Ende meines Lebens angelangt. Es ist auch für mich der Winter gekommen, und der Mann mit der Sense klopft schon an die Tür. Auch wenn sich gerade ein wenig Dezembersonne noch mal richtig ins Zeug legt.
Ich kämpfe mich ebenfalls durch meine letzten Tage. Mache gewissenhaft meine Übungen, um die Muskeln nicht erlahmen zu lassen. Doch wie lange schaffe ich das noch? Aber solange nicht alles düster um mich ist und die Schmerzen sich in Grenzen halten, erfreue ich mich an vielen Dingen.
Es macht mich glücklich, dass ich in die Heimat meiner Vorfahren zurückgekehrt bin, die sie vor dreihundert Jahren aus der Not heraus verlassen haben. Es macht mich glücklich, zu wissen, dass ich nicht irgendwo im weiten, verschneiten Osten Russlands begraben werde.
Ab und zu, und in letzter Zeit immer öfter, denke ich an meine Heimat Ukraine. 1936 musste ich sie verlassen. Aber das weißt du ja. Schade, dass ich es in all den Jahren nicht geschafft habe, diesen Ort noch einmal zu besuchen, den großen Stein vor unserer Haustür zu streicheln und mit dem Akazienbaum meinen Frieden zu schließen. Dem habe ich lange nachgetragen, dass er der Eule Schutz gewährt hatte. Der Eule, die mit ihrem Schrei Mamas Tod prophezeite.
Vor einiger Zeit schickte mir mein Bruder ein Bild unseres Hauses mit der Scheune und dem Stall, von ihm selbst gezeichnet. Auch 80 Jahre und tausende Kilometer von diesem Ort entfernt habe ich noch alles in meiner Erinnerung. Auch das, was ich wo und wie überlebt habe, würde für zwei bis drei Menschenleben reichen.
Ich danke Gott, dass er mir meinen klaren Kopf erhalten hat, sodass ich mich noch an alles gut erinnern kann, auch an die schlimmen Zeiten wie Krieg, Hunger, Vertreibung, Abschied. So oft gebangt, so oft getrauert. Manche Erinnerungen schmerzen immer noch.
Meine Nachbarin sagte vor kurzem, wir werden es noch an meinem 100. Geburtstag krachen lassen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Soll ich lachen? Soll ich mich freuen? Blumenduft, Vogelgezwitscher, warme sonnige Tage, das alles freut mich und gibt mir immer wieder Kraft und vielleicht auch ein bisschen Hoffnung.
Gewiss, Hoffnung für so eine Greisin wie mich, klingt komisch, aber es tut mir gut. Und warum soll ich mir Sorgen machen? Es geht mir gut, meine kleine Rente reicht mir, und die kurzen Wege zum Geschäft kann ich gut bewältigen.
Die Angebote an Lebensmitteln sind hier reine Zerstreuung. Es bleiben keine Wünsche offen. Wenn du das alles sehen könntest! Ich tapere von Regal zu Regal und zerbreche mir den Kopf. Früher habe ich an den Feiertagen ein Huhn geschlachtet, Nudeln selbst gemacht und Suppe gekocht. Zum Nachtisch gab es Mohn- oder Nusskuchen.
Ich darf nicht zu viel auf einmal kaufen. Meine Kräfte reichen gerade, um die Tüte nach Hause zu bringen. Dann nehme ich auch den Fahrstuhl in Anspruch. Sonst laufe ich zu meiner Wohnung im ersten Geschoss zu Fuß. Es muss sein, das hält mich fit. Meine Ärztin ist jedes Mal hellauf begeistert, wenn sie mir meine Befunde präsentiert. Die würden wesentlich jüngere Leute glücklich machen, meint sie.
Und wieder zieht es in der Hüfte. Meine Tochter redet mir gut zu: „Ich bringe dich zum Arzt.“ Er verschreibt Krankengymnastik und schickt mich zum Röntgen. Was für eine Verschwendung! Ist doch klar, dass in meinem Alter alles Mögliche kaputt ist, auch die Hüfte. Sie ist einfach müde mit ihren fast 100 Jahren!
Mit einem Rollator laufen will ich nicht. Ich habe viele alte Menschen mit blauen Flecken im Gesicht oder Bein- und Schulterbruch gesehen, denen der Rollator die Hilfe versagt hatte. Neulich wollte die Ärztin mich von den Vorteilen eines Rollators überzeugen. Ich habe mich so energisch gewehrt, bis sie endlich sagte: „Ich sehe schon, sie sind zu jung für einen Rollator.“
Und immer die Füße beim Gehen anheben, nicht vergessen. Als ich einmal gestolpert bin und mich eine Woche lang mit einem blauen Auge nicht aus der Wohnung traute, ärgerte ich mich über meine eigene Dummheit.
Manchmal denke ich an mein Ende im Kreislauf der Natur. Alle meine Geschwister bis auf eine Schwester sind tot. Wie wird mein Ende sein? Der Moment, wenn alles zu Ende geht? Wie ist es, nicht mehr zu sein, nicht mehr zu existieren? Werde ich Schmerzen haben? Was muss ich noch erledigen, bevor ich gehe?
Ich lege mein Schicksal in Gottes Hände. Eines Gottes, der nicht gefürchtet werden muss, der nicht richtet und der keinen Grund zur Bestrafung hat. Er hat mich noch nie im Stich gelassen.
Lieber Oskar, ich muss jetzt los, ich feiere Heiligabend bei meiner Tochter, mit Enkeltochter und Urenkeln. Ich freue mich das ganze Jahr darauf. Wer weiß, wie lange noch?“
Ich lege den Brief beiseite, als ich auf dem nächsten Blatt eine zweite Datierung lese. Ich ahne, was ich dort lesen werde.
Wäre der Brief nicht in Mamas Schrift geschrieben, hätte ich nach den ersten Zeilen behauptet, er sei nicht von ihr. Aber es ist ihre Handschrift. Und er lag in der Holzkiste, die schon seit Jahren meiner Mutter gehört – direkt über dem Heimatbuch, aus dem sie nach sieben Jahrzehnten Ungewissheit endlich erfahren konnte, warum aus ihrem Lebenstraum mit Oskar nichts hatte werden können.
Ich schaue mich in Mamas Wohnung um. Wo hat sie gesessen, als sie diesen Brief verfasste? An dem runden Tisch, auf dem die weiße, glattgebügelte Tischdecke liegt? Oder saß sie entspannt in ihrem Lieblingssessel, den Schreibblock auf dem Schoß?
Nach über siebzig Jahren hat meine Mutter eine Liebeserklärung an Oskar geschrieben, ihre erste Liebe, den Vater ihrer Tochter Linda, meiner Halbschwester. So sehr mich diese Zeilen rühren, sie irritieren mich auch. Was ist mit meinem Vater, ihrem Ehemann, mit dem sie 47 Jahre verheiratet war? Liebte sie ihn nicht?
Mir wird klar, wie wenig ich über meine Mutter weiß. Ich weiß, dass sie 1917 auf dem Rückweg aus der Verbannung in die Ukraine geboren wurde und ich eine Halbschwester Linda habe, die ich nur einmal in meinem Leben traf. Ich war damals drei Jahre alt. Ich werde mich mit ihr in Verbindung setzen müssen.
Ich stöbere weiter in Mamas Heften mit Aufzeichnungen, nicht ohne schlechtes Gewissen und doch in der Hoffnung, Weiteres zu erfahren. Wäre es ihr recht, wenn ich das lese? Fragen kann ich Mama nicht mehr. Aber sie hat sie mir dagelassen. Sie hätte ja auch alles im Altpapiercontainer entsorgen können. Also traue ich mich und finde viele dicht beschriebene Seiten, mal in schöner Schrift, mal hakelig – eben so, als hätte sie etwas ganz Wichtiges schnell eintragen müssen, bevor sie es vergisst. Zum Beispiel Notizen wie diese:
„Laut Geburtsurkunde bin ich in der Ukraine geboren, in Wirklichkeit aber am 21. Januar 1917 bei Samara, 860 Kilometer vor Moskau und immer noch ca. 2.000 km von Wolhynien, der Heimat meiner Eltern, entfernt. An einem Sonntag, als der Erste Weltkrieg und der Bürgerkrieg in Russland wütete.“
Ich denke an unser letztes gemeinsames Weihnachtsfest. Mama sah etwas müde aus, aber sie sang tapfer mit den Enkeln „Stille Nacht“ und „Jingle Bells“, trank einen Schluck Rotwein und lobte meine allweihnachtliche Ente.
Um uns Stress zu ersparen, haben wir schon vor ein paar Jahren entschieden, keine Weihnachtsgeschenke für Erwachsene zu machen, nur die kleinen Kinder dürfen sich auf sehr Ersehntes oder auch Überraschendes freuen. Mama bekam ausnahmsweise das in schönes, buntes Geschenkpapier eingewickelte Heimatbuch, das sie sich gewünscht hatte. Mit einem Mal hatte sie es sehr eilig, nach Hause zu gehen.
Nun weiß ich endgültig, warum. Sie wollte allein sein, in dem Buch stöbern und auf Spurensuche gehen. Und welch ein Zufall, sie ist dort ja auch fündig geworden.
Immer wieder verbringe ich Stunden mit der Lektüre der unterschiedlichen Hefte und einiger loser Blätter. Aus dem Puzzle ihrer Notizen wurden langsam Bilder und Geschichten, in denen ich meine Mutter in einem ganz neuen Licht sehe. Geschichten vor allem über Leben, Leiden und Leistungen von Frauen in einer schweren Zeit.
Ich entschließe mich, diese Geschichten zu ordnen, zu einer Erzählung des Lebens meiner Mutter werden zu lassen. Ich will versuchen, ihre Aufzeichnungen mit all dem zusammenzufügen, was ich von Mama und anderen über das Leben und Leiden der Deutschen und Deutschstämmigen in Russland in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erfahren habe.
Ich muss es einfach. Denn ich bin es ihr und mir schuldig, dass meine Kinder und Kindeskinder die Möglichkeit erhalten, ihre familiären Wurzeln kennenzulernen. Soll vergessen werden, woher wir kommen und unter welchen Bedingungen unsere Vorfahren gelebt haben?
Ich bin sicher, dass meine Mutter mich dabei unterstützt hätte. Das entnehme ich einer späten Notiz aus den Achtzigerjahren über die Todesnachricht ihrer in die USA ausgewanderten Cousine Katarina, die meine Mutter damals über das Rote Kreuz ausfindig gemacht hatte:
„Heute ist der Totenbrief von Katarina angekommen. Sie wird mir also die versprochene Kopie von Tante Almas Tagebuch nicht mehr schicken können. Ich hätte es gerne gelesen. Vielleicht hätte es mir Mut gemacht, das zu ordnen, was ich manchmal notiert habe, weil es mir gerade besonders wichtig war, weil ich mit etwas nicht zurechtkam oder auch, um mir Kummer von der Seele zu schreiben. Aber wie soll ich nach so vielen Jahren mein Leben rekonstruieren, Verbindungen herstellen, Unerklärliches nachträglich erklären?“
Anscheinend ließ es ihr keine Ruhe. Sie hat es auf ihre Art gemacht und ich werde versuchen, aus ihren Erzählungen und Notizen ihr Leben und das ihrer Familie zu rekonstruieren, als ob meine Mutter uns ihre Wünsche, Ängste und Gefühle selbst beschreiben würde. Als ob sie doch aus ihrem ungeschriebenen Tagebuch eine Autobiografie gefertigt hätte. Den Roman eines Lebens in schweren Zeiten – in Freud und Leid und mit dem unbändigen Willen, zu überleben und wenigstens ein kleines Stückchen Glück zu erhaschen. Selbst nicht mehr abgeschickte Briefe an ihre große Liebe sollen davon erzählen – und auch solche, die sie auf den Postweg zu Oscar gegeben hat, nicht wissend, ob sie ihn überhaupt erreichen konnten oder nicht.
Auch für das Leben meiner Mutter wichtige Erlebnisse anderer aus der Großfamilie und Beiträge aus deren Sicht werde ich dabei so aufnehmen, als ob diese es noch selbst erzählen könnten. Die Quellen dafür sind meine Gespräche mit ihnen oder das, was Mama mir über sie erzählt oder in ihren Aufzeichnungen hinterlassen hat. Sie werden auf den folgenden Seiten auch als Erzählende zu Wort kommen, neben meiner Mutter, die nun den Anfang macht.
Alma
Eduard, in der Familie Ed genannt, kann nicht schlafen. Ein kräftiger Januarsturm heult und pfeift durch die Ritzen des Pferdewagens. Morgen, bei Tageslicht, muss er die Undichtigkeiten in der Plane versiegeln. Auch die Pferde untersuchen und die Hufeisen fester annageln. Das kann er selbst machen, ohne einen Hufschmied suchen zu müssen. Das nötige Werkzeug dazu hat er sich besorgt. Und die Vorräte müssen inspiziert werden, alles soll noch für mehrere Wochen reichen. Ed versucht zu schätzen, wie lange sie schon unterwegs sind, seit sie in diesem Winter 1916 aus Sibirien aufgebrochen sind. Zwei Monate oder länger? Morgen wird er in seinem Kalender nachschauen und nachrechnen, wie lange sie noch bis zu ihrem Ziel brauchen.
Aus der Tiefe des Wagens dringt ein dumpfes Stöhnen seiner schwangeren Frau Emilia. Jetzt kommt es darauf an, rechtzeitig eine Hebamme zu finden. Seine Frau ist zäh, und es ist ihr drittes Kind, aber sie ist Mitte dreißig, nicht mehr die Jüngste. Sie ist tapfer, obwohl die Kälte und ihr schmerzender Rücken sie quälen.
Ed schaut in die Ecke, wo seine beiden Söhne schlafen. Der große, Edmund genannt, ist acht, kerngesund und kräftig. Er hilft Ed schon bei der Arbeit, kann auch die Pferde lenken, wenn Ed die Augen vor Anstrengung zufallen wollen. Aber der Kleine, Reinhard, bereitet ihm Kummer. Er hat gerade eine schlimme Krankheit überstanden. Die Reise über mehrere Monate in einem Pferdewagen durch das wilde kalte Russland zehrt an allen. Für Reinhard schien es bis vor einigen Tagen noch die letzte Reise zu sein.
Das setzt Ed zu, er fragt sich oft, ob es ein Fehler gewesen war, die Reise trotz der Schwangerschaft seiner Frau und der winterlichen Temperaturen anzutreten. Aber zwei Jahre sibirische Verbannung hatten ihn angetrieben: Ihm fehlt die Heimat mit ihren Wäldern und dem guten Klima, auch der Kontakt zu den Verwandten und Freunden, die durch glückliche Fügung nicht deportiert worden waren und zu Hause bleiben konnten.
Eds Gedanken wandern zurück nach Sibirien, zurück ins Jahr 1915, als die russische Regierung ihrer Deportation dorthin eine gesetzliche Grundlage gegeben hatte.
Damals hatten die Feindseligkeiten gegen die Deutschen in der Ukraine während des Krieges ihren Höhepunkt gefunden. Sie wurden zwangsenteignet und weit ins Landesinnere vertrieben. Man unterstellte ihnen, sich mit der vorrückenden Armee des Deutschen Reichs zu solidarisieren und zu verbünden. Dabei hatten sie in allen Zeiten dem Zaren die Treue gehalten. Aber in Kriegszeiten misstraute der Staat den Deutschen und ihrer Loyalität.
Schon bei der Ankunft gab es viele Probleme bei der Unterbringung der Verbannten. Es wurden eigene Unterkünfte für sie eingerichtet, was die dortige Bevölkerung ganz und gar nicht begeisterte. Es war ein bescheidenes Leben, und diejenigen, die keine Zimmer bekommen hatten, waren sogar gezwungen, Erdhütten als Notunterkunft zu bauen.
Die Erdhütten waren kuppelförmige und etwas in den Boden eingelassene provisorische Häuser, deren Gewölbegerüst mit Weidezweigen, Gras und Erde abgedeckt wurde. Manche Familien mussten mehrere Monate in dieser Dunkelheit und Feuchtigkeit hausen, bis sie eine einigermaßen normale Wohnung beziehen konnten. Glücklicherweise fand Ed ein Zimmer bei einer freundlichen Familie.
Aber das Schwierigste war, in dieser Gegend eine Arbeit zu finden, mit der die Familie ernährt werden konnte. Die meisten Deportierten waren Bauern, Weber oder Schumacher. Frauen versuchten es mit Schneidern und Sprach- oder Musikunterricht.
Ed bewarb sich im Frühjahr bei den Dorfbewohnern als Zeitarbeiter, um Lebensmittel zu verdienen. Doch die einheimischen Bauern waren auch nicht reicher als die Verbannten. Ausgebeutet durch hohe Steuern, fehlten vielen die richtigen Geräte für die Bearbeitung des Bodens für die Ernte. Auch Zugtiere, Pferde, Ochsen oder Kühe für die schwerste Arbeit waren Mangelware.
Ed musste in dieser Zeit erfinderisch sein. Er besuchte mit dem Pferd die umliegenden Dörfer und bot seine Dienste an. Die Witwen und Frauen, deren Männer an der Front kämpften, freuten sich, wenn er im Dorf erschien. Sie baten ihn, das zu reparieren, was sie nicht selbst erledigen konnten. Einen Pflug oder eine alte Uhr, und Ed war es gleich, was zu reparieren war. Wichtig war nur, dass er dafür Milch, Eier, Speck und Gemüse bekam. So wurde die Familie versorgt. Als er bald ein leichtes Wägelchen selbst gebaut hatte und die Familie zu seinen Ausflügen mitnehmen konnte, wunderte sich meine Mutter, wie groß sein Kundenstamm geworden war. Das waren überwiegend junge, hübsche und liebebedürftige Frauen. Mit gespielter Eifersucht fragte Emilia ihren Mann, ob sie sich Sorgen machen müsse, dass er sich hier womöglich eine Bäuerin suche und bleiben wolle. Ansonsten gab es aber nicht viel zu lachen.
Als sich Ende 1916 herumgesprochen hatte, dass die Regierung plante, Diskriminierungen zu mildern und die Deportierten in ihre Heimat zurückkehren zu lassen, wollte Ed die Gelegenheit ergreifen. Zwar hatte ihn Alma, seine Cousine aus Amerika, in ihren Briefen vor einer Rückkehr gewarnt, und er selbst ahnte, dass sein zurückgelassenes Hab und Gut wohl längst unter Russen und Ukrainern verteilt, verschenkt oder verpachtet worden war und ihn keine Entschädigung erwartete. Aber Ed wollte trotzdem zurück in die Ukraine.
Auch als seine Frau ihn bat, lieber Russland ganz zu verlassen, egal wohin, ob Deutschland, Kanada oder die USA, ließ er sich nicht umstimmen. Er wollte auf jeden Fall zuerst nach Hause, eine Ausreise ohne behördliche Genehmigung kam für ihn nicht infrage. Schon angesichts der Gefahr, wegen illegalem Grenzübertritt erneut nach Sibirien deportiert zu werden.
Da hatte ihm seine Frau zugestimmt, aber sie war fest entschlossen, dieses Land, in dem sie Fremde geworden waren und herumgeschubst wurden, nicht mehr als ihre Heimat zu betrachten. Für sie war die sibirische Verbannung ein Albtraum gewesen.
Ed wollte gleich den Winter über die Gunst der Stunde zur Rückkehr in die Ukraine nutzen. Sie kämen dann leichter voran als zu jeder anderen Jahreszeit, wenn alle Wege durch Russland und die Ukraine zu Matsch werden, falls es ein paar Tage regnet und die Pferde und Wagen im Schlamm versinken.
Mit dieser Entscheidung sollte er großes Glück haben, denn schon bald, im Juli 1917, verschärfte sich die Lage wieder. Die Regierung wollte verhindern, die Deutschrussen in den Westen Russlands heimkehren zu lassen, wo sie sich in der Nähe von Frontlinien befinden würden. Sie könnten sich mit dem Feind verbünden und dem Vaterland schaden. Wer das Zeitfenster bis dahin verpasst hatte, blieb für sehr lange Zeit in Sibirien, wenn nicht sogar für immer.
Ed schaffte ein zweites Pferd und einen Schlitten an. Mit Plane überdacht, bot der Pferdewagen einen guten Schutz gegen Wind und Schnee. Alles, was die Familie für den weiten Weg brauchen würde, verstaute er in Holzkisten, die er an den beiden Wagenseiten anbaute. Während die Familie schlief, saß er nächtelang am Tisch bei Kerzenlicht und rechnete und grübelte, wie lange sie für die etwa 2.500 Kilometer brauchen würden. Pferde können 60 km pro Tag schaffen, je nachdem, ob sie im lockeren oder schnellen Trab laufen. Sie mussten Übernachtungen einplanen, die Geld kosten würden. Oder Lebensmittel: Speck, Honig, Korn, Käse, Nüsse und getrocknetes Obst. Alles wurde durchdacht und geplant. Nach Berechnungen der Frau sollte ihr Kind im Februar kommen. Bis dahin könnten sie bei gutem Vorankommen fast zu Hause sein.
Mit gutem Gefühl zogen sie los, in der Hoffnung, dass niemand krank würde. Aber ausgerechnet das passierte.
Reinhardt wurde krank. Er hatte Durchfall, hörte auf zu essen und bekam Fieber. Ganz still lag er in seiner Schlafecke und schaute mit leerem Blick in den Himmel. Mit schwerem Herzen kaufte Ed vorsorglich Bretter: Wenn es so weit wäre, wollte er selbst einen Sarg bauen. Doch solange noch Hoffnung bestand, taten sie alles, um ihren Sohn am Leben zu halten.
Bei dem Gedanken an seinen Kleinen schreckt Ed aus seinen Erinnerungen auf und sieht nach ihm. Reinhard schläft tief und fest, sein Atem geht ruhig. Seit zwei Tagen hat er kein Fieber mehr und gestern mit Appetit von den am Schwarzmarkt organisierten Salzheringen gegessen. Ed ist voller Zuversicht, sein Sohn scheint über den Berg zu sein, und sie werden es schaffen, ganz bestimmt. Gott wird ihnen beistehen.
Ed schiebt den Vorhang etwas zur Seite. Sogleich fährt ihm der Schnee schmerzhaft ins Gesicht. Der Wind hat zugenommen und pfeift nun in hohen Tönen. Himmel und Erde sind eine Schneewand. An einem etwa fünfzig Meter entfernten Kirchturm schlägt die Uhr fünf.
Beim ersten Tageslicht werden die Kinder wach, sie machen eine Essenspause. Ed schließt den Vorhang wieder und schläft ein. Sein Sohn übernimmt die Zügel, und es geht weiter. Der neue Tag beginnt heiter. Das nächtliche Schneetreiben beruhigt sich und die Sonne zeigt sich zaghaft am Horizont.
Es wird ein besonderer Tag. Das ständige Rütteln, die Kälte und Aufregung beschleunigen die Wehen bei Eds Frau. Trotz allem erreicht die Familie rechtzeitig ein Krankenhaus. Ein Mädchen erblickt etwas früher als geplant die Welt. Ein älterer Arzt hält Ed ein winziges, mit glitschigem Schleim bedecktes Mädchen hin. Er drückt seine Lippen an ihr Köpfchen und atmet erleichtert auf. Es ist das schönste Kind, das er je gesehen hat. Sofort verliebt in das kleine Wesen blickt der stolze Vater sein Mädchen an und flüstert ihm zärtlich zu: „Ich werde dich Alma nennen, nach deiner Großcousine.“
2
Das kleine Mädchen in Eds Händen ist meine Mutter Alma. Herauszufinden, wer ihre Großcousine gleichen Namens war und warum mein Opa Ed seine Tochter nach ihr nannte, war nicht einfach. Aber Mamas Notizen aus dem Holzkistchen und auch Hinweise dort auf mir unbekannte Menschen ließen mich in eine andere Zeit und Welt eintauchen. Wer zum Beispiel war Katarina?
Ich lasse sie als erste Nebenerzählerin zu Wort kommen. Sie stellt uns in ihrem Bericht ihre Mutter Alma, Mamas Großcousine, vor. Die Frau, für die mein Großvater Eduard als Jugendlicher so sehr schwärmte und die daher zur Namenspatin meiner Mutter wurde.
Katarina
Ich war ein Kuckuckskind. Es war ein recht schlechter Start für das Leben, wenn man bedenkt, dass ich Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts geboren wurde. Die ersten Autos eroberten die Straßen. Start des ersten deutschen Zeppelins und die rasante Entwicklung des Telefons. Und ich hätte das alles beinahe nicht erleben dürfen, weil ich nicht aus ehelicher Zeugung stammte. Jeglicher Schwangerschaftsabbruch war verboten, aber verzweifelte schwangere Frauen gingen zum Pfuscher und ließen ihre Leibesfrucht beseitigen. Viele der Frauen starben nach dem Eingriff an Infektionen, weil auf Hygiene bei den „Engelmachern“ oft wenig Wert gelegt wurde.
Zum Glück war meine Mutter Alma die Lieblingstochter von Opa Hinrich. Das kam ihr zugute. Er konnte seine Tochter nicht in der Gosse verenden lassen. Er war ihr – und damit auch mein – Retter. Für Tante Matilde, Almas jüngere Schwester, sah die Sache allerdings ganz anders aus. Sie hasste es, wenn die Eltern Alma bevorzugten und verwöhnten.
Später, als ich schon längst erwachsen war, beschrieb uns Oma Theresia, Opa Hinrichs Frau, eine unschöne Szene, die sie im Kreise der Familie erleben musste:
„Als Opa Hinrich wieder mal davon schwärmte, dass Alma so begabt, dazu ein hübscher, einfach reizender Engel und sein Ein und Alles sei, wurde Matilde wütend. Besonders, als er dann auch noch zustimmend erwähnte, Alma sei als junge Frau nicht nur eine gute Reiterin, sondern auch eine prachtvolle Tänzerin gewesen, da war Matildes Geduld zu Ende.
Sie beschimpfte Alma als ein schlimmes, verzogenes, wildes Ding, das besser gleich ihren späteren Mann Max geheiratet hätte, anstatt erst ihre Träume und Illusionen auszuleben. Alma sei alles andere als ein Engel, auch wenn sie so aussähe und alle entzückt von ihr wären. Sie habe als jüngere Schwester Papas Liebling ganz anders erlebt. Gelitten habe sie unter ihr, vor dem ständigen abschätzigen Spott über ihre Pummeligkeit.
Opa Hinrich, wütend über diesen Ausbruch seiner jüngeren Tochter, suchte noch nach Worten, als Mathilde erregt nachlegte. Ihn verächtlich danach befragte, was Alma denn den Eltern beschert habe, und die Frage gleich selbst beantwortete.
Ein Kuckuckskind habe sie ihrem Max untergeschoben! Und dann sei sie nach Amerika abgehauen, ohne sich um die Eltern zu kümmern!
Diese Szene habe sich tief in ihr Gedächtnis eingegraben, versicherte Oma Theresia mir, sie habe Mathildes Ausbruch nie vergessen können.
Ich weiß auch, dass es Mathilde maßlos ärgerte, wie wenig Max, mein offizieller Vater, an der Wahrheit interessiert war. Max, fünfzehn Jahre älter als Alma, hatte aus dem Krieg ein steifes linkes Bein mitgebracht. Er war ein brillanter Briefverfasser, romantisch und sehr vermögend. Ob es seine vielen leidenschaftlichen Briefe in dunkelvioletter Tinte, die wie Blut aussah, waren, die meine Mutter dazu bewegt haben, ihn zu heiraten, oder sein Vermögen, hat meine Mutter nie erwähnt. Doch sie blieb bis zu seinem Tod an Max‘ Seite.
Womöglich war es ihre klügste Entscheidung überhaupt, als ihre Wespentaille von Tag zu Tag fülliger und Mahnungen der Eltern immer lauter wurden, die Ehre der Familie nicht zu beschmutzen. Aber Max war überglücklich, seine große Liebe heiraten zu können. Und dazu bekam er eine entzückende kleine Tochter. Sobald er die Angst überwunden hatte, mich behutsam in seinen Armen zu halten, um mich nicht zu zerquetschen, verwöhnte er mich maßlos.
Ich liebte ihn innig.
Alma
Das erste Mal hatte ich von meiner Namensvetterin Alma gehört, als ich fünf war. Mein Vater zeigte mir ein kleines Foto von meiner Großcousine; das einzige, das er besaß. Er strich zärtlich über die vergilbte, rissige Oberfläche und bedauerte, dass es nicht das beste Foto von ihr sei, denn sie wäre viel hübscher gewesen, mit schmaler und schlanker Taille und kastanienbraunem Haar. Ich wunderte mich sehr, dass er so liebevoll von ihr sprach. Warum hatte er seine zwei Jahre ältere Cousine so gut in Erinnerung behalten? Als sei es erst gestern gewesen, dass er sie das einzige Mal gesehen hatte. Damals, als er sich mit seinen 15 Jahren, fast noch ein Kind, hoffnungslos in sie verliebte.
Er wirkte glücklich und unbeschwert, während er von diesem zauberhaften Sommer auf dem Landgut seiner Tante Theresia erzählte. Meine Schwestern und ich saßen still und lauschten gebannt den Geschichten aus der Vergangenheit, als Mädchen und junge Frauen noch Kleider aus Seide und Atlas trugen, sich in Musik und Tanz übten und Pferde mit einem Sattel ritten.
„Ich möchte auch so schön sein und solche hübschen Kleider tragen“, rutschte mir heraus.
Aber ... „Schönheit vergeht!“, unterbrach mich meine Mutter und strich meine Wange. Vater schien uns nicht zu hören, er steckte tief in seinen Erinnerungen. Mit einem Hauch von Ironie über sich und seine damaligen Gefühle fuhr er fort zu erzählen.
Ed
Ich war so verliebt in Alma, dass es mir das Herz zerriss, als ich sah, wie sie allen Männern den Kopf verdrehte. Sie liefen ihr überall nach und bettelten um den ersten Tanz oder um das Recht, ihr aus dem Sattel zu helfen. Mich mochte sie auch; gewiss, aber nicht so, wie ich es gerne gehabt hätte. Sie knuddelte mich wie ein Kind, wuschelte meine Haare durch und gab mir unschuldige Küsschen auf die Wangen. Sie spielte gut Klavier und ermutigte mich, sie mit meiner Klarinette zu begleiten, die ich schon seit zwei Jahren übte. Ed, sagte sie zu mir, du hast Talent. Du solltest unbedingt Musiker werden! Und ich bildete mir ein, dass ich mit achtzehn ein bekannter Musiker sein würde und Alma heiratete. Wie naiv war ich!
Alma
Vater strich das Foto mit flacher Hand, so, als ob er die Kränkung und die Enttäuschung wegwischen wollte. Ich saß aufgewühlt da, und als Vater das Foto in die Schachtel zurücklegen und aufstehen wollte, streckte ich ihm meine Hand entgegen. „Was ist mit Alma weiter passiert, Vater? Erzähl mir bitte!“
„Es ist schon spät, mein Kind. Geh schlafen.“ Er lächelte mir zu, strich über meine langen hellbraunen Haare und sagte sanft: „Ich habe dich nach ihr genannt, Alma. Du siehst ihr sehr ähnlich.“
Plötzlich sah er müde und besorgt aus. Später erinnerte ich mich oft an diesen Moment. Fürchtete er, dass ich nicht nur äußerlich Alma glich, und das bereitete ihm Kummer? Aber warum? Welche Geheimnisse steckten dahinter? Ich dachte oft an sie und träumte nachts von dieser ungewöhnlichen Frau auf Vaters Bild. Weil ich ihn immer wieder nach Alma fragte, erzählte er uns an einem anderen Abend weiter.
Ed
Meine Großcousine Alma lebte mit ihren Eltern in Deutschland. Ihre Mutter, meine Großtante, hatte das Glück, einen Großgrundbesitzer zu heiraten, der in Mecklenburg-Vorpommern größere Ländereien von Bauern aufgekauft hatte und dann an sie weiter verpachtete. So wurde sein Gut größer und größer. Kaum ein Bauer schaffte es, die hohe Pacht zu bezahlen. So versuchten viele ihr Glück als Auswanderer. So wie wir nach Russland zogen.
Uns ging es in Wolhynien nicht schlecht. Das Zarenreich warb um Auswanderer aus Deutschland. Wir hatten viel Land von der russischen Regierung bekommen, Bankkredite für die Anschaffung notwendiger Güter, und das alles steuerfrei. Die Männer waren vom Militärdienst befreit und wir genossen unser deutsches Schul- und Finanzsystem. Aber im Vergleich zu Almas Familie waren wir längst nicht so wohlhabend. Mein Vater führte auch eine Landwirtschaft, musste aber selbst Hand anlegen, auf dem Feld oder auch in der Werkstatt, um die Familie zu ernähren. Ich durfte, wie meine Brüder auch, zur Schule gehen. Aber nachmittags leisteten wir unsere Arbeitsstunden, wo auch immer wir gebraucht wurden.
Als ich mit der Schule fertig war, hat mein Vater mir als Belohnung eine Sommerreise zum Gut seiner Schwester Theresia in Deutschland geschenkt. Er wollte den Kontakt zu seinen Geschwistern aufrechterhalten, wenigstens zu denjenigen, die nicht nach Übersee ausgewandert waren. Für mich wurde ein richtiger Anzug beim Schneider bestellt, weiße Hemden und Taschentücher mit Monogramm, und Mama übte mit mir Tischmanieren.
Ich fühlte mich großartig. Vor der Abreise konnte ich kaum schlafen. Ich malte mir eine ganz andere Welt aus, als ich sie kannte und war überzeugt, dass ich dort großartige Abenteuer erleben würde.
Als ich nach langer Fahrt mit Pferdewagen und der Bahn von einer blendend aussehenden jungen Frau mit einer hellbraunen Lockenpracht und breitem Lachen auf dem runden Gesicht empfangen wurde, wusste ich gleich, dass ich mit meiner Vermutung recht hatte. Ich würde auf dem Landgut meiner Tante mit Alma sicherlich einiges erleben können.
Winkend lief sie auf mich zu und rief: „Du musst Ed sein! Ich bin Alma, deine Cousine!“ Bis dahin nannte mich keiner Ed, alle nur Eduard. Aus ihrem Mund klang es so locker und niedlich, dass ich mich gleich verzaubert füllte. Ich stand wie angewurzelt am Bahngleis, und sie musste mich lachend wachrütteln.
„Nun komm schon, wir werden erwartet!“ Nur zu gerne ergriff ich mein abgestelltes Gepäck und ließ mich von ihr vom Bahnsteig leiten.
Alma
Drei Monate blieb mein Vater auf dem Gut seiner Tante, jeden Tag dachte er schweren Herzens an seine Heimkehr. Es war alles so aufregend dort – wie auf einem anderen Planeten. Das Haus war immer voller Gäste: junge Männer der Militärakademie in der Nähe und Almas Freundinnen und Geschwister. Fast jeden Abend erlebte er Gesang und Vorlesungen von für ihn damals völlig unbekannten Personen, es klirrten Weingläser und Kaffeetassen, und in allen Ecken wurde gelacht und diskutiert. Und mittendrin Eds Schwarm Alma. Sie wurde nicht müde zu tanzen, zu spielen oder um die Wette zu rennen. Seine Tante Theresia und Onkel Hinrich saßen in ihren gemütlichen Sesseln und genossen den Trubel.
Nachdem mein Vater abgereist war, fand ein reger Schriftverkehr zwischen den beiden statt. Alma berichtete, dass sie trotz Weigerung der Familie angefangen habe, einen kaufmännischen Beruf zu erlernen. Sie hatte sich von anderen emanzipierten Mädchen von deren Ideen anstecken lassen: Frauen sollen frei sein, frei von der Familie und frei von einem Ehemann, der sie belehren und zurechtweisen konnte. Unabhängige Frauen wollten sie sein! Davon schwärmte sie.
Ed war von solchen Ideen nicht besonders begeistert,
schließlich wollte er Alma heiraten, irgendwann. Aber schon bald blieben ihre Briefe aus. Unermüdlich schrieb er ihr jede Woche, aber sie antwortete nicht.
Später erfuhr er, was damals passiert war. Almas Erwartungen an ein freies und unabhängiges Leben scheiterten an einer unglücklichen Liebe. Gefühlvoll, wie sie war, verliebte sie sich in einen Poeten, der sie mit seinen Gedichten berauschte und verführte. In ihrer Ahnungslosigkeit vom richtigen Leben war sie von zu Hause fortgelaufen, um ihren Traum von einem freien Leben mit einem Künstler zu verwirklichen.
Diese Entdeckungsreise dauerte nur einen Monat, dann verabschiedete sich ihr Held von ihr und wanderte nach Amerika aus. Er fragte sie nicht einmal, ob sie mitkommen wolle. Und sie hatte geglaubt, ihr Leben habe gerade angefangen. Nun saß sie in seiner kleinen, schmuddeligen und mit hunderten von Büchern und Manuskripten vollgestopften Wohnung, in die jeden Abend zahlreiche Freunde kamen, um zu diskutieren, zu streiten und Zukunftspläne zu schmieden.
Im Nachhinein konnte sie sich und ihrer Familie nicht erklären, was ihr geschah. Statt die Freiheit zu erlangen und dem Familienzwang zu entkommen, kehrte sie zurück ins traute Heim, krank und schwanger. Sie ließ sich von Max, einem langjährigen Verehrer, ehelichen und gab sich selbst das Versprechen, sich künftig keine falschen Hoffnungen mehr zu machen. Max hatte sie vergöttert, seit sie ein kleines Mädchen war, und sie fühlte sich geborgen bei ihm. Katarina blieb ihre einzige Tochter, geliebt und verhätschelt.
Kurz nach dem Beginn des Ersten Weltkrieges wurde Almas Mann krank und starb ziemlich schnell. Vorher nahm er Alma ein Versprechen ab. Sie solle mit Katarina nach Amerika auswandern, wo sein Bruder lebte. In Deutschland würden dunkle Zeiten anbrechen, warnte er sie. 1915 brach Alma mit ihrer Tochter nach Amerika auf und schrieb gleich nach ihrer Ankunft an meinen Vater einen kurzen Brief.
„Lieber Ed, wir sind Gott sei Dank gesund und unbeschadet in Amerika angekommen. Vorher mussten wir noch wochenlang im Hamburger Hafen in einer Halle ausharren. Die Ausstellung von Auswanderungspapieren dauerte eine Ewigkeit. Dank unserer Ersparnisse konnten wir uns ein Hotelzimmer und den Restaurantbesuch leisten. Viel Bammel hat mir der Gesundheitstest beschert. Katarina war erkältet und hustete nachts sehr stark. Ich fand einen Arzt und zahlte ihm ein Vermögen, damit er sie in einer Woche gesund pflegte. Aber unterwegs wurde sie wieder krank, diesmal seekrank. Lieber Ed, ich denke oft an die Tage, als du uns auf unserem Gut besucht hast. Wie glücklich und unbeschwert wir waren! Und wie jung! Wie geht es dir in deiner unruhigen Heimat? Ich lese jeden Tag Zeitungen, und die besagen nichts Gutes: Die Deutschen sind in Russland in Ungnade gefallen. Wenn du die Möglichkeit hast, wandere bitte mit deiner Familie in die USA aus. Ich werde dir helfen, wo ich kann. Deine Alma.“