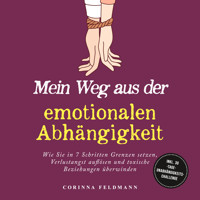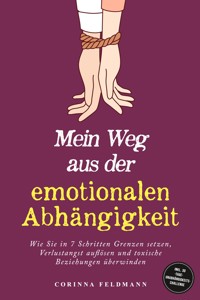
Mein Weg aus der emotionalen Abhängigkeit: Wie Sie in 7 Schritten Grenzen setzen, Verlustangst auflösen und toxische Beziehungen überwinden - inkl. 30-Tage-Unabhängigkeits-Challenge E-Book
Corinna Feldmann
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ONIX Media
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Emotionale Unabhängigkeit: Mechanismen und Dynamiken emotionaler Abhängigkeit erkennen, verstehen und mit sofort anwendbaren Praxisstrategien langfristig bekämpfen Kommt Ihnen öfter der Gedanke, dass Sie innerhalb einer Beziehung nicht auf Augenhöhe sind? Ob Eltern, Ehepartner oder Kind, ein Leben ohne diesen Beziehungspartner können Sie sich unmöglich vorstellen? Zweifel, Ängste und Unsicherheiten prägen den Alltag in dieser Verbindung? Dann sollten Sie sich unbedingt mit dem Thema der "emotionalen Abhängigkeit" auseinandersetzen, und dieser Ratgeber macht Ihnen den Schritt leicht! Unterordnung eigener Wünsche, Fixierung auf den Partner, andauernde Verlustängste, Kontrollverhalten und schlechtes Selbstwertgefühl: Wer von einem Menschen – ob Partner, Mutter oder Sohn – abhängig ist, lebt in einer Beziehung, die von dauernder Anspannung geprägt ist. Die langfristigen seelischen Folgen können gravierend sein, doch das müssen Sie nicht hinnehmen: Denn Sie können sich Schritt für Schritt erfolgreich aus dieser Abhängigkeit befreien, und dieses Buch zeigt Ihnen den Weg. Machen Sie sich zunächst einfühlsam, verständlich und klar mit Merkmalen und Dynamiken emotionaler Abhängigkeit vertraut, um anschließend aktiv zu werden: Mit einer Vielzahl an Übungen, Reflexionen und Techniken entlang von 7 Schritten wie Erkenntnisgewinn, Grenzsetzung oder Selbstwertgefühl bauen Sie ein stabiles Fundament für eine emotional unabhängige Persönlichkeit auf. Ganz alleine? Aber ja! Denn dieser Ratgeber ist gezielt für die unkomplizierte Selbsthilfe geschrieben und passt dank kurzer Übungen und klarer Anleitungen problemlos auch in einen stressigen Alltag. Grundkurs emotionale Abhängigkeit: Erfahren Sie kompakt und verständlich alles, was Sie rund um Entstehung, Symptome, Dynamiken sowie Auswirkungen emotionaler Abhängigkeit wissen müssen, und werden Sie in kürzester Zeit zum Experten. 7 Schritte in die Freiheit: Finden Sie heraus, wie Sie anhand von 7 Schlüsselfaktoren wie Selbstwertgefühl, Emotionskontrolle, Konfliktkompetenz oder Grenzsetzung zu einem stabilen Persönlichkeitsfundament gelangen. Jede Menge Praxis: Journaling-Methoden, Reflexionen, Meditationen, Gedankenübungen oder Gesprächstechniken – entdecken Sie einen bunten Strauß an vielfältigen Strategien, mit denen Sie unverzichtbare Fähigkeiten effektiv und langfristig einüben können. Bonus: 30-Tage-Challenge: Mit einem zusätzlich sorgfältig erstellten 30-Tage-Plan inkl. präziser Anleitungen steigen Sie noch schneller ein und erleben schon bald beeindruckende Veränderungen. Mit diesem Ratgeber sprengen Sie die Ketten Ihrer emotionalen Abhängigkeit und werden bereit für Beziehungen in Freiheit und auf Augenhöhe. Ob Sie in einer problematischen Beziehung stecken, grundsätzlich Schwierigkeiten mit Unabhängigkeit haben oder einfach Ihre Situation besser einschätzen möchten – hier finden Sie Orientierung und Praxisanleitung. Also worauf warten Sie noch? Klicken Sie nun auf "Jetzt kaufen mit 1-Click" und freuen Sie sich auf das einzigartige Gefühl glücklicher, vertrauensvoller und stabiler Beziehungen auf Augenhöhe!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alle Ratschläge in diesem Buch wurden vom Autor und vom Verlag sorgfältig erwogen und geprüft. Eine Garantie kann dennoch nicht übernommen werden. Eine Haftung des Autors beziehungsweise des Verlags für jegliche Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist daher ausgeschlossen.
Copyright © 2025 www.edition-lunerion.de
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Fragen und Anregungen:
Auflage 2025
Inhalt
Emotionale Unabhängigkeit
Ihre Reise beginnt
Rahmen klären und Hintergründe verstehen
Was ist emotionale Abhängigkeit?
Psychologische Mechanismen der emotionalen Abhängigkeit
Bindungstheorie nach John Bowlby
Selbstwertkontingenz
Angst vor Verlassenwerden
Co-Abhängigkeit
Mangelnde Selbstregulationsfähigkeiten
Negative Glaubenssätze
Autonomieverlust
Unsicherheit und Selbstzweifel
Symptome und Auswirkungen emotionaler Abhängigkeit
Bin ich emotional abhängig?
Emotionale Unabhängigkeit als Ziel
Schritt 1 – Erkenntnis: Der erste Schritt zur Freiheit
Erste Überlegungen
Emotionale Auslöser erkennen
Selbstreflexion durch Fragen: 5-Warum-Methode
Glaubenssätze identifizieren und transformieren
Journaling als Werkzeug
Schritt 2: Stärken Sie Ihr Selbstwertgefühl: Wer bin ich wirklich?
Positive Affirmationen entwickeln
Erfolgstagebuch führen
Selbstmitgefühl erkunden
Selbstliebe-Rituale etablieren
Schritt 3: Grenzen setzen: Mut zum “nein”
Personen aufstellen
Spurensuche: Wo werden Grenzen verletzt?
Grenzen einfordern üben – Teil 1
Grenzen einfordern üben – Teil 2
Nein sagen üben
Bedürfnisse kommunizieren
Grenzen stärken durch Visualisierung
Schritt 4: Emotionen in die eigene Hand nehmen
Achtsamkeit üben
Verantwortung für Gefühle übernehmen
Schritt 5: Allein sein lernen: Ihr bester Begleiter sind Sie
Zeit alleine bewusst verbringen
Allein sein als Chance
Selbstgespräche führen
Schritt 6: Entscheidungen treffen: Was will ich wirklich?
Bauchgefühl trainieren
Entscheidungen in kleinen Schritten üben
Bewusst entscheiden und Konsequenzen akzeptieren
Schritt 7: Konflikte meistern: Offen und stark kommunizieren
Konflikte nicht scheuen
Ich-Botschaften anwenden
Emotionale Gelassenheit bewahren
Bonus: 30-Tage-Challenge zur emotionalen Unabhängigkeit
Woche 1: Selbsterkenntnis und Selbstwert aufbauen
Woche 2: Grenzen setzen und Emotionen regulieren
Woche 3: Allein sein & Entscheidungsfähigkeit
Woche 4: Konflikte konstruktiv meistern
Hindernisse überwinden und unbequeme Pfade gehen
Emotionale Unabhängigkeit
Ihre Reise beginnt
Wenn Sie dieses Buch in den Händen halten, zuerst einmal: „Herzlichen Glückwunsch!“ Denn es bedeutet nichts weniger, als dass Sie erkannt haben, dass Sie ein Problem haben – und dass Sie den Willen haben, das zu ändern. Möglicherweise sind Sie auch noch nicht so klar in Ihrer Überzeugung, sondern verspüren zunächst eher eine Ahnung davon, dass in Ihrem Empfinden etwas liegen könnte, das eigentlich nicht gesund für Sie ist. Vielleicht haben auch Freunde oder eine andere nahestehende Person Sie darauf angesprochen und Sie ins Grübeln gebracht. Ganz egal, wie, der erste und wichtigste Schritt ist gemacht: Einmal den fragenden Blick auf sich selbst richten und kritisch zu überlegen: „Könnte da vielleicht etwas dran sein?“
Das „da“ bedeutet in diesem Fall: Emotionale Abhängigkeit. Ein weiterer Begriff, der in den letzten Jahren in Magazinen, Blogbeiträgen und Foren einerseits zum Modewort geworden ist, andererseits den Blick auf ein ernstes Problem richtet. Denn wer in emotionaler Abhängigkeit lebt, der richtet seine ganze Existenz nach einem Anderen aus und versagt sich die Möglichkeit, selbst zu einem stabilen, glücklichen und selbstbewussten Menschen heranzuwachsen, der sein Leben nach den eigenen Wünschen, Träumen und Bedürfnissen gestaltet. Das Thema ist also so drängend wie sensibel und dazu noch alles andere als einfach: Wo sind die Grenzen zu gesunder Liebe zu ziehen? Wer kann das überhaupt beurteilen? Was, wenn sich über die Jahre und Jahrzehnte destruktive Muster eingeschliffen haben, die vor der Außenwelt sorgsam verborgen werden? Wie kann man eine solche Abhängigkeit vor sich selbst eingestehen? Und schließlich: Was kann man dann überhaupt tun?
Die Antworten auf diese und viele weitere Fragen liegen vor Ihnen. Dieses Buch führt Sie einfühlsam und kompetent in das Thema ein und nimmt mit Sachinformationen Ängste, Scham- und Schuldgefühle. Gemeinsam mit Ihnen macht es sich auf die Suche nach den Ursachen für Ihre emotionale Abhängigkeit und hilft Ihnen, zu verstehen, welche Entwicklungen dabei eine Rolle gespielt haben. Und dann packen Sie es gemeinsam an: In sieben Schritten befreien Sie sich Stück für Stück aus der Abhängigkeit und zerreißen die Fesseln, mit denen Sie sich so lange selbst gebunden haben. Dabei liegt der Fokus ganz klar auf der Praxis: Übungen, Reflexionsanleitungen, Meditationen, Strategien und viele weitere einfach umzusetzende Maßnahmen zeigen Ihnen einen konkreten Weg hin zu einem selbstbestimmten, bewussten und erfüllten Leben, in dem Sie endlich gesunde Beziehungen erfahren können – und sich vor allem selbst genug sind. Überzeugt? Dann gehen Sie es an! Und keine Sorge: Ihre Entwicklung, Ihr Tempo – dieser Ratgeber holt Sie genau dort ab, wo Sie stehen und lässt Sie im Rahmen Ihrer Möglichkeiten genauso rasch voranschreiten, wie es Ihnen guttut. Und wenn Ihnen zwischendurch einmal Zweifel kommen, blättern Sie einfach noch einmal hierher zurück und erinnern Sie sich daran, weshalb Sie diese Reise begonnen haben. Sie sind stärker, als Sie denken – trauen Sie sich, das herauszufinden und haben Sie den Mut, Ihrem Leben eine ganz neue Richtung zu geben!
Rahmen klären und Hintergründe verstehen
Ganz am Anfang Ihrer Reise steht die Erkenntnis. Das bedeutet zunächst einmal, ein sachliches und klares Bild davon zu bekommen, worum es bei emotionaler Abhängigkeit eigentlich geht und Fakten von Halbwissen und Küchentischpsychologie zu trennen.
Was ist emotionale Abhängigkeit?
Die grundlegende Frage ganz zu Beginn: Emotionale Abhängigkeit, was ist das eigentlich? Bevor Sie tiefer in einzelne Aspekte und zugrundeliegende Mechanismen einsteigen, lässt sich diese wichtige Frage überblicksartig schon einmal recht gut klären.
Emotionale Abhängigkeit beschreibt die übertrieben starke emotionale Bindung an eine andere Person. So knapp und simpel lässt sich das Phänomen zusammenfassen, doch schon ein weiterer Blick zeigt, dass es alles andere als einfach ist. Deshalb Schritt für Schritt: Wer emotional abhängig ist, entwickelt eine ausgeprägte Hingabe, eine außergewöhnlich starke Beziehung zu einem anderen Menschen. Meistens ist das der Partner in einer romantischen Beziehung, doch das ist nicht zwangsläufig der Fall. Ebenso können beispielsweise Elternteile in emotionale Abhängigkeit zu ihrem Kind geraten oder umgekehrt. Trotzdem drehen sich die meisten Fälle der emotionalen Abhängigkeit um Partnerschaften, möglicherweise auch, weil hier Abhängigkeit und Ungleichgewicht deutlicher zutage treten und schneller konkrete Probleme schaffen als etwa die emotionale Abhängigkeit eines Sohnes von seiner Mutter. In der Eltern-Kind-Konstellation hat schließlich von Anfang an ein ausgeprägtes Ungleichgewicht vorgelegen: Kinder sind vor allem in den ersten Lebensjahren komplett von ihren Eltern abhängig, diese Abhängigkeit bleibt – in materieller, rechtlicher, erzieherischer Hinsicht – noch lange bestehen und auch in emotionaler Hinsicht sind Eltern die ersten und wichtigsten Bezugspersonen, deren ganz besonderer Status auch in gesunden Familienbeziehungen ein Leben lang andauert. Abhängigkeiten können hier subtiler auftreten, das Verhältnis eines erwachsenen Kindes zu seinen Eltern ist das Ergebnis einer lebenslangen Entwicklung und nicht ein neu auftretendes Verhältnis und so wird die Art, auf die es sich gestaltet, oft als ganz selbstverständlich angenommen.
In Beziehungen sieht das Ganze ein wenig anders aus: Denn zumindest in der europäischen Gesellschaft des 21. Jahrhunderts werden Partner – ob aus hetero- oder homosexuellen Partnerschaften – selbstverständlich als gleichberechtigt angesehen. Den geltenden Wertvorstellungen entsprechend gibt es dabei keine Hierarchie, keine Abhängigkeit, keine Über- und Unterordnung, das heißt: Ist ein Partner unterwürfig und vom anderen deutlich abhängiger als umgekehrt, fällt dies als nicht angemessen auf. Nun geht es in der gelebten Realität natürlich keinesfalls darum, dass alles exakt gleich auf beide aufgeteilt ist, sondern meistens verdient ein Partner ein bisschen mehr, einer legt etwas mehr Wert auf Zärtlichkeiten und Nähe, einer genießt Allein-Zeit mehr als der andere etc., doch das große Ganze sollte sich in einem prinzipiellen Gleichgewicht bewegen. Ist einer der Partner emotional abhängig vom anderen, verschiebt sich dieses Gleichgewicht drastisch.
Egal, in welcher Konstellation die Abhängigkeit nun besteht, die Schlüsselfaktoren sind die gleichen: Der Abhängige ist in übertriebenem Maße von Fürsorge, Bestätigung, Zuspruch, Zuwendung, Versicherung der Liebe und meist auch Gegenwart des anderen abhängig. Er ist davon überzeugt, voll und ganz auf den anderen angewiesen zu sein, um seine emotionalen Bedürfnisse befriedigt zu bekommen und ist nicht in der Lage, dies selbst zu tun. Es besteht das ausgeprägte Gefühl, ohne den anderen nicht leben zu können, dass das Leben außerhalb dieser Partnerschaft keinen Sinn ergäbe und die Vorstellung, die Beziehung könnte zu einem Ende kommen, wird als unvorstellbare Katastrophe erachtet. Daraus resultieren einige höchst destruktive Verhaltensweisen: Betroffene sind stark abhängig von der Gegenwart ihres Partners, suchen dauerhaft Nähe, klammern und empfinden dessen (längere) Abwesenheit als bedrohlich. Darüber hinaus benötigen sie ständige Bestätigung für die Liebe des Partners, wollen hören, dass sie noch begehrt werden und dass sie das Wichtigste in dessen Leben sind und leben in starker Furcht davor, von ihm abgelehnt werden zu können. Um das alles zu erreichen, passen sie sich an: Sie werden unterwürfig, folgsam, versuchen, dem Partner alles recht zu machen, unterdrücken eigene Bedürfnisse oder Gefühle, wenn sie fürchten, dass diese dem Interesse ihres Partners zuwiderlaufen könnten. Das ganze Leben wird um den Partner herum gestaltet und aufgebaut, eigenständige Interessen werden kaum verfolgt und oft auch kein eigenes soziales Umfeld aufgebaut – denn schließlich wollen die Betroffenen nur mit ihrem Partner zusammensein. Darüber hinaus kommt es oft zu übersteigerter Eifersucht inklusive Kontrollverhalten, ebenso wird der Partner idealisiert und überhöht, Negatives wird nicht gesehen und ausgeblendet.
Sicher ist Ihnen aufgefallen, dass im letzten Absatz durchgehend vom „Partner“ die Rede war, was den Anschein erwecken könnte, die Schilderungen bezögen sich nur auf die Abhängigkeit innerhalb einer Paarbeziehung. Das ist nicht der Fall, lediglich aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird darauf verzichtet, jede einzelne Konstellation anzuführen. Gleichzeitig sind natürlich einzelne Punkte insbesondere oder nur innerhalb von Liebesbeziehungen relevant. Wenn im Verlauf des Buches die Einzelheiten der emotionalen Abhängigkeit genauer unter die Lupe genommen werden, wird im Bezug auf die verschiedenen möglichen Konstellationen jeweils deutlich gemacht, für welche Bereiche der entsprechende Punkt relevant ist.
Vielleicht lesen Sie sich das jetzt durch und fragen sich bei der ein oder anderen Beschreibung: Aber ist das in Beziehungen nicht ein Stück weit ganz normal? Damit sind Sie beim entscheidenden Punkt: Denn der Grat zwischen einer intensiven Beziehung und emotionaler Abhängigkeit ist schmal und oft ist es gar nicht so leicht, festzustellen, auf welcher Seite davon sich jemand bewegt. Eines gehört gleich zu Beginn ganz klar festgehalten: In Beziehungen – gleich welcher Art –, in denen Menschen einander wirklich nahestehen und starke Gefühle füreinander haben, besteht grundsätzlich eine gewisse „Abhängigkeit“. Wenn Sie einen Menschen lieben, „hängen“ Sie von ihm und seinem Wohlergehen unvermeidbar in bestimmter Weise „ab“: Es geht Ihnen schlechter, wenn etwa Streit herrscht, Sie vermissen den anderen, wenn er länger abwesend ist, wenn es dem Partner nicht gut geht, leiden auch Sie mit. Wäre das nicht der Fall, könnte man kaum von einer innigen Beziehung sprechen und umso wichtiger ist es, die tatsächliche emotionale Abhängigkeit genau abzugrenzen. Damit das besser gelingt und Sie am Ende zu einer realistischen Einschätzung Ihrer eigenen Situation gelangen können, geht es nun zunächst darum, die Mechanismen der Abhängigkeit besser zu verstehen.
Psychologische Mechanismen der emotionalen Abhängigkeit
Emotionale Abhängigkeit hat Ursachen und Auslöser, zugleich spielen ganz grundsätzliche psychologische Faktoren eine Rolle bei der Entwicklung. Die Psychologie hat dazu heute schon eine Menge hochinteressanter Erkenntnisse und so lernen Sie im Folgenden entscheidende Schlüsselmechanismen kennen und verstehen, die für die Entstehung von emotionaler Abhängigkeit relevant sind.
Bindungstheorie nach John Bowlby
Emotionale Abhängigkeit entsteht innerhalb von Bindungen, allerdings bei Bindungsprozessen, in denen etwas schiefläuft. Um das erkennen zu können, ist es zunächst einmal wichtig, zu verstehen, wie Bindung eigentlich funktioniert und dazu gibt es eine heute weithin anerkannte Theorie, die unter Federführung des britischen Kinderpsychiaters und Psychoanalytikers John Bowlby (1907 in London – 1990 auf Skye) entwickelt wurde. Er war der Initiator dieser Arbeit, entwickelt wurde die Theorie dann allerdings unter wesentlicher Mitwirkung der US-amerikanisch-kanadischen Psychologin Mary Ainsworth (1913 in Glendale, Ohio – 1999 in Charlottesville, Virginia), deren später durchgeführte Experimente die theoretischen Annahmen Bowlbys bestätigten.
Exkurs: Bindungstheorie
Die Bindungstheorie beschäftigt sich mit der Beziehung, die ein Kind ab seiner Geburt zu Bezugspersonen, bzw. einer Hauptbezugsperson, entwickelt. Sie beschreibt dabei sowohl den idealtypischen Verlauf eines gesunden Bindungsprozesses als auch vier daraus resultierende Bindungstypen.
Warum ist das so wichtig für das Thema der emotionalen Abhängigkeit? Ganz einfach: Bowlby und Ainsworth hielten in ihrer Theorie ebenfalls fest, dass dieser erste, ursprüngliche Aufbau einer Bindungsbeziehung in vielerlei Hinsicht das spätere Verhalten bzw. die psychische Verfassung beeinflusst. Das heißt: Läuft hier etwas schief, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich im Erwachsenenleben daraus Schwierigkeiten ergeben, nicht eben gering und diese Schwierigkeiten haben oft mit problematischem Beziehungsverhalten zu tun. Die Auswertung verschiedener Untersuchungen zeigt, dass etwa 60-70 % der Kinder ein gesundes Bindungsverhalten aufweisen. Da bleiben leider gar nicht so wenige übrig, für etwa 10-15 % wird ein ungünstiges Bindungsverhalten angenommen, das jedoch noch nicht im Bereich der Bindungsstörung liegt. 5-10 % der Kinder zeigen desorganisiertes Bindungsverhalten und in den nachfolgenden Ausführungen werden Sie erfahren, welche problematischen Auswirkungen das im Erwachsenenalter haben kann. Beispielsweise eine emotionale Abhängigkeit – ein genauer Blick auf die spannende Beziehungsentwicklung im Kindesalter lohnt sich also definitiv!
Also von vorne: Die Bindung, mit der Bowlby sich beschäftigt, ist als starkes, emotionales Band zwischen zwei Menschen zu verstehen, in diesem Fall zwischen dem Kind und seiner Bezugsperson bzw. seinen Bezugspersonen, bei denen es sich in der Regel um die Eltern handelt. Direkt nach der Geburt besteht eine solche Bindung noch nicht: Das Baby steht in keiner emotionalen Verbindung zu den Personen, die es umgeben, die Natur hat es aber mit allen Fähigkeiten ausgestattet, die es benötigt, um seine Bedürfnisse befriedigt zu bekommen – und den Grundstein dafür zu legen, dass eine solche Bindung sich schließlich aufbaut. Es schreit, quengelt und weint, wenn es Hunger hat oder körperliche Nähe braucht und damit die Eltern diesen Wünschen auch nachkommen, hat die Natur ihm eine Trumpfkarte mitgegeben: ganz besondere Proportionen im Gesicht mit großen runden Kulleraugen, einer kleinen Nase, Pausbäckchen, einer hervorspringenden Stirn und einem verhältnismäßig großen Kopf – also genau das, was Menschen instinktiv als niedlich und süß empfinden. Dieses Äußere wird als „Kindchenschema“ bezeichnet und die Evolution hat es so eingerichtet, dass Erwachsene darauf mit dem Willen zur Fürsorge, zum Kümmern und Umsorgen reagieren.
Definition: „Kindchenschema“
Unter Kindchenschema werden ganz bestimmte Gesichtsproportionen beim Menschen, aber auch bei anderen Säugetieren verstanden, die für Eltern(tiere) als Schlüsselreiz wirken, um Brutpflege- und Fürsorgeverhalten auszulösen. Dazu zählen große Augen, kleine Nase oder vorspringende Stirn. Dieses Äußere führt ebenfalls dazu, dass ältere Artgenossen den Nachwuchs mit mehr Vorsicht und weniger Aggression behandeln.
Das müssen sie im Übrigen ebenfalls nicht lernen, sondern es gehört zum sogenannten „intuitiven Elternprogramm“: Ohne, dass es ihnen beigebracht wurde, reagieren Eltern instinktiv passend etwa mit beruhigendem Reden, Körperkontakt oder sanfter Stimme auf die Signale ihres Nachwuchses wie etwa Schreien oder Weinen. Dadurch wird die optimale Versorgung des Neugeborenen sichergestellt und gleichzeitig beginnt das Baby damit, seine Eltern an sich zu binden. Der Säugling selbst folgt dabei zunächst nur seinen angeborenen Instinkten und verspürt noch keinerlei emotionale Bindung zu seinen Eltern, was sich jedoch schnell ändert. Der erste Vertrautheitsfaktor ist die Stimme der Mutter, die ihm bekannt ist und die er auch erkennt, bald kommt deren Geruch sowie Stimme und Geruch des Vaters dazu. Daraus erwächst dann im Verlauf des ersten Lebensjahres idealerweise der Grundstein einer emotionalen Bindung. Die Voraussetzungen dafür sind lediglich, dass beide Seiten ihrem biologisch angelegten Programm folgen; das bedeutet für das Baby insbesondere, dass die Eltern zuverlässig und adäquat auf seine Signale reagieren und die bestehenden Bedürfnisse befriedigen. Somit erlebt es, dass im Zustand von Bedürftigkeit – Hunger, Ängste, Enttäuschungen etc. – die Bezugsperson zur Stelle ist, um zu helfen und es entwickelt mit der Zeit die Sicherheit, anzunehmen, dass dies auch zuverlässig der Fall sein wird. Es beginnt, diese Fürsorglichkeitsreaktionen aktiv von seinen Bezugspersonen einzufordern und auf beiden Seiten wachsen das Vertrauen, das Gefühl der Sicherheit und schließlich die Intensität des emotionalen Bandes.
Dieser Prozess lässt sich in vier Phasen einteilen:
Phase 1:
Das Baby macht in ca. den ersten drei Lebensmonaten durch Weinen, Schreien etc. auf seine Bedürfnisse aufmerksam und zeigt so die ersten Ansätze eines Bindungsverhaltens. Dabei ist es zunächst noch gleichgültig, wer diese Bedürfnisse befriedigt, das kann jeder beliebige Erwachsene sein, der mit dem passenden Fürsorgeverhalten reagiert.
Beispiel:
Ein Baby weint, weil es Hunger hat. Darauf reagiert die Mutter, der Bruder oder eine Krankenschwester, indem sie das Baby füttern. Das Bedürfnis des Babys wurde befriedigt und das Weinen wird eingestellt.
Phase 2:
Vom dritten bis zum sechsten Lebensmonat fokussiert sich dieses Bindungsverhalten dann auf bestimmte Personen, meist ist dies zunächst die Mutter. Der Säugling macht nun einen Unterschied zwischen vertrauten und nicht vertrauten Menschen, lässt sich oft aber auch noch von Fremden etwa hochheben und beruhigen.
Beispiel:
Das Baby schreit, weil etwas in seiner Umgebung es beunruhigt, etwas ungewohnter Lärm. Darauf reagiert die Mutter, indem sie es auf den Arm nimmt, beruhigend auf es einspricht, vielleicht streichelt oder ein Liedchen singt. Meist würde das in dieser Phase auch noch funktionieren, wenn etwa die Nachbarin, die gerade vorbeigekommen ist, dies tut. Wichtig ist in erster Linie, dass auf die Bedürfnisäußerung eine passende Reaktion erfolgt.
Phase 3:
In einer längeren Phase, die etwa mit dem sechsten Monat beginnt und bis zum dritten Lebensjahr andauert, verstärkt sich das kindliche Bindungsverhalten und wird umfassender. Bindungspersonen werden nicht nur erkannt, sondern ihre Nähe wird gezielt gesucht, das Kind nimmt Blickkontakt auf, begrüßt und – sobald es motorisch dazu in der Lage ist – folgt seiner Bezugsperson.
Beispiel:
Wenn die Mutter den Raum betritt, in dem das Kind spielt, reagiert es, sucht Blickkontakt und krabbelt ihr etwa entgegen.
Phase 4:
Das Kind hat vielfältige Erfahrungen gemacht, soziale Kompetenzen und persönliche Eigenschaften entwickelt, aufgrund derer es jetzt auch Gefühle der Bezugspersonen nachvollziehen kann. Es lernt, deren Absichten zu verstehen und begreift, dass außer ihm auch andere Menschen Bedürfnisse haben. Das ermöglicht ihm, sich beispielsweise rücksichtsvoll zu verhalten und nicht grundsätzlich auf seine eigenen Bedürfnisse zu bestehen. Diese Lebensphase startet etwa mit dem vierten Jahr und von da an wird die Kind-Bezugsperson-Beziehung signifikant komplexer und vielschichtiger.
Beispiel:
Das Kind hat etwa den Wunsch, mit der Mutter herumzutoben, doch die Mutter ist zu erschöpft und braucht gerade eine Pause. Das Kind ist nun in der Lage, zu verstehen, dass die Mutter ein Bedürfnis hat – nämlich nach Ruhe –, die Befriedigung seines Spielbedürfnisses hintanzustellen und darauf zu warten, dass seine Mutter etwa nach einer halben Stunde auf dem Sofa mit ihm spielt.
Wenn hier alles richtig läuft und die Entwicklung – im Großen und Ganzen – nach diesem Schema verläuft, kann von einem gesunden, stabilen Bindungsprozess gesprochen werden. Zwei Dinge sind nun elementar: Zum einen fällt auf, dass es für die beschriebenen Prozesse ein ziemlich klares und damit beschränktes Zeitfenster gibt. Das bedeutet im Umkehrschluss: Wird hier etwas versäumt, lässt sich das nicht einfach im späteren Kindes- oder gar Erwachsenenalter nachholen. Kinder erwerben in der frühesten Phase ihres Heranwachsens das, was nach dem Psychoanalytiker E.H. Erikson (1902 in Frankfurt a. Main – 1994 in Harwich, Massachusetts) als Urvertrauen bezeichnet wird: Eine stabile, verlässliche emotional-soziale Basis, auf der später alle gelungenen Beziehungen fußen. Das führt direkt zum zweiten Punkt: Findet der Bindungsprozess nicht so statt, wie er sollte, liegt hier im Gegenteil die Wurzel zu vielfältigen möglichen Bindungsproblemen im späteren Leben. Die Psychologie weiß heute ganz grundsätzlich, dass Jugendliche, die in familiären Situationen mit gutem Bindungsverhalten aufgewachsen sind, insgesamt psychisch gesünder, zufriedener, selbstbewusster und stabiler sind. Ihre Resilienz ist ausgeprägter, sie können mit Problemen besser umgehen und haben gewissermaßen eine gute Grundimmunität gegenüber späteren psychischen Problemen erworben.
Definition: Resilienz
Resilienz bezeichnet eine psychische Fähigkeit, die dafür sorgt, dass Menschen Schwierigkeiten, Schicksalsschläge und Belastungen gut verkraften und keine langfristigen Schäden davontragen. Sie umfasst zudem die Kompetenz, sich an schwierige Situationen entsprechend anzupassen, sodass das bestmögliche Verhalten aktiviert werden kann.
Natürlich ist das kein hundertprozentiger Schutz: Abhängig von Erlebnissen und Erfahrungen, der eigenen Persönlichkeit und Umweltfaktoren können sich trotz guter Bindung Schwierigkeiten ergeben, die grundsätzliche Wahrscheinlichkeit ist jedoch deutlich niedriger.
Je nachdem, wie gut hier also alles klappt, entwickeln Kinder einen von vier Beziehungstypen. Diese wurden erstmals in einem entscheidenden Experiment von Ainsworth identifiziert und gelten bis heute als sinnvolle Unterscheidung. Dabei wurde ein als „Fremde Situation“ bezeichnetes Setting aufgebaut, bei dem grob zusammengefasst Kinder in eine unbekannte Situation gebracht wurden, indem ihre zunächst anwesende Bezugsperson den Raum verlässt und sie mit einer fremden Person allein gelassen werden. Anhand der unterschiedlichen Reaktionen der Kinder ergaben sich die vier unterschiedlichen Bindungstypen, in die sich – natürlich mit abweichender Ausprägung – die Kinder einordnen ließen. Dabei wird es für Sie als Leser dieses Ratgebers besonders interessant: Denn leider wächst nicht jedes Kind unter optimalen Bedingungen auf und wenn Sie sich die folgenden vier Typen durchlesen, dann fällt Ihnen möglicherweise die eine oder andere Parallele auf – zu Ihren persönlichen Erfahrungen, aber auch zu Ihrem Problem.
Typ 1: Sichere Bindung, auch als B-Typ bezeichnet.
Klingt super, ist es auch. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass hier im Großen und Ganzen alles gut gelaufen ist. Das Kind hat ein ausgeprägtes Grundvertrauen in seine Bezugsperson entwickelt und verlässt sich darauf, dass diese ihm zur Seite steht, verfügbar ist, Gefahren abwehrt, es schützt und tröstet. Diese Zuversicht beruht darauf, dass die Bindungsperson verlässlich an seiner Seite war, nachvollziehbar gehandelt hat und in ihrem Verhalten Klarheit gezeigt hat, sodass das Kind stets in der Lage war, sie richtig einzuschätzen. Verlässt nun im Versuchssetting die Bezugsperson den Raum, reagiert das Kind zunächst unglücklich. Es weint, wird unruhig, wichtig ist aber: Es zeigt eigene Gefühle und sobald die Bezugsperson zurückkehrt, wird sie freudig begrüßt, es wird Nähe gesucht und das Kind beruhigt sich schnell. Spannendes Detail: Wird währenddessen der Cortisolspiegel überwacht (Cortisol ist ein Hormon, das beim Empfinden von Stress ausgeschüttet wird), so zeigt sich ein mit der Abwesenheit der Bezugsperson einhergehender Anstieg, mit ihrer Rückkehr sinkt der Spiegel unmittelbar wieder.
Typ 2: Unsicher vermeidende Bindung, auch als A-Typ bezeichnet.
Hier steht es um Bindung und Grundvertrauen nicht so gut, wie es wünschenswert wäre. Das Kind hat seine Bezugsperson nicht als verlässlich zur Seite stehend erlebt, sondern im Gegenteil oft Zurückweisung, Distanz und kein konstantes, verlässliches Beziehungsbild aufgebaut. Verlässt diese nun den Raum, zeigt das Kind keine äußerlich wahrnehmbare Regung wie Ärger, Wut, Trauer oder Angst. Scheinbar unbeeindruckt beschäftigt es sich mit Spielzeug oder der Erkundung des Versuchsraums, was vermutlich der Ablenkung bzw. Stressbewältigung dient. Auf Außenstehende wirkt dieses Verhalten oft selbstsicher, autonom und unabhängig, das ist allerdings ein Trugschluss. Denn die Cortisolspiegelmessung verrät: Das Kind steht sehr wohl unter starkem Stress, gibt sich aber große Mühe, das nicht zu zeigen. Wenn die Bezugsperson zurückkehrt, wird auch hierauf keine Reaktion gezeigt, das Kind ignoriert sie und wendet sich sogar eher der fremden Person zu. Der Cortisolspiegel bleibt noch Stunden später erhöht, die Nähe der Bezugsperson hat also keinesfalls den beruhigenden, stabilisierenden Effekt wie im vorigen Fall. Das Kind zeigt ein Muster der Beziehungsvermeidung als Resultat der bisherigen Erfahrungen mit der Bezugsperson. Es wird angenommen, dass dies daher rührt, dass in der bisherigen Bindungsgeschichte die Bezugsperson auf die kindlichen Bedürfnisäußerungen nicht adäquat reagiert hat, vielleicht sogar geschimpft oder mit Strafe gedroht, sodass das Kind gelernt hat: Meine Bedürfnisse behalte ich möglichst für mich, Trost oder körperlichen Kontakt suche ich dort besser nicht, um mir negative Reaktionen zu ersparen. Im Erwachsenenalter können solche Bindungserfahrungen dazu führen, dass entweder ein stark idealisiertes Selbstbild besteht oder im Gegenteil ein sehr abwertendes. Die Schwierigkeit, Emotionen zu zeigen, setzt sich oft fort und kommt es zu Enttäuschungen, fehlen Strategien, um diese gut zu verkraften.
Typ 3: Unsicher ambivalente Bindung, auch als C-Typ bezeichnet.
Das Verhalten von Kindern dieses Bindungstyps unterscheidet sich stark vom zuvor beschriebenen, auch wenn in beiden Fällen Unsicherheit eine große Rolle spielt. Bei der Beobachtung fällt auch unbeteiligten Laien auf, dass etwas vermutlich nicht ganz in Ordnung ist. Der Raum wird kaum erkundet, das Spielzeug ignoriert, stattdessen ist ein ausgeprägtes Klammerverhalten an die Bezugsperson beobachtbar. In der unbekannten Situation zeigt das Kind bereits vor dem Weggehen der Bezugsperson starke Verlustängste, Unruhe, Unsicherheit und ängstliches Verhalten, die fremde Person wird eher gefürchtet und während der Abwesenheit der Bindungsperson wird von dort kein Trost angenommen. Stattdessen reagiert das Kind extrem auf das Zurückgelassenwerden, Schreien, Weinen, vielleicht sogar gegen die Türe schlagen zeigen überwältigenden Stress an und kommt die Bezugsperson schließlich zurück, ist die Reaktion ambivalent: Es wird einerseits heftig geklammert und sich regelrecht auf die Person „gestürzt“, andererseits zeigen sich auch Verhaltensweisen, die Wut, Ärger und Aggressionen gegenüber der Bindungsperson ausdrücken.
Der Cortisolspiegel ist über einen längeren Zeitraum erhöht, denn dem Kind stehen keine gesunden Regulierungsstrategien zur Verfügung. Kinder mit einem solchen Verhalten haben meist ein unzuverlässiges und nicht vorhersehbares Bindungsverhalten erlebt: Ihre Bezugsperson hat auf die kindlichen Bedürfnisäußerungen im einen Moment liebevoll, angemessen und zugewandt reagiert, im anderen durch Zurückweisung oder auch gar nicht. Deshalb wird die Trennung schon gefürchtet, bevor sie überhaupt eintritt, da das Kind keinerlei Zuversicht spürt, dass die Bindungsperson sicher wieder zurückkehren wird. Das extreme Anklammern soll ein Verlassenwerden deswegen möglichst einfach vermeiden; kommt es dann doch dazu und die Bezugsperson kehrt zurück, ist das Kind hin- und hergerissen zwischen seiner Sehnsucht nach Geborgenheit und gleichzeitig Misstrauen, Wut und Verdruss. Kinder dieses Bindungstyps entwickeln oft grundsätzliche Ängstlichkeit und Unsicherheit, Neugier und das Verlangen, die Welt zu erkunden, sind kaum ausgeprägt und sie sind leicht zu verunsichern. Im Erwachsenenalter kann es zu Impulsivität kommen und ein fehlendes Sicherheitsgefühl prägt bestehende Bindungskonstellationen.
Typ 4: Desorganisierte Bindung, auch als D-Typ bezeichnet.
Hierbei handelt es sich um eine besondere und ausgesprochen dysfunktionale Form des Bindungsverhaltens, die von Widersprüchlichkeiten und irrational anmutenden Verhaltensweisen geprägt ist. Diese vierte Kategorie wurde erst später als eigenständiger Typ etabliert, nachdem es immer wieder Kinder gab, die in die drei bisherigen Kategorien nicht passten, entweder, weil sie Aspekte verschiedener Typen aufwiesen oder auch Verhalten, das nirgendwo sonst beobachtet wurde. Im Versuch benehmen sie sich vielfältig und kaum nachvollziehbar: Manche Kinder schreien nach der Bezugsperson, sobald sie den Raum verlässt, vermeiden sie aber, sobald sie zurückkommt. Andere reagieren nach der Rückkehr mit einer undurchschaubaren Mischung aus unsicher vermeidenden und unsicher ambivalenten Verhaltensmustern und viele Kinder zeigen Verhaltensweisen, die unangemessen und bisweilen gar bizarr erscheinen: So erstarren sie, frieren in ihren Bewegungen ein, drehen sich im Kreis, schaukeln vor und zurück, lassen sich auf den Boden fallen oder deuten Aggressionsverhalten in Richtung der Bezugsperson an. Die Theorie hinter diesem Verhalten ist, dass Kinder ganz unvermeidlich eine Art der Bindung zu ihrer Bezugsperson aufbauen müssen.
Im Fall der desorganisierten Bindung ist dies jedoch im eigentlichen Sinne kaum möglich gewesen, da die Bindungsperson ein für die Kinder unnachvollziehbares, unvorhersehbares und sogar bedrohliches Verhalten zeigt. Das können tatsächliche Misshandlungen des Kindes durch die Bindungsperson sein, aber auch andere als bedrohlich wahrgenommene Verhaltensweisen, die damit einhergehen, dass die kindlichen Grundbedürfnisse nicht befriedigt werden. Häufig vollzieht sich eine solche Form des Bindungsaufbaus mit Bezugspersonen, die selbst unter schweren, nicht verarbeiteten Traumatisierungen oder psychischen Erkrankungen leiden, was dazu führt, dass sie ihr Kind zum Teil kaum wahrnehmen, zum Teil gar nicht auf seine Bedürfnisäußerungen eingehen können und zum Teil für das Kind verstörendes, bedrohliches Verhalten an den Tag legen. Die Bindungsperson ist somit für das Kind Quelle der Bedrohung und Angst und trotzdem auch noch einzige Anlaufstelle für Nähe, Fürsorge und weitere Grundbedürfnisse, wodurch eine nicht auflösbare widersprüchliche Situation entsteht, in der es gefangen ist. Auch Traumatisierungen des Kindes selbst können Ursache einer desorganisierten Bindung sein. Misst man bei Kindern dieses Typs den Cortisolspiegel, so findet man ihn dauerhaft erhöht vor, was den permanenten Stress, unter dem sie stehen, ausdrückt. Als Erwachsene haben sie oft Probleme, Stress zu regulieren und greifen häufiger auf andere Mittel zurück, z.B. durch gestörtes Essverhalten, Alkohol- oder Drogenkonsum. Das Selbstbewusstsein ist oft schlecht ausgeprägt und es fehlt die Fähigkeit, das eigene Emotionsleben auf gesunde Weise zu regulieren.