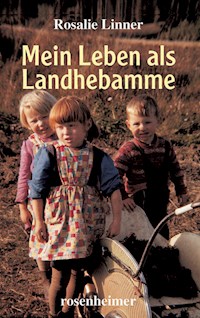16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Rosalie Linner war fast 40 Jahre als Hebamme in ländlichen Gebieten tätig und hat dabei 4000 Kindern auf die Welt geholfen. Eine solche Frau hat viel zu erzählen. Für die werdenden Mütter war sie nicht nur Geburtshelferin, sondern auch Seelentrösterin und oft genug Arzt-Ersatz. So musste sie nicht nur manche dramatische Geburt zu einem guten Ende bringen. Sie erhielt auch einen tiefen Einblick in die Sorgen und Freuden, Träume und Ängste ihrer Schützlinge. Sie wusste, ob ein Kind sehnsüchtig erwartet oder unerwünscht war, sie erfuhr von Eheproblemen, Reibereien innerhalb der Verwandtschaft und enttäuschter Liebe. Dieser Band vereint die besten Geschichten, die Rosalie Linner über ihr langes Berufsleben im Lauf der Jahre niedergeschrieben hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
LESEPROBE zuVollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2008
© 2014 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheim www.rosenheimer.com
Als Lektoren arbeiteten an diesen Texten u.a.: Annette Epp, Eningen; Dr. Elisabeth Hirschberger, Strasbourg; Angelika Oberauer, Siegsdorf; Pro Libris Verlagsdienstleistungen, Villingen-Schwenningen
Schlussredaktion: Ulrike Nikel, Herrsching am Ammersee
Titelfoto: mauritius images / (re)view
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
eISBN 978-3-475-54377-7 (epub)
Worum geht es im Buch?
Rosalie Linner
Meine besten Geschichten als Landhebamme
Rosalie Linner war fast 40 Jahre als Hebamme in ländlichen Gebieten tätig und hat dabei 4000 Kindern auf die Welt geholfen. Eine solche Frau hat viel zu erzählen. Für die werdenden Mütter war sie nicht nur Geburtshelferin, sondern auch Seelentrösterin und oft genug Arzt-Ersatz. So musste sie nicht nur manche dramatische Geburt zu einem guten Ende bringen. Sie erhielt auch einen tiefen Einblick in die Sorgen und Freuden, Träume und Ängste ihrer Schützlinge. Sie wusste, ob ein Kind sehnsüchtig erwartet oder unerwünscht war, sie erfuhr von Eheproblemen, Reibereien innerhalb der Verwandtschaft und enttäuschter Liebe.
Dieser Band vereint die besten Geschichten, die Rosalie Linner über ihr langes Berufsleben im Lauf der Jahre niedergeschrieben hat.
Inhalt
Ein Blick zurück
WIE ICH HEBAMME WURDE
Ein Schlüsselerlebnis
Lehrjahre einer Hebamme
»Hausschwangere«
Hexen und Hebammen
Aller Anfang ist schwer
In den Maschen der Paragrafen
Was lange währt …
VON DRAMATISCHEN UND KOMISCHEN ERLEBNISSEN
Dem Tod entrissen
Zenzi und die Qual der Wahl
Segen ist nicht gleich Segen
Geburtshilfe überflüssig?
Eine verhängnisvolle Einladung
Emmerenz in der Badewanne
Geburtsort »Häusl«
Glück und Leid
Villa Sonnenschein
Später Kindersegen
Veronikas Opfer
MENSCHLICHES, ALLZU MENSCHLICHES
Von Hochzeiten, Taufen und Todesfällen
Eine verhängnisvolle Liebe
Wie eine eigene Tochter
Das Kuckucksei
Der Heimkehrer
Eine saubere Familie
Wo ist mein zweites Kind?
Das verschenkte Mädchen
Die Schnapstherapie
Das behinderte Kind
Die heilige Rebecca
Das »entweihte« Gotteshaus
Wieder kein Stammhalter
Die zänkischen Frauen
Die Last der Erinnerungen
Die zweite Frau
Das Kreuz mit der Schwiegermutter
Auf Treu und Glauben
Wenn Hebammen Kinder bekommen …
ZWISCHEN GESTERN UND MORGEN
Im Zeichen des Fortschritts
Ein gutes Omen
Bauer sucht Bäuerin
Blumenkinder
Ein verhexter Tag
Neumodische Sitten
Zurück zur Natur
Geburt unter Polizeischutz
Ein verirrtes Herz
KINDER UND KINDESKINDER
Abenteuer Geburt
Eine späte Erkenntnis
Die Stimme des Blutes
Unerfüllte Sehnsucht
Generationenschicksal
Zwischen zwei Stühlen
Wie das Schicksal so spielt
Das Kind der Magd
Nachwort
Ein Blick zurück
Viele Millionen Schritte bin ich im Lauf der rund vierzig Jahre meines Berufslebens gegangen, viele tausend Wege habe ich zurückgelegt. In der Anfangszeit, in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, noch zu Fuß oder per Fahrrad, später dann mit meinem kleinen Lloyd, der in der ganzen Gegend bekannt war und mich brav auch bei schlechtesten Wetterverhältnissen meist rechtzeitig zu meinen werdenden Müttern gebracht hat.
Es gab Mühen und Plagen, Leid, Angst und Sorgen, heftige Aufregungen und schlaflose Nächte, lange Märsche durch Wind und Wetter, aber vor allem gab es eines: unermesslich viel Freude und zahllose Sternstunden. Mir war als Landhebamme ein wirklich reiches und erfülltes Leben beschieden.
Natürlich muss man sich in diesem Beruf damit abfinden, öfter als einem lieb ist, Schmerz und Leid mit anzusehen, es gar zu teilen und zu lindern. Vor allem am Anfang war das sehr schwer, doch mit der Zeit überwogen die schönen Seiten. Ich war immer glücklich, wenn ich einem gesunden Kind auf die Welt geholfen hatte, und gerührt über die unzähligen Beweise der Dankbarkeit, die mich gelegentliche Vorwürfe und Schuldzuweisungen vergessen ließen. In diesem Beruf steht man häufig vor komplizierten Situationen, in denen die Grenzlinie zwischen Leben und Tod nur hauchdünn ist. Und so habe ich in stillen Stunden jedes neue Leben als ein Wunder, als ein Gottesgeschenk empfunden, welches uns ehrfürchtig staunen lässt.
WIE ICH HEBAMME WURDE
Ein Schlüsselerlebnis
Es war das Kriegsjahr 1943. Zu diesem Zeitpunkt lebte ich bei meiner Familie in Frankfurt am Main. Ich stand noch unter dem Eindruck der furchtbaren Nachricht, dass mein einziger Bruder in Russland gefallen war. Aber zu jener Zeit jagte ein trauriges Ereignis das andere. Bomben fielen über unseren Städten und brachten Tod und Verderben über die Menschen. So geschah es auch in jener Nacht, deren Ereignisse sich tief in mein Gedächtnis eingegraben und meinem Leben eine entscheidende Wende gegeben haben.
Fliegeralarm! Der schrille Ton der Sirene schreckte die Menschen aus dem Schlaf, und ängstlich tastend liefen die Bewohner unseres Hauses in den Luftschutzkeller. Da saß ich nun wieder einmal in diesem dunklen Raum, neben mir ein altes Ehepaar, das seine wichtigste Habe neben sich abgestellt hatte. Ein paar Frauen kamen noch sowie ein gehbehinderter älterer Mann und schließlich von draußen drei Soldaten, die in unserem Keller Schutz vor den bevorstehenden Angriffen suchten.
Dumpf hörte man in der Ferne das Herannahen der Flugzeuge und bald darauf in der Nähe den Einschlag der ersten Bomben, als sich noch einmal die Kellertür öffnete und eine hochschwangere junge Frau den Raum betrat, die sich in der hintersten Ecke, nahe dem Kohlenhaufen, einen Platz suchte. »Eine Halbjüdin«, hörte ich die anderen Frauen tuscheln.
Das Licht der kleinen Glühbirne, die den Raum spärlich erleuchtet hatte, war längst erloschen. Nur der helle Feuerschein, der von der Straße durch einen Fensterspalt zu uns hereindrang, verbreitete ein magisches Licht. Plötzlich war ein leises Wimmern vom Kohlenhaufen zu hören. Niemand achtete darauf, denn draußen war die Hölle los, und Todesschreie aus dem Luftschutzkeller nebenan ließen uns das Schlimmste befürchten. Jeder war mit sich und seinen Ängsten beschäftigt.
Stunde um Stunde verging. Das Wimmern drüben in der Ecke ging in ein lautes Stöhnen über. Inzwischen war allen klar, dass hier ein junges Leben ans Licht der Welt drängte – einer Welt, die außer Hunger und Angst, Bomben und Tod nichts zu bieten hatte. Niemand rührte sich, um der werdenden Mutter beizustehen, ihr zu helfen, das Kind zur Welt zu bringen. Jeder hatte eigene Sorgen, und niemand wollte Schwierigkeiten bekommen, denn außerdem war sie angeblich Halbjüdin. Es waren schreckliche Zeiten.
Doch mein Mitleid mit dieser jungen Frau war größer als die Angst vor Bomben und Blockwarten. Ich stapfte über Koffer und Taschen hinweg zu der Ecke, aus der die Schmerzenslaute kamen. Vielleicht konnte ich wenigstens etwas Trost vermitteln, dachte ich mir, wenn ich schon keine Geburtshilfe zu leisten vermochte, denn dazu fehlten mir die nötigen Kenntnisse. Außer ein wenig Theorie, die mir in einem Erste-Hilfe-Kurs vermittelt worden war, hatte ich damals vom Ablauf einer Geburt keinerlei Ahnung.
Ich wollte der jungen Frau einfach beistehen. Vielleicht, so sagte ich mir, half ihr meine Nähe ja ein ganz klein wenig. Ihre Augen und ihr Händedruck sagten mir, dass sie für meine Anwesenheit dankbar war. Zitternd vor Angst und Schmerz hockte sie auf dem Fußboden des Luftschutzkellers, gottergeben und irgendwie hoffnungslos. Ich betrachtete den Kohlenhaufen, ob sich hier wohl ein notdürftiges Lager für die werdende Mutter herrichten ließ? Eine Decke als Unterlage musste sich doch finden lassen, und tatsächlich hatte ich Glück. Auf zwei alten Eimern, die in einer Ecke standen, lag eine braune Militärdecke, die zwar alt und ausgefranst, aber immerhin noch brauchbar war.
Als sich die Geburt dem Höhepunkt näherte, stand mir mehr Schweiß auf der Stirn als der Gebärenden, denn ich fühlte mich ziemlich überfordert. Plötzlich aber überkam mich eine seltsame Ruhe, und wenn ich heute an diese Situation zurückdenke, so erkenne ich, dass ich damals instinktiv genau das Richtige tat, obwohl ich es nicht wusste. Niemand hätte gemerkt, dass es meine erste Geburt war.
Mir kam das Ganze erst richtig zum Bewusstsein, als ich plötzlich dieses kleine Menschenkind in meinen Händen hielt. Als es zu schreien anfing, war mir, als würde ich aus einem Traum erwachen.
Nachdem das Schwierigste überstanden war, stellte mich das Durchtrennen der Nabelschnur vor ein neues Problem. Ein verrostetes kleines Messer, das mir jemand zur Verfügung stellen wollte, erschien mir nicht als das richtige Werkzeug. So wartete ich, bis die Nabelschnur nicht mehr pulsierte, und riss sie dann mit einem kräftigen Ruck durch. Ein Verbandmull, den ich in meiner Tasche hatte, diente als Kompresse und zugleich als Nabelbinde.
Mit einem sauberen Taschentuch rieb ich das Neugeborene trocken, wickelte es in meinen Wollschal und legte es der Mutter in den Arm. Tote und Schwerverletzte in unserer unmittelbaren Nähe, und hier ein neues Leben! Auch das gab es in jener Zeit.
Jene Stunden im Bombenhagel gehörten trotz Todesangst zu den wichtigsten meines Lebens, denn sie wiesen mir den Weg zu meinem Beruf. Damals beschloss ich, Hebamme zu werden.
Lehrjahre einer Hebamme
Es war die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als sich das Leben wieder zu normalisieren begann, als ich eines Tages das begehrte Schreiben in meinen Händen hielt, dass ich, nach Prüfung meiner Unterlagen, an der Hebammenlehranstalt der Universitätsfrauenklinik in Würzburg angenommen worden sei.
Diese Schulen, die während des Krieges zu Lazaretten und Krankenhäusern umfunktioniert worden waren, wurden nun wieder ihrer eigentlichen Bestimmung übergeben.
Würzburg, die von Weinbergen umgebene Mainmetropole mit der Marienfeste und der berühmten Residenz, wurde für eineinhalb Jahre mein Zuhause. Die Stadt hatte im Krieg schrecklich gelitten und war zu großen Teilen zerstört, doch die Hebammenlehranstalt hatte nichts von ihrer Anziehungskraft eingebüßt, denn sie war, trotz Strenge, für ihre gute fachliche Ausbildung bekannt.
Schülerinnen, die aus den verschiedensten Berufen kamen, wurden hier für ihre spätere Aufgabe geschult. Ärzte und Lehrhebammen bemühten sich, uns im theoretischen, praktischen und ethischen Bereich das nötige Wissen zu vermitteln. Ich erinnere mich heute noch sehr genau an die Worte einer unserer Lehrhebammen, der Pflichtbewusstsein über alles ging: »Tun Sie immer Ihre Pflicht und manchmal mehr, denn nur so können Sie vor sich und anderen bestehen.« Schwester Ilse war eine Persönlichkeit, eine Frau mit Geistes- und Herzensbildung, die hohe moralische Wertvorstellungen hatte und bemüht war, uns diese zu vermitteln.
Sehr bald erkannte ich, dass Geburtshilfe den ganzen Menschen verlangt, ihn bis zum Letzten fordert und dass man von einem Glücksgefühl erfasst wird, wenn man vor dem Wunder einer Geburt und eines neuen Lebens steht. Mir wurde bewusst, dass es sich lohnt, sich mit ganzer und manchmal mit letzter Kraft einzusetzen.
Im Lauf der Zeit lernten wir auch die anderen Lehrhebammen kennen, die uns im praktischen Bereich zu schulen hatten. Eine von ihnen war Schwester Theresa, rotblond, groß, hager und stets verdrossen. Es lag nahe, dass die Schülerinnen bei ihr nichts zu lachen hatten, wenn ihre ein wenig krächzende Stimme tadelnd zu vernehmen war. Man sagte ihr nach, ihr Missmut liege in ihrer Vergangenheit begründet, weil ihre große Liebe, ein angehender Priester, sich nicht für sie, sondern für die Kirche entschieden habe. Sie schreibe ihm noch immer lange, sehnsuchtsvolle Briefe, die sie aber nie abschicke, hieß es, und seit jener Zeit stünde sie mit der Kirche auf Kriegsfuß. Irgendwie war sie ein bedauernswertes Geschöpf, aber immer, wenn sie einer Mutter ihr neugeborenes Kind in die Arme legte, veränderten sich ihre Gesichtszüge, sie wurden wärmer, weicher, und manchmal deuteten sie ein kleines Lächeln an.
Ganz anders in ihrem Wesen war Schwester Maria, die mit sich und der Welt, so schien es, zufrieden war. Sie sprach leise und nicht viel, sagte nur in knappen Worten, was zu sagen war, am liebsten aber schwieg sie. Ihr Erkennungszeichen war der weiße Schleier an der Schwesternhaube, der immer ein wenig flatterte, wenn sie leichtfüßig durch den Kreißsaal ging. Ich hatte das Glück, in ihrer Gunst zu stehen, weil wir beide aus Oberbayern stammten, den gleichen Dialekt sprachen und auch sonst einige Gemeinsamkeiten aufzuweisen hatten.
Ein Lichtblick war Schwester Else, ein Mensch mit goldenem Herzen und viel Verständnis für die Belange der Schülerinnen. Sie wurde von uns geliebt und verehrt, weil sie zu trösten und Mut zu machen verstand. Das war wichtig gerade für jene unter uns, die sich der Ausbildung nicht ganz gewachsen fühlten und besonders unter dem oft strengen Lehrbetrieb litten. Auch unter den Ärzten war Schwester Else sehr angesehen und aufgrund ihres überragenden Könnens und ihrer reichen Erfahrung als Assistentin in schwierigen Fällen gefragt. Sie war nicht nur in Geburtshilfe ausgebildet, sondern war während des Krieges auch als Lazarettschwester an der Front zum Einsatz gekommen.
Allerdings pflegte sie mit den Ärzten einen ziemlich rauen Umgangston. Sie kritisierte und tadelte gerne oder schalt junge Assistenzärzte überheblich und dumm. Es war nicht ratsam, sich mit ihr anzulegen, für uns Schülerinnen aber war sie der ruhende Pol und Anlaufstelle für unsere Ängste und Sorgen.
Normalerweise ist für Hebammenschülerinnen die Säuglingsstation naturgemäß der liebste Arbeitsbereich, aber zu meiner Zeit gab es in Würzburg ein erhebliches Hindernis. Hier regierten nämlich zwei Nonnen, deren Strenge ihresgleichen suchte. Schwester Petronella, klein und rundlich, hatte das Bedürfnis, uns Schülerinnen ständig zu kritisieren. Die Wärmeflaschen seien zu warm, dann wieder waren sie ihr zu kalt. »Wie oft muss ich das noch sagen?«
»Hoffnungslos, diese Schülerinnen!«, pflegte sie zu schimpfen. Mal waren ihr die Kinder zu fest gewi-ckelt, dann wieder fand sie diese »Wicklerei« zu locker. Es sei eine Schande, und für unser Examen sehe sie sowieso schwarz! Da war es noch harmlos, wenn sie zwischen den Kinderbetten hin und her watschelte und nur Selbstgespräche über die Dummheit der Schülerinnen führte.
Die zweite der gestrengen Nonnen war Schwester Claudia – jünger als Petronella und sehr intelligent. Sie hatte auf der Station das Sagen. Groß und dünn wie eine Bohnenstange, kam sie stets mit erhobenem Haupt daher und war sich ihrer Würde offensichtlich bewusst. Ihr Blick, so glaubte man, war weder nach rechts noch nach links gerichtet, und trotzdem entging ihr nichts. Zwischen diesen beiden Klosterschwestern kam es gelegentlich zu mehr oder weniger lauten Streitgesprächen, wobei Petronella stets den Kürzeren zog. In einem Punkt jedoch waren sie sich immer einig, dass dieser Kurs der dümmste sei, der je in diesem Haus abgehalten worden sei – eine Bewertung, die jeder Jahrgang zu hören bekam.
Erst viel später wurde mir bewusst, welch überragendes berufliches Können diese beiden Ordensfrauen besaßen. Ihr Rat und ihre Meinung galten uneingeschränkt bei jedem Arzt, und im Nachhinein hatte selbst ihre Strenge einen Sinn. Wir wurden geschult, die Kinder zu beobachten, schon an ihrem Schreien zu erkennen, ob sie gesund oder krank waren. Wir lernten, jede Regung wahrzunehmen und so Erkrankungen zum frühesten Zeitpunkt zu erkennen.
Natürlich wurden wir auch von Fachärzten unterrichtet, die uns die Regeln der Geburtshilfe und anderes mehr in theoretischer wie in praktischer Hinsicht beibrachten.
Einer unserer wichtigsten Lehrer war Dr. Neuhaus – ein Zyniker und überzeugter Junggeselle, der, auf seine Ehelosigkeit angesprochen, zu sagen pflegte: »Warum soll ich mir eine Kuh kaufen, wenn ich gele-gentlich ein Glas Milch trinken möchte?« Seine Ausdrucksweise war nicht immer erste Wahl, seine Aussprache laut, seine Worte hart und schneidend. Wir hatten heiligen Respekt vor ihm. Doch eines Tages, es war kaum zu glauben, bewies er, dass er das Herz am rechten Fleck hatte, dass er ganz anders sein konnte, als er sich nach außen gab.
Ein kleines Mädchen wurde eingewiesen, das durch eine Vergewaltigung übel zugerichtet worden war. Das Kind weinte, schrie und zitterte am ganzen Körper. Es reagierte mit heftiger Ablehnung auf alle Männer und ließ keinen Arzt an sich heran. Nur Dr. Neuhaus gelang es, die Kleine mit einfühlsamen Worten zu beruhigen. Er nahm sich sehr viel Zeit für dieses unglückliche Geschöpf und gewann so das Vertrauen des Kindes. Auch konnte er die körperlichen Verletzungen, die diesem Mädchen zugefügt worden waren, einigermaßen beheben, die seelischen Wunden jedoch konnte auch er nicht heilen. Da bedurfte es sicher eines langen Prozesses, wenn eine Heilung überhaupt jemals möglich war. Von nun an betrachteten wir jedenfalls diesen Mann mit anderen Augen, und im Rückblick auf diese Zeit habe ich erkannt, dass er trotz seiner rauen Schale ein großartiger Mensch, ein hoch qualifizierter Facharzt und ein guter Lehrer war, dem ich viel zu verdanken habe.
Ein wichtiges Unterrichtsgebiet war es, krankhafte Geburtsvorgänge und anormale Lagen nicht nur zu erkennen, sondern auch mit ihnen umzugehen, denn solches Wissen war vor allem notwendig bei Hausgeburten, wo man auf sich allein gestellt war. Hier unterrichtete uns Dr. Dubrausky, ein Arzt ungarischer Abstammung, der sich redlich bemühte, uns alle möglichen Szenarien in Theorie und Praxis zu erläutern. Später hatte ich noch oft seine Hinweise und Empfehlungen im Ohr, wenn ich in schwierigen Situationen Entscheidungen treffen musste.
Über allen Ober- und Assistenzärzten thronte Professor Burger, der »Gott in Weiß«, vor dem alle in die Knie sanken, besonders dann, wenn er schlecht gelaunt war. Er ging würdevoll und gemessen; bei ihm war es kein Gehen, sondern vielmehr ein Schreiten – ohne Hektik, ohne Eile. Hatte er, was selten genug vorkam, gute Laune, so erzählte er seiner Begleitmannschaft auf dem Weg zur Visite langatmige Witze, die jeder Komik entbehrten. Komisch war nur, dass seine Begleitung schallend lachte, obwohl es doch nichts zu lachen gab. Sie alle plagten uns mit ihren Referaten, Belehrungen, Ermahnungen, mit ihrer Strenge. Heute weiß ich, dass dies alles zu unserem Besten geschah und wir ihnen viel zu verdanken haben. Ohne sie wären wir nicht geworden, was wir sind oder waren.
»Hausschwangere«
Es kam damals oft vor, dass Schwangere nicht zu einem Hausarzt gingen, sondern die ganze Zeit zur Betreuung in die Universitätskliniken kamen. Hier wurden sie nämlich kostenlos behandelt, wenn sie sich gewissermaßen als Anschauungs- und Unterrichtsmaterial für junge Ärzte, Studenten und Hebammenschülerinnen zur Verfügung stellten. Man bezeichnete sie als »Hausschwangere«.
Wenn es ans Gebären ging, mussten sie ertragen, dass im Kreißsaal mehrere Leute um sie herumstanden und ein Oberarzt sämtliche Geburtsvorgänge erklärte. Die werdenden Mütter mussten sich auch in Hörsälen sowie bei Prüfungen der Studenten zur Verfügung stellen.
Sicherlich gefiel ihnen das nicht, doch viele von ihnen hatten keine andere Wahl. Die meisten von ihnen kamen aus problematischen Familien, waren in finanzielle Schwierigkeiten geraten oder von ihren Partnern in der größten Not alleingelassen worden. Trotz allem sagten diese Frauen Ja zu ihren ungeborenen Kindern und bekannten sich zu ihnen. Schon deshalb verdienten sie weit mehr Achtung, als ihnen gemeinhin damals entgegengebracht wurde.
Es war schon damals erstaunlich für mich zu sehen, dass gerade bei diesen Frauen die Mutterliebe in ganz besonderem Maße ausgeprägt war. Das kleine Wesen, das in ihre Arme gelegt wurde, überschütteten sie meist mit Liebesbeweisen, denn oftmals fühlten sie sich durch dieses Kind nicht mehr so allein und einsam. Hier war ihnen ein Wesen geschenkt worden, das zu ihnen gehörte, das ihren Schutz und ihre Hilfe brauchte.
Nicht alle Mütter waren jedoch in der Lage, ihr Kind nach der Geburt bei sich zu behalten. Einige Kinder wurden zur Adoption freigegeben und fanden liebevolle Ersatzeltern, die ihnen die Geborgenheit in einer Familie geben konnten. Ihnen erging es gut. Die meisten dieser Kinder aber kamen in Heime, weil die Mütter glaubten, sich nicht ganz und für immer von ihnen trennen zu können. Mit dieser Entscheidung erwiesen sie ihren Kindern jedoch oft einen schlechten Dienst, denn es fehlte ihnen an der notwendigen liebevollen Zuwendung, ohne die ein so junges Leben nicht gedeihen kann. Heime können für ausreichende Nahrung und Pflege sorgen, aber sie können trotz aller Anstrengungen nicht jenes Maß an menschlicher Wärme, an Schutz und Geborgenheit bieten, wie es ein intaktes Elternhaus vermitteln kann.
Die neunzehnjährige Wilma war eine dieser Hausschwangeren. Sie bekam immer große, ängstliche Augen und feuchte Hände, wenn sie als Lernobjekt geholt wurde und sich vor den Studenten ausziehen musste. Sie war still und schweigsam, ihr Leben und ihre Vergangenheit kannte niemand, denn darüber sprach sie nie. Als die Wehen einsetzten, weigerte sie sich, sofort, wie es die Regel war bei diesen Frauen, in den Kreißsaal zu gehen. Sie wollte auf diese Weise den häufigen Untersuchungen durch die Studenten entgehen. Wilma hatte Glück, denn mittlerweile war es Nacht geworden, und man hatte die Studenten nach Hause geschickt.
Wenig später hielt sie ihr Kind im Arm, das sie immer wieder streichelte, fürsorglich zudeckte und mit Küssen bedeckte. Ich stand nur da, wartete und betrachtete die Szene. Mir war elend zumute, denn Wilma wollte ihr Kind zur Adoption freigeben, und deshalb musste ich es ihr wegnehmen, für immer.
Es war ein Augenblick, den ich bis heute in meinem Gedächtnis behalten habe. Damals wusste ich noch nicht, dass ich in meinem späteren Berufsleben des Öfteren in eine ähnliche Lage kommen sollte. Als ich ein paar Tage danach Wilma noch einmal im Krankenhaus begegnete, sagte sie traurig: »Ich habe so viel gebetet und auf ein Wunder gehofft, dass ich mein Kind behalten könnte, aber in dieser Welt gibt es keine Wunder.«
Zur selben Zeit lag in einem anderen Teil der Klinik auf der Privatstation eine junge Frau, die unter schweren Depressionen litt. Sie hatte durch eine Fehlgeburt ihr Kind verloren, das sie mit Hilfe ärztlicher Kunstgriffe der Natur nach langem Kampf abgetrotzt hatte. Der Tod des Kindes und vor allem die ärztliche Diagnose, dass sie nie mehr schwanger werden könnte, hatten sie in tiefe Depressionen gestürzt, denen die Ärzte selbst mit Medikamenten nicht beikommen konnten.
Wie ein Wunder kam zu ihr Wilmas kleines Mädchen, und diese Zusammenführung entwickelte sich für beide Teile zum großen Glück. Das Kind erreichte, was ärztliche Bemühungen nicht zustande gebracht hatten, nämlich die dauerhafte seelische Genesung seiner Adoptivmutter, und diese gab ihrerseits dem heimatlosen Kind ein beschützendes, liebevolles Zuhause.
Hexen und Hebammen
Wer kennt sie nicht, die Prüfungsangst, die einen befällt, wenn man die in der Ausbildung erworbenen Kenntnisse unter Beweis stellen muss? Es ist wie ein Fieber, das einen befällt und an den ohnehin strapazierten Nerven zerrt.
Nur noch wenige Tage trennten uns von dem herbeigesehnten und doch so gefürchteten Ereignis, dem Examen, als ich einen Brief von meiner früheren Lehrerin erhielt. Fräulein Wiegand war bereits zu jener Zeit, als ich noch zur Schule ging, eine ältere Dame, die die mittleren Jahrgänge unterrichtet hatte. Inzwischen musste sie längst im Ruhestand sein. Sie war ein wenig schrullig gewesen, recht eigen und kränkelte ihr Leben lang. Trotzdem regierte sie in der Schule mit strenger Hand. Mich jedoch hatte sie in ihr Herz geschlossen, was sich unter anderem daran zeigte, dass sie mich jeden Tag losschickte, bei ihrer Haushälterin die Medizin abzuholen.
An all das dachte ich zurück, als ich den Brief öffnete, der mich so unerwartet erreichte. Ich war wie vor den Kopf geschlagen, als ich las, was Fräulein Wiegand mir da in ihrer eigenwilligen Schrift mitteilen zu müssen glaubte.
Auf mehreren Seiten legte sie mir dar, wie enttäuscht sie von mir und meiner Berufswahl sei. Da hieß es: »Ein halbwegs anständiger Mensch, und zu diesen zähle ich Dich, wird einen solchen Beruf niemals wählen, denn nur Frauen der unteren Gesellschaftsschichten sind in diesem Bereich tätig. Deine Berufswahl ist umso bedauerlicher, wenn man bedenkt, dass es in manchen Kirchen sogar einen besonderen Platz in der hintersten Ecke für die Hebamme und den Abdecker gibt, weil diese Personen als unterprivilegiert gelten. Nein, meine Liebe, nein! Ich hätte Dich lieber als Lehrerin gesehen!« Es folgte eine Rückschau auf das Mittelalter, auf die Zeit der Hexenverbrennungen, in der jede dritte Frau, die als Hexe verbrannt wurde, eine Hebamme war. In Köln seien damals fast alle Hebammen der Inquisition zum Opfer gefallen, weil sie in dem zweifelhaften Ruf standen, übersinnliche Kräfte zu besitzen, und deshalb als Hexen galten. Die Hexerei, so erläuterte mir Fräulein Wiegand weiter, sei als Gotteslästerung und damit als schweres Verbrechen angesehen worden. Die Verfolgung überließ man der Kirche, die überall Inquisitionsgerichte bildete und dort unter schrecklicher Folter Geständnisse erpresste, an deren Ende zumeist der Tod durch Verbrennen stand.
Beim Lesen dieser Zeilen lief es mir kalt über den Rücken. Das war ja ungeheuerlich! Sollte das alles wahr sein, fragte ich mich damals und war geneigt, die schrecklichen Beschreibungen dem fortgeschritte-nen Alter von Fräulein Wiegand zuzuschreiben. Ein Spruch unseres Pfarrers, der mit der alten Lehrerin nicht auf bestem Fuß stand, fiel mir dabei ein. Er hatte gemeint, dass jemand, der wie Fräulein Wiegand das Lexikon von vorn bis hinten auswendig gelernt hatte, irgendwann zu spinnen anfangen müsste. Damals vertraute ich auf die Worte des Seelenhirten, später erkannte ich, dass er dem Fräulein Wiegand bitter Unrecht getan hatte.
Jedenfalls saß ich erst einmal wie erstarrt da, bis ich den Brief ganz zu Ende lesen konnte. Am Schluss hieß es einlenkend: »Obwohl ich Deine Entscheidung nicht begreife, so muss ich sie doch respektieren, wenn dieser Beruf wirklich Dein besonderer Wunsch war.« Ich war ganz schön durcheinander und dachte, es wäre besser gewesen, der Brief hätte mich erst nach dem Examen erreicht. Aber die Geschichte ließ mir keine Ruhe, und ich begann, nach entsprechender Literatur zu suchen, und musste meiner alten Lehrerin Abbitte leisten. Fräulein Wiegand war gut informiert und hatte keineswegs übertrieben, denn solch schreckliche Dinge hatten sich während des gesamten Mittelalters hindurch, also einige Jahrhunderte lang, tatsächlich ereignet, und zwar im Namen Gottes. Zum Glück brachte dann eine neue Zeit, die moderner und aufgeklärter dachte, auch neue Erkenntnisse und gesellschaftliche Anerkennung dieses Berufes.
In den Tagen des Examens war Schwester Else vollauf damit beschäftigt, uns Prüflinge zu beruhigen und unser Selbstvertrauen zu stärken. Mit Zuckerstückchen, auf die sie Baldrian tropfte, versuchte sie uns den letzten Rest Angst zu nehmen. Sie versicherte, dies sei das einzige und zuverlässigste Mittel gegen Prüfungsangst. Es wirkte tatsächlich, aber vermutlich war es nicht nur der Baldrian, der uns diese Tage gut überstehen ließ, sondern es waren auch ihre warmen, beruhigenden Worte, die halfen.
Aller Anfang ist schwer
Sicher hat jeder schon einmal das befreiende Gefühl erlebt, das einen nach einer bestandenen Prüfung erfüllt! Man fühlt sich rundherum zufrieden und glücklich, auch ein wenig stolz, und alle Ungewissheit, alle Ängste und Sorgen scheinen der Vergangenheit anzugehören. Die Zukunft erscheint vielversprechend und in rosigem Licht.
Nun war ich also Hebamme, staatlich geprüft, freiberuflich, mit den notwendigen Dokumenten ausgestattet: dem Examenszeugnis, der Anerkennung als Hebamme und einer Niederlassungserlaubnis. Damit war ich berechtigt, den Beruf in eigener Verantwortung auszuüben. Ich freute mich auf meine zukünftige Arbeit als »Storchentante«, die am Anfang des Lebens steht, helfend, beschützend, sorgend, der das Wohlergehen von Mutter und Kind anvertraut ist. Man hoffte immer, dass alles glatt laufen würde, aber ich wusste auch, dass es leider oftmals Komplikationen gab, in denen man sich zu bewähren hatte. Darauf waren wir während der Ausbildung immer wieder hingewiesen, aber auch praktisch vorbereitet worden. Die Lehren, die man uns dort mitgegeben hatte, begleiteten mich all die Jahre und erwiesen sich gerade in schwierigen Situationen als äußerst hilfreich.
Es war ein heißer Julitag, die Luft flimmerte schon am frühen Morgen, als ich die Hebammenlehranstalt in Würzburg verließ. Mein Mann umarmte mich und gratulierte mir zu meinem erfolgreichen Abschluss. Ein neuer Lebensabschnitt lag vor mir, dem ich mit viel Optimismus entgegensah.
Damals verdrängte ich den Gedanken, dass mich nicht nur erfreuliche Dinge erwarten würden, dass es oftmals ein hartes, beschwerliches Leben sein würde. Es sollte für mich künftig viele Jahre lang keinen Urlaub, kein freies Wochenende, keinen Feiertag mehr geben, dafür jede Menge schlaflose Nächte. An diese dauernde Anstrengung musste ich mich erst gewöhnen – auch daran, vertraut mit eigentlich fremden Menschen umzugehen, die Hilfe und Zuspruch von mir erwarteten. Oft bekam ich in den ersten Jahren zu hören, ich sei noch zu jung für eine Hebamme, oder man fand, meiner Figur mangele es an jener mütterlichen Rundlichkeit, die in den Augen vieler Frauen Schutz und Trost zu gewähren schien. Sie hätten sich eine reife, Sicherheit ausstrahlende Persönlichkeit gewünscht, und zumindest äußerlich konnte ich ihnen das nicht bieten. Es war mir allerdings schon damals unverständlich, warum das eine entscheidende Rolle für mein Berufsleben spielen sollte – aber zunächst sammelte ich dadurch Minuspunkte und dachte, das könne ja heiter werden.
Noch etwas anderes beeinträchtigte meine Freude über die bestandene Prüfung, und das hing mit der Niederlassungserlaubnis zusammen, die mir manche schlaflose Nacht bereiten sollte, noch bevor ich als Hebamme zum Einsatz kam.
Das Gesundheitsamt hatte mir die Genehmigung erteilt, mich in dem kleinen Ort Grünbach an der Donau niederzulassen. Dort wurde mir eine Wohnung zur Verfügung gestellt, die trotz der Wohnungsnot nach dem Krieg leer stand. Früher hatte dort ebenfalls die Hebamme gewohnt. Feudal war sie nicht, meine zukünftige Bleibe, dachte ich, als ich sie das erste Mal in Augenschein nahm. Sie bestand aus zwei kleinen Räumen in einem abgelegenen Bauernhof, die keinerlei moderne Annehmlichkeiten boten und zudem eigentlich dringend eine gründliche Renovierung benötigt hätten. Es gab kein fließendes Wasser und keine Innentoilette, noch nicht einmal in Form eines Plumpsklos. Das Wasser müsse ich mir am Brunnen hinterm Haus holen, erklärte die Bauersfrau, und das Häusl, wie es in Bayern heißt, sei da hinten beim Misthaufen, sagte sie und deutete mit dem Finger in eine un-bestimmte Richtung.
Na ja, dachte ich resigniert, die neue Zeit hatte hier wirklich noch nicht Einzug gehalten.
Schlimmer jedoch als der mangelnde Komfort waren für mich die Hofhunde, die mich gleich bei meiner Ankunft zähnefletschend begrüßt hatten und wild entschlossen schienen, jedem Fremden den Zutritt zum Anwesen zu verwehren. Ich jedenfalls beschloss, dass es sicher wäre zu warten, bis jemand, alarmiert durch das wütende Gebell, herbeikam, um nach dem Rechten zu sehen.
So war es denn auch, denn kurz darauf tauchte eine Frau auf, offensichtlich die Bäuerin, die sich die Hände an der Schürze abtrocknete, mich kritisch musterte und fragte: »Möchtest du zu uns?«
Ich erklärte ihr den Zweck meines Besuches und warf dabei immer wieder argwöhnische Blicke auf die Hunde, die mich schnuppernd umkreisten und mich ständig belauerten.
»Ach so, die neue Hebamme bist du«, staunte sie stirnrunzelnd, während wir ins Haus traten. »Du darfst dir aber noch ein paar Pfund zulegen, das tät dir nicht schaden. Wenn ich da an unsre alte Hebamme, Gott hab sie selig, denke, die war schon ganz anders beisammen«, sagte sie und deutete mit ihren Händen üppige Rundungen an.
Sie führte mich in die Stube, bot mir einen Platz an und klärte mich über verschiedene Besonderheiten meiner neuen Wirkungsstätte auf. Ihre Schürze glättend sagte sie: »Ich hab gewiss nichts gegen dich, aber lass dir sagen, dass deine Vorgängerin es nicht lang ausgehalten hat bei uns. Hier würde man ja verhungern, hat sie gemeint, weil kaum was zu tun sei. Weißt, der Ort hier ist klein, und direkt in den Ort gegenüber kann man nicht, weil’s hier keine Brücke gibt. Da muss man einen Riesenumweg machen. Deshalb hatte sie nur so wenige Leute zum Betreuen, und von sich aus ist sowieso niemand zum Anmelden gekommen, weil alle Angst vor unseren Hunden haben. Na ja, in dem Zustand kann man das schon verstehen.«
Für mich taten sich Abgründe auf, die ich niemals erwartet hätte. Alle Freude, all meine Träume und meine Begeisterung schienen sich in nichts aufzulösen. Ich war den Tränen nahe.
Die Bauersfrau muss wohl meine Verzweiflung erkannt haben, denn sie gab mir mitleidig Ratschläge, wie ich, falls ich hierbleiben würde, zumindest das Verhungern verhindern konnte. »Da musst dir halt zusätzlich eine Arbeit suchen. Mancher Bauer ist froh, wenn er beim Heuen oder Kartoffelaufsammeln eine Hilfe kriegt, und zu viel verlangen wirst ohnehin nicht. Bei uns geht da nichts, denn wir sind selbst genug und brauchen hier keine Fremden.«
Nach einer kurzen Pause, in der jede von uns ihren Gedanken nachhing, fühlte sich die Bäuerin bemüßigt, den schlechten Nachrichten noch eine weitere hinzuzufügen.
»Bist eigentlich verheiratet?«, fragte sie, und als ich nickte, fügte sie seufzend hinzu: »Dann ist’s doppelt schlecht für dich, denn Arbeit kriegt dein Mann bei uns keine.«
Das waren ja deprimierende Aussichten! Meine Gedanken wirbelten durcheinander. Es war, als schwankte alles in der Stube einschließlich der Bauersfrau, die mich mitleidig betrachtete.
»Wie kann man bloß einen solchen Beruf lernen, wenn man noch so jung ist«, meinte sie abschließend und schüttelte verständnislos den Kopf.
Mein Optimismus war nun endgültig dahin. Ich fühlte mich müde, erschöpft und wollte alles andere lieber, als dieses Gespräch fortzusetzen. Ich verabschiedete mich von der Bäuerin mit den sicher gut gemeinten Ratschlägen, von dem Ort Grünbach, in dem es offensichtlich kaum etwas für mich zu tun gab, und von meinen betrogenen Hoffnungen.
Mit bitteren Gedanken trat ich den Rückweg an. Hinter mir hörte ich das Kläffen der wütenden Hunde, und in meinen Ohren klangen noch die warnenden Worte der Bäuerin, die mich vor einer unvermeidlichen Katastrophe bewahren wollte.
Auf dem Weg durch die Wiesen blieb ich noch einmal stehen, sah das weite Tal vor mir, dahinter die Berge des Bayerischen Waldes und die Donau, diesen unendlichen Strom, der hier Deutschland verlässt, um nach Tausenden von Kilometern im Schwarzen Meer seine Reise zu beenden, dort seine Heimat zu finden. So hatte man es uns in der Schule etwas pathetisch erzählt.
Eben zog ein weißes Schiff über ihre Wellen, leise, majestätisch, vom warmen Schein der untergehenden Sonne angeleuchtet. Für einen kurzen Augenblick konnte ich das soeben Erlebte vergessen, das meinem Leben eine neue Wende geben würde.
Ruhelose Tage kamen auf mich zu, in denen ich mich mit der veränderten Situation auseinandersetzte. Ich wollte und musste eine Lösung finden, die nicht nur für mich, sondern auch für meinen Mann tragbar wäre. Alle meine Überlegungen aber schienen zwangsläufig immer nur zu dem einen Ergebnis zu führen, dass sich in meinem Fall Beruf und Ehe nicht vereinbaren ließen. Es waren zwei Dinge, die einfach nicht zusammenpassten, man konnte es drehen und wenden, wie man wollte. Ich hatte schlechte Karten!
»Die Hoffnung aufgeben heißt versagen«, versuchte mein Mann mich zu ermutigen. »Wir werden gemeinsam einen Weg finden, damit die Rechnung aufgeht. Sie wird aufgehen, glaub mir.«
Gute, tröstende Worte waren es, bei denen es mir warm ums Herz wurde und denen ich nur zu gern glauben wollte.
Es brauchte viel Zeit und noch mehr Geduld, bis wir diesen Nenner gefunden hatten. Dabei zeigte sich auch, welch verlässlichen Partner ich in meinem Ehemann hatte. Auch später unterstützte er mich stets, nahm alle Unzulänglichkeiten, die mein Beruf mit sich brachte, geduldig und ohne Klagen hin und hat alles mit mir getragen. Meine Familie ist später der ruhende Pol für mich geworden, aus dem ich die Kraft für meinen anstrengenden Alltag schöpfen konnte.
Meine Niederlassungserlaubnis für den Ort Grünbach allerdings musste ich, da ich dort unter den gegebenen Umständen nicht tätig sein konnte, an das zuständige Gesundheitsamt zurückgeben. Ich tat es schweren Herzens, denn ohne dieses Dokument durfte ich keine Hausgeburten betreuen, und etwas anderes gab es damals für mich nicht. Kliniken und Krankenhäuser hatten nämlich ihre eigenen Leute, so dass hier jede Anfrage sinnlos gewesen wäre.
Aber ich vertraute darauf, dass auch für mich auf Regen irgendwann Sonnenschein folgen würde. Ganz überraschend bot sich dann die Gelegenheit, sich um einen Hebammenbezirk in einem größeren Ort zu bewerben. Es schien die Erfüllung eines Traumes, denn ich kannte und liebte den Ort, und der Bürgermeister, ein alter Freund unserer Familie, hatte mir zudem schon vor Jahren die Niederlassung zugesichert, falls sich eine Änderung ergebe. Nun war es also so weit, denn die Stelle wurde frei.
Überglücklich ging ich aufs Rathaus, um den Bürgermeister an sein Versprechen zu erinnern und um eine Ausstellung der Niederlassungserlaubnis zu bitten, die dann nur noch von amtsärztlicher Seite be-stätigt werden müsste.
Wenn ich nun in dem Glauben war, für mich sei die Wende zum Guten endlich eingetreten, so musste ich noch einmal eine herbe Enttäuschung hinnehmen. Der Bürgermeister nämlich nahm mir mit seinen Worten sämtliche Illusionen.
»Dass ich dir etwas versprochen habe, davon weiß ich nichts, durchaus gar nichts. Wenn du was Schriftliches aufweisen kannst in der Sache, dann reden wir weiter«, wies er mich zurecht.
Nein, das konnte ich nicht, und das wusste er auch genau.
»Also nicht«, fuhr er fort. »Dann muss ich dir eines sagen: Nur das Geschriebene gilt auf dem Amt, sonst nichts.« Dabei betonte er seine Worte mit fester, harter Stimme.
Und um das Gesagte noch zu unterstreichen, fügte er nach einer kurzen Pause hinzu: »Nur das schwarz auf weiß Geschriebene gilt. Ich hätte mir gedacht, das würdest wissen, wo du doch jetzt fast eine Studierte bist.«
»Ich weiß es«, antwortete ich. »Sie haben mir vor allem deutlich bewiesen, dass ein gegebenes Wort von Amts wegen keine Gültigkeit hat.«
Als ich mich nach diesen Worten zum Gehen wandte, hielt er mich zurück, um mir noch etwas zu sagen.
»Und überhaupt, das liegt nicht an mir, aber es hat sich schon eine andere beworben. Die hat uns der Amtsarzt empfohlen, weil sich die zwei gut kennen, von der schlechten Zeit her, weißt. Da hat man es schwer als Bürgermeister«, meinte er entschuldigend.
Ja, was sollte ich da noch sagen? So lief das eben, aber wieder einmal war ein Traum ausgeträumt. Meine Konkurrentin bekam die begehrte Niederlassungserlaubnis, und ich ging leer aus. Ich fühlte mich ungerecht behandelt und konnte das nur schwer verwinden. Aber mein Erlebnis auf dem Bürgermeis-teramt war erst der Anfang einer langen Reihe von Schwierigkeiten und Rückschlägen.
Mutlos machte ich mich auf den Heimweg. Da fiel mir die Babett ein, die ich schon von Kind auf kannte und der man einen sechsten Sinn nachsagte. Sie wohnte allein in ihrem bescheidenen Häuschen, dessen Haustüre immer offen stand, damit jeder, der müde war oder in einen Regenguss kam, bei ihr ausruhen oder unterstehen konnte. »Das ist Christenpflicht, und zum Mitnehmen gibt’s bei mir ohnehin nichts«, pflegte sie zu sagen.
Alt war sie geworden, die Babett, und ein wenig krumm der Rücken, seit ich sie das letzte Mal gesehen hatte.
»Des Gehwerk taugt nimmer viel«, meinte sie ohne großes Bedauern. Aber ihre hellen Augen sahen dem Besucher unverändert wach und voller Interesse entgegen.
Auf meine Frage, wie es ihr denn gehe, antwortete sie: »Na ja, man muss zufrieden sein, wenn man jeden Tag aufstehen kann in meinem Alter.«
Wir kamen ins Gespräch, auch über meine schwierige Lage, über die Hindernisse, die sich der Verwirklichung meiner beruflichen Träume entgegenstellten. Es sei, klagte ich, als ob sich alles gegen mich verschworen hätte.
Die Babett, durch ihr Alter weise geworden, antwortete: »Na, na, Dirndl, so darf man nicht reden, wenn man zwei gesunde Arme hat. Alleweil neigt sich das Gewicht nicht zu einer einzigen Seite, das ist Naturgesetz. Du machst deinen Weg schon noch, einen guten, geraden Weg wirst gehen, aber nicht gleich, es wird noch ein Haufen Ärger auf dich zukommen. Ja, er ist krumm und steinig, der Weg, den du jetzt für kurze Zeit zu gehen hast. Dann aber hast ein gutes Leben vor dir.«
Das alles sprach sie mehr zu sich als zu mir.
Plötzlich richtete sie sich in ihrem Sessel auf, nahm meine Hand und sagte: »Denk dir nichts, Dirndl, der Herrgott macht’s schon recht, er hat’s noch alleweil recht gemacht. Er lässt dich nicht allein.« Noch immer hielt die Babett meine Hand, und mir war, als ströme sie Trost und Zuversicht aus.
Ich musste lange über ihre Worte nachdenken, dass ich einen guten Weg vor mir hätte, aber nicht sofort, dass zunächst Ärger auf mich wartete. Wahrheit, Fantasie, Träume? Wer sollte das wissen! Heute, nach mehr als fünf Jahrzehnten, aber weiß ich, dass die Babett damals der Wahrheit sehr nahe gekommen ist. Woher kam ihr Wissen? Hatte sie wirklich den sechsten Sinn, der ihr nachgesagt wurde und den die Menschen gern in das Reich der Fantasie verweisen?
In den Maschen der Paragrafen
Sehr bald sollte ich zu spüren bekommen, was es mit dem Ärger auf sich hatte, den mir die Babett vorausgesagt hatte. Die Geschichte, die ich da erlebte, stimmt nachdenklich, weil sie viel über unsere Welt der Gesetze und Paragrafen aussagt – eine Welt, undurchsichtig und für Nichtjuristen kaum durchschaubar, darüber hinaus kalt und hart, weil sie auf das menschliche Herz keine Rücksicht nimmt.
Folgendes hatte sich ereignet: Es war eine trübe, neblige Oktobernacht, Allerheiligen war nicht mehr weit, als jemand an unsere Tür klopfte, laut und energisch. Es klang, als ob diese Person ein sehr dringendes Anliegen hätte.
Als ich öffnete, stand der Heini Hinterbichler vor mir, ein Häusler, der in der Nähe wohnte. Dicke Schweißtropfen standen auf seiner Stirn, und mit flehendem Blick stotterte er: »Musst gleich mit mir gehen, bei der Resi, meinem Weib, da pressiert’s nämlich. Ich lauf schon so lang wegen einer Hebamme herum, aber keine ist da. Jetzt tät ich dich halt bitten, dass du uns hilfst.«
Etwas verworren kamen diese Worte, und die ängstliche Nervosität des Mannes war nicht zu überhören. Doch ich musste ihm sagen, dass ich keine Niederlassungserlaubnis besäße und somit laut Gesetz keine Geburtshilfe leisten dürfe.
»Was interessiert mich der Fetzen Papier, wir brauchen dich, und zwar gleich, alles andere ist mir egal«, war seine ungeduldige Antwort. »Das erste Kind«, fuhr er fort, »ist uns bei der Geburt schon gestorben, beim zweiten soll’s nicht wieder so kommen.«
Ein Notfall also, bei dem schnelle Hilfe angesagt war. Wer wäre wohl imstande gewesen, diesen Menschen, die so dringend Hilfe brauchten, die Unterstützung zu verweigern? Niederlassungserlaubnis – dieses Wort war im Augenblick für mich reine Theorie. Was zählte, war nur die Tatsache, dass eine werdende Mutter mich brauchte, dass ich ihr helfen musste, dieses Mal ihr Kind lebend zur Welt zu bringen.
So ging ich mit dem Hinterbichler hinaus in die Nacht, zu dem kleinen Häuschen am Dorfrand, in dem seine Frau schon auf uns wartete. Sie lag auf einem Strohsack und kämpfte sichtlich mit starken Wehen. Bei unserem Eintreten hauchte sie: »Vergelt’s Gott, dass d’ kommst.«
Schweiß stand auf ihrer Stirn, ihre Augen waren groß vor Angst um ihr Kind, das nicht sterben sollte, bevor es eigentlich zu leben begonnen hatte.
Ich untersuchte sie. Die Fruchtblase wölbte sich weit vor, ohne sich von allein zu öffnen. Doch ein kleiner Stich von meiner Hand genügte, und das Fruchtwasser floss unter starkem Druck nach allen Seiten in den Strohsack hinein. Und dann kam auch schon ein kleines Wesen beim Schein einer schwachen Petroleumlampe auf die Welt. Das winzige Mädchen war blaurot, hatte die Nabelschnur um den Hals geschlungen und begann nur mühsam zu atmen. Erst als ich es von dieser Schlinge befreite, schrie es – erst krächzend, dann laut und kräftig. Es war ein glücklicher Augenblick für alle in dieser bescheidenen Stube.
In diesen Minuten hatte ich allen Kummer, der hinter mir lag, vergessen, auch dieses verflixte Dokument »Niederlassungserlaubnis«, ohne das es für mich keine Arbeit gab. Ich sah nicht mehr dieses ärmliche Zuhause, den nassen Strohsack, der jetzt neu gefüllt werden musste, nicht die Petroleumlampe, deren Schein immer schwächer wurde, ich sah nur noch das Kind, das vielleicht durch meine Mithilfe leben konnte. Als ich die Freudentränen in den Augen der Eltern bemerkte, da war ich mehr als zufrieden.
Gegen Morgen verabschiedete ich mich von diesen bescheidenen Menschen, sah noch einmal nach der kleinen Katharina, die an ihrem Daumen nuckelnd zufrieden im Arm der Mutter lag und von den Wirrnissen und Sorgen des Lebens noch nichts wusste. Am nächsten Tag würde die zuständige Kollegin, die dann wieder erreichbar war, die Wochenpflege übernehmen. Ich aber würde noch lange zurückdenken an die glückliche Stunde dieser Geburt in einer nebelverhangenen Oktobernacht.
Tage vergingen, ohne dass sich etwas Besonderes ereignete. Ich war immer noch ohne Niederlassungserlaubnis und somit weiterhin ohne Arbeit.
Allerheiligen, der Tag, an dem wir unserer Toten gedenken, war gerade vorbei, als ein an mich gerichtetes Schreiben ins Haus kam. Absender war das Staatliche Gesundheitsamt Battenburg, der Brief war eingeschrieben, also hochoffiziell.
»Musst unterschreiben«, belehrte mich Vitus, der Postbote, »damit alles seine Ordnung hat.« Und so bestätigte ich mit meiner Unterschrift den Erhalt des amtlichen Schreibens.
Ein ungutes Gefühl überkam mich, als ich es mit zitternden Händen öffnete. Meine Ahnungen bestätigten sich, als ich zu lesen begann: »Sie werden aufgefordert«, so hieß es da, »am 5. November im Gesundheitsamt Battenburg, Zimmer 4, beim Amtsarzt Dr. Schauer vorstellig zu werden.« Begründung: »Vergehen gegen das Hebammengesetz«.
Das war es also! Ein gut funktionierender Nachrichtendienst war hier wohl am Werk gewesen, der über meine rechtswidrige Geburtshilfe sehr genau informiert war und dieses Wissen an das Gesundheitsamt weitergeleitet hatte. Ein Kenner der besagten Paragrafen und Vorschriften, wie es schien!
Dann stand ich also vor dem Amtsarzt, der von mir wissen wollte, ob diese Anschuldigung, die gegen mich vorgebracht wurde, der Wahrheit entspreche. Erstaunt stellte ich fest, dass das Gesundheitsamt über meine Tätigkeit bis ins Kleinste informiert war. Neben einer Reihe von Details kannte man nicht nur den Tag, sondern auch die genaue Stunde der Entbindung, die ich »rechtswidrig« durchgeführt hatte.
Dr. Schauer als Amtsperson wollte von mir dementsprechend keine Rechtfertigung, sondern ein Schuldbekenntnis. In seinen Augen war ich eine Gesetzesbrecherin, die mit Konsequenzen zu rechnen hatte, falls er weitere Schritte unternähme. Mit hochrotem Kopf ging er in seinem Zimmer auf und ab und schob ständig die goldene Brille auf der Nase hin und her. Dabei ordnete er zuweilen ein paar Blätter, die er gleich wieder beiseitelegte, und schrie mich stattdessen an. Was ich mir überhaupt erlauben würde, mich über Gesetze hinwegzusetzen? Diese seien schließlich dazu da, dass sie beachtet würden. Von unsauberen Machenschaften war die Rede, von Manipulation und von unerlaubten Übergriffen in den Arbeitsbereich von Kolleginnen.
Schließlich unterbrach ich seinen Wortschwall und sagte: »Sie wollen keine Rechtfertigung von mir, Herr Amtsarzt, Sie möchten ein Schuldbekenntnis, weil ich einer werdenden Mutter, die mich dringend darum gebeten hatte, in ihrer Not ohne Entgelt geholfen habe. Sollte ich jemals wieder in eine ähnliche Lage kommen, würde ich es wieder tun, auch ohne Niederlassungserlaubnis, die Sie in meinem Fall nun mit Sicherheit blockieren werden, damit dem Gesetz Genüge getan wird.«
»Sie werden von mir noch hören«, schrie er, »gehen Sie!«
Dieser Arzt schien seine eigentliche Aufgabe vergessen zu haben, dachte ich bei mir. Wo waren wir hingekommen, wenn Paragrafen und Gesetze mehr zählten als lebensnotwendige Hilfe?
Beim Verlassen des Amtsgebäudes musste ich mich über mich selbst wundern, dass ich ruhig, ohne Erregung, das vorgebracht hatte, was mir auf dem Herzen lag. Trotzdem hatte mich der Vorfall viel Kraft gekostet, wie ich erst jetzt merkte. Ich spürte, dass meine Hände zitterten, sich feucht anfühlten, dass meine Gedanken zusammenhanglos waren und eine innere Leere sich in mir ausbreitete. Alles um mich herum schien in einen Nebelschleier getaucht, die eilig dahinhastenden Leute auf dem Gehsteig ebenso wie die Kinder, die einem roten Ball nachliefen und voller Lebensfreude wild durcheinanderschrien. Unwillkürlich musste ich an die kleine Katharina denken, der ich ins Leben geholfen hatte, an die glückliche Stunde damals, die ich, trotz allem, was geschehen war, nicht vergessen wollte.
Tage und Wochen vergingen, Weihnachten war nicht mehr weit, und Schnee und Kälte machten den Menschen das Leben schwer, vor allem denen, die sich viel im Freien aufhalten oder sich den Weg zu ihrem Arbeitsplatz erst mühsam bahnen mussten. Damals wusste ich noch nicht, was es heißt, sich trotz Sturm, Eis und Schnee an sein Ziel zu kämpfen, das man auf jeden Fall erreichen muss. Solche Sorgen plagten mich vorerst noch nicht, dafür jedoch traf mich eine neue Hiobsbotschaft. Es schien, als ob die Aufregungen kein Ende mehr nehmen wollten.
»Hast du es schon gehört?«, fragte mich eine Nachbarin, »was auf der Gemeindetafel über dich zu lesen ist?«
Nein, das hatte ich nicht.
»Das musst du selber lesen. Aber nicht, dass es dich umhaut«, setzte sie noch warnend hinzu.
Die Neuigkeit musste, der dramatischen Aussage der Nachbarin nach zu schließen, von allergrößter Wichtigkeit sein. Schließlich handelte es sich um einen ganz offiziellen, amtlichen Gemeindeaushang. Ich konnte es nicht fassen, was da schwarz auf weiß in großen Buchstaben zu lesen stand.
»Bekanntmachung«, lautete die Überschrift. »Es wird hiermit den Einwohnern von Battenburg und Umgebung bekannt gegeben, dass Frau Rosalie Linner nicht berechtigt ist, Geburtshilfe zu leisten, noch eine diesbezügliche Tätigkeit auszuüben. Zuwiderhandelnde können mit Strafe belegt werden.«
Unterzeichnet hatte Dr. Schauer, seines Zeichens Amtsarzt und Leiter des Gesundheitsamtes Battenburg. Ganz offensichtlich wollte mir der Amtsarzt, den mein Mangel an Unterwürfigkeit vielleicht in seiner Eitelkeit gekränkt hatte, eine Lehre erteilen und mir klarmachen, dass er immer noch am längeren Hebel saß und mich zu Boden zwingen konnte.
In der Tat war so etwas in einem kleinen Ort, wo jeder jeden kannte, wo jedes Gerücht gierig aufgenommen, diskutiert und zerpflückt wurde, kein geringes Problem. Man nahm den Aushang ernst, und über mehrere Wochen war er Gesprächsthema Nummer eins. Es gab endlich, nach Langem, wieder eine Neuigkeit, über die man Spekulationen anstellen konnte.
»Hat sie wohl die Prüfung nicht bestanden? Oder sich etwas zuschulden kommen lassen? Man hatte zwar nichts gehört in diese Richtung, aber wissen konnte man ja nie.«
»Auf jeden Fall«, so hieß es, »ist sie im Gesundheitsamt nicht gut angeschrieben.«
Der Lehrer Neumeier, der den Aushang mit mehr Überlegung und logischem Denken las, meinte: »Das müsste begründet werden, weshalb ihr jede Tätigkeit als Hebamme verboten ist, sonst ist es ja bloß die halbe Wahrheit.«
Dem Bürgermeister war die Sache äußerst peinlich, als er mich darauf ansprach.
»Die Geschichte ist mir schon arg zuwider«, meinte er. »Ich hätt den Wisch lieber gar nicht ausgehängt, aber das Gesundheitsamt hat das angeordnet. Heute noch, hat der Schauer geschrieben, müsse das öffentlich gemacht werden. Ich kann nichts dafür, von mir ist das nicht ausgegangen. Nichts für ungut.« Und er setzte noch hinzu: »Als Bürgermeister hat man’s schwer.«
Wofür ich auch dieses Mal volles Verständnis hatte.
Die Wogen glätteten sich nach einigen Wochen, und die Tuscheleien verstummten. Dinge, die einen nicht direkt betreffen, geraten schnell in Vergessenheit. Mich jedoch verfolgte dieser Aushang bis in meine Träume. Ich konnte schwer begreifen, dass Hilfeleistung bis zur Diskriminierung bestraft werden konnte. Damals wusste ich zum Glück noch nicht, dass dies alles nur der Auftakt zu einem spektakulären Prozess war, der später Gerichtsakten füllen, der Regierungsvertreter und das Gremium des Hebammenverbandes aufhorchen lassen sollte.
Sie wollen wissen, wie es weitergeht?Dann laden Sie sich noch heute das komplette E-Book herunter!
Weitere E-Books im Rosenheimer Verlagshaus
Tagebuch einer Berghebamme
eISBN 978-3-475-54340-1 (epub)
Kindern auf die Welt zu helfen – keine leichte, aber eine wunderbare, berührende und hoch emotionale Aufgabe mit großer Verantwortung! In einer Zeit, da die Ausübung des Hebammenberufes durch zahlreiche Vorschriften und Einschränkungen immer schwieriger wird, sollten die enormen Leistungen jener Frauen uns allen wieder bewusster werden. Die Geschichten der Berghebamme Marianne hat Roswitha Gruber als einzigartiges Zeugnis eines ganz besonderen Berufsstandes für uns niedergeschrieben.
Erlebnisse einer Berghebamme
eISBN 978-3-475-54328-9 (epub)
In diesem Buch erzählt Roswitha Gruber aufs Neue authentisch und lebendig aus dem Leben der Geburtshelferin Marianne. Wieder hat sie viele interessante Begebenheiten aus deren Berufsalltag zu Papier gebracht. In ihren vielen Arbeitsjahren hat die erfahrene Hebamme über 3.000 Kindern und deren Müttern beigestanden. Die bewegenden Schicksale der Menschen, die sich Marianne anvertraut haben, gehen jedem nahe.
Aloisia
Eine Hebamme spielt Schicksal
eISBN 978-3-475-54375-3 (epub)
Im Kreißsaal einer kleinen Münchner Klinik liegen zwei Frauen in den Wehen. Bei beiden kündigt sich eine komplizierte Geburt an, bei der es um Leben und Tod geht. Die Hebamme Aloisia fühlt sich überfordert. Da die herbeigerufenen Ärzte nicht rechtzeitig eintreffen, sieht sie sich, ganz auf sich selbst gestellt, zum Handeln gezwungen …
Doch ihre eigenmächtige Entscheidung, mit der sie schicksalhaft in das Leben zweier Familien eingreift, wird für lange Zeit ihr Gewissen belasten. Erst als sie 94 Jahre alt ist, kommt die Wahrheit durch einen sonderbaren Zufall ans Licht.
Hanni
Eine Schweizer Bergbäuerin
eISBN 978-3-475-54236-7 (epub)
Hanni, eine Magd aus dem Kanton Uri, heiratet den Witwer ihrer Schwester Maria, denn der Bergbauer braucht eine Mutter für sein Kind und eine Bäuerin für seinen Hof. Aus dieser anfänglichen Zweckgemeinschaft entwickelt sich eine tiefe Liebe, aus der im Laufe der Jahre zwölf Kinder hervorgehen, darunter vier Zwillingspaare. Das Leben der Familie ist von großer Armut, harter Arbeit und vielen Schicksalsschlägen geprägt. Doch unerschütterliches Gottvertrauen und die tiefe Zuneigung der Eheleute lassen sie alle Schwierigkeiten meistern.
Tagebuch einer Landhebamme
eISBN 978-3-475-54357-9 (epub)
Diese Aufzeichnungen von Rosalie Linner über die Jahre 1943 bis 1980 spiegeln das weite Spektrum der Arbeit einer Landhebamme wider: Von freudig erwarteten, aber auch von unerwünschten Kindern ist die Rede, von der Freude und den Nöten in den Familien. Als in seiner Art einmaliges Zeit- und Alltagsdokument sowie als historisches Zeugnis eines ganzen Berufsstandes sind Frau Linners Aufzeichnungen gar nicht hoch genug einzuschätzen. Rosalie Linner schildert beeindruckende Fälle und Begebenheiten und geht dabei auch auf heute sehr aktuelle Themen und Fragen ein, wie zum Beispiel Adoptionen, Vaterschaftsprozesse, behinderte Kinder, Gewalt gegen Frauen und Kindesmissbrauch. Den Leser erwartet ein spannender Bericht.
Besuchen Sie uns im Internet:www.rosenheimer.com