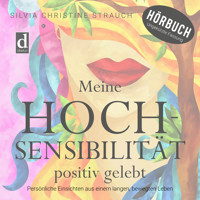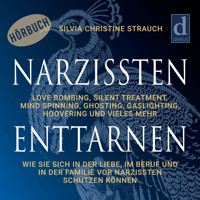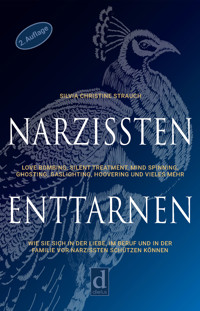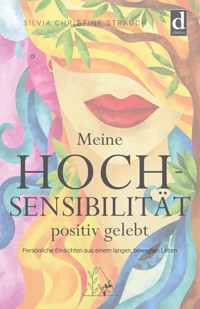
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dielus edition
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Von hochsensiblen Lebenserfahrungen profitieren: Oft wird der rote Faden einer hochsensiblen Existenz erst zur Lebensmitte erkennbar. Dieses Buch zeigt, wie sich Hochsensibilität in ein positives, erfolgreiches Leben verwandeln lässt, ohne sich zu verbiegen. Sie erhalten unmittelbare Einblicke, viele persönliche Erkenntnisse, berührende Erlebnisse und sofort umsetzbare Tipps für Alltag, Beruf und Beziehungen. Entdecken Sie die Gaben Ihrer Hochsensibilität und nutzen Sie sie bewusst, stark und selbstbestimmt. Für alle, die ihre Hochsensibilität nicht verstecken, sondern selbstbewusst entfalten wollen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
GEPRÜFTER BUCHINHALT
• Angebene Autorin hat das Buch vollständig selbst verfasst.
• Buchtext wurde auf Plagiate überprüft.
• Fachliche Aussagen durch Dritte begutachtet.
HERAUSGEBER DIESES BUCHS IST EIN BUCHVERLAG
• Professionelle und hochwertige Buchproduktion.
• Ausreichender quantitativer sowie qualitativer Lesestoff.
• Buch durchlief ein Fachlektorat sowie ein Schlusskorrektorat.
VERIFIZIERTE AUTORIN
• Autorenangaben, Foto, Laufbahn und sonstige Informationen über die Autorin entsprechen den tatsächlichen Gegebenheiten.
• Autorin verfügt über anerkannte Berufsabschlüsse oder fachspezifische Zertifikate.
• Autorin gilt als ausgewiesene Expertin.
www.dielus.com
www.facebook.com/dielusedition
www.instagram.com/dielusedition
MEINE HOCHSENSIBILITÄT POSITIV GELEBT, SILVIA CHRISTINE STRAUCH
Taschenbuchausgabe ©2025 dielus edition, Bosestraße 5, 04109 Leipzig, [email protected].
Impressum siehe auch: www.dielus.com
Alle Rechte vorbehalten.
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Dadurch begründete Rechte, insbesondere der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Vervielfältigungen des Werkes oder von Teilen des Werkes sind auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie sind grundsätzlich vergütungspflichtig.
Bildnachweis Umschlag: ©iStock.com/goccedicolore
Illustration Innenteil: ©iStock.com/nessa2
Lektorat: Maren Klingelhöfer
www.maren-klingelhoefer.de
ISBN 978-3-8194090-2-8
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek: Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über https://portal.dnb.de
Inhalt
Vorwort
1 Eigene Lebenserfahrungen
1.1 Kindheit
1.2 Partnerschaft
1.3 Beruf
1.4 Tiere
1.5 Feste, Veranstaltungen und Sozialleben
1.6 Teamplay
1.7 Abgrenzung
1.8 Urlaub
2 Persönlichkeitsentwicklung voranbringen
2.1 Zeitmanagement
2.2 Positives Denken
2.3 Affirmationen
2.4 Gesundheit
2.5 Sport
2.6 Ernährung
2.7 Progressive Muskelentspannung
2.8 Atemtechniken
2.9 Mantra-Meditation
2.10 Beam
2.11 Hatha-Yoga-Asanas
2.12 Audiovisuelle Stimulation
2.13 Kontemplation
2.14 Visualisierung
2.15 Achtsamkeitstraining
3 Im Alltag Ruhe finden
3.1 Natur
3.2 Stadt
3.3 Sinnesreize
3.4 Drogen
3.5 Kunst und Wissenschaft
3.6 Wohnung, Einrichtung und Ästhetik
3.7 Freunde und Bekannte
4 Persönliches Schlusswort
Vorwort
Hochsensiblen Persönlichkeiten (HSP) nehmen sich schon in der Kindheit als andersartig wahr. Sie verfügen ganz einfach über eine stärkere Sinneswahrnehmung als die Menschen in ihrer Umgebung. Die Eindrücke aller Sinne werden nicht so stark gefiltert wie bei anderen Menschen, was zu einer intensiveren Wahrnehmung der Reize sowie zu einer eingehenderen Verarbeitung führt. Dies kann auch mit einer verstärkten Schmerzwahrnehmung einhergehen sowie mit einer hohen Empfindlichkeit gegenüber Koffein, Alkohol, Medikamenten oder auch Drogen.
Dementsprechend fühlen sich Hochsensible unter den gleichen Umständen schneller gestresst als andere Menschen, nehmen allerdings viele Dinge genauer auf. Hochsensibel zu sein ist nicht mit einer Wertung verbunden. Es hat sowohl Vor- als auch Nachteile, zur Gruppe der hochsensiblen oder der nicht hochsensiblen Menschen zu gehören. Beide Gruppen sind für das Leben notwendig, sonst hätte sie die Evolution nicht hervorgebracht. Es gilt, ihre Eigenschaften zu erkennen, zu achten und sinnvoll einzusetzen.
Hochsensible Personen verarbeiten das Wahrgenommene gründlicher. Ein typisch hochsensibler Mensch ist gewissenhaft und sehr verlässlich und geht auf die Bedürfnisse seiner Umgebung ein – gleichgültig, ob im beruflichen Umfeld wie bei Kunden und Kollegen oder auch im privaten Bereich bei Freunden. Am Arbeitsplatz sind hochsensible Personen darauf bedacht, ein positives soziales Klima zu schaffen. Sie bemerken viele Feinheiten, die anderen verborgen bleiben, fühlen sich aber auch schnell überreizt. Sie können unter Druck schlecht arbeiten. Hochsensible Personen machen auch oftmals einen nicht so geselligen Eindruck, da sie einfach mehr Ruhe benötigen.
Hochsensibilität ist keine Krankheit. Es ist weder eine Neurose noch eine Sozialphobie. Allerdings kann der Begriff Hochsensibilität durchaus als Begründung für Krankheiten missbraucht werden. Hochsensibilität darf nicht als Ausrede gelten für irgendwelche psychischen Störungen. Es ist recht leicht, sich hinter Hochsensibilität zu verstecken, doch das hilft niemandem.
Hochsensibilität ist eine Gabe, die durchaus gepflegt und entwickelt werden kann, vor allem der Umgang damit. Eine hochsensible Person sollte sich, wie jeder andere Mensch auch, weiterentwickeln, dazu gehört die Entfaltung von Körper, Geist und Seele. Die Wege dahin sind etwas anders als bei anderen Menschen. Das Ruhebedürfnis ist größer, somit braucht man zum Beispiel ein sehr gutes Zeitmanagement, um sich Entspannungszeiten gönnen zu können. Wenn ich weiß, dass ich unter Zeitdruck nicht arbeiten kann, dann darf ich es auch nicht dazu kommen lassen und darf nicht anderen Menschen die Schuld daran geben, wenn ich es nicht schaffe. Nur wir selbst sind verantwortlich für unser Tun und Wohlbefinden.
Eine entwickelte Hochsensibilität ist eine große Gabe und fühlt sich an wie der sechste Sinn.
Mitgefühl, Hilfsbereitschaft, soziale Verantwortung, das alles ist sehr wichtig, um zu mehr Menschlichkeit zu gelangen.
Hochsensible Personen sind scharfsinnige Beobachter, aber auch verträumte Einzelgänger. Sie haben eine gute Introspektionsfähigkeit und damit einen guten Zugang zu sich selbst. Eine entwickelte hochsensible Person nimmt die eigenen Bedürfnisse ernst und hat den Mut, die eigenen Gefühle, Träume, Beweggründe und Ansprüche anzusehen und umzusetzen.
Hochsensible Personen besitzen eine hohe Begeisterungsfähigkeit, mögen sich aber oftmals nicht an die normale Welt anpassen. Vieles im normalen Leben erscheint ihnen zu oberflächlich. Sie hinterfragen gerne, es finden sich viele Naturwissenschaftler unter ihnen.
Es gibt mehr hochsensible Personen, als man meint, mit Bedürfnissen, Begabungen, aber natürlich auch Schwächen, die sie von anderen Menschen unterscheiden.
Fast alle Menschen haben eine Seite, die besonders sensibel ist. Auch nicht hochsensible Personen können sensibel sein, aber vielleicht nicht so sehr und nicht so oft wie eine hochsensible Person, deren feine Antennen sehr empfänglich für Reize sind. In diesem Buch möchte ich die Entwicklungsmöglichkeiten für solch hochsensible Menschen aufzeigen, damit diese wunderbare Eigenschaft voll genutzt werden kann.
Viel Spaß beim Lesen.
Silvia Christine Strauch
1.1
Kindheit
○ Wurden Sie als schüchtern bezeichnet?
○ Hatten Sie nur wenige Freunde?
○ Spielten Sie gerne alleine?
○ Litten Sie unter Prüfungsangst?
○ Hielten Ihre Eltern und Lehrer Sie für sensibler als andere Kinder?
○ Schliefen Sie nach einem aufregenden Tag schlecht ein?
Ich wuchs zwar nicht mit Geschwistern auf, aber meine Eltern hatten Pflegekinder, so dass ich zumindest tagsüber nie alleine war. Trotzdem zog ich es vor, sehr oft allein zu spielen und dabei völlig versunken zu sein. Ich konnte stundenlang vor der Puppenstube sitzen und mir Geschichten ausdenken.
Oder ich ließ am Bach, der an unserem Grundstück vorbeifloss, oftmals lange Zeit einen Bindfaden, den ich an einen kleinen Ast gebunden hatte, ins Wasser hängen, um einen Fisch zu fangen. Wahrscheinlich wäre ich zu Tode erschrocken, wenn sich ein Fisch an dem Bindfaden verschluckt hätte. Häufig kam es zu Gezeter, wenn mich meine Mutter zum Essen rief oder mich zum Spazierengehen abholen wollte.
Ich galt als sehr schüchtern, ich erinnere mich daran, dass mir mein Vater einmal 10 Pfennig gab, mit denen ich mir ein Eis kaufen sollte, aber ich verzichtete lieber auf das Eis, als alleine zum Eisstand zu gehen, um mir eines zu holen. Ich konnte doch nicht einen mir fremden Menschen um ein Eis bitten.
Besucher bezeichneten mich oftmals als Träumerin. Ich fand es ganz prima, wenn Besuch kam, denn dann waren alle Anwesenden mit ihm beschäftigt und ließen mich in Ruhe spielen.
Ich hatte schon früh eine besondere Beziehung zur Natur und vor allem zu Tieren, sie waren mein Ein und Alles. Ob Hund, Katze oder nur ein Käfer – ich konnte sie stundenlang beobachten.
Ich sprach nicht viel, das beunruhigte meine Eltern. Ich lebte in meiner eigenen, inneren Welt und wollte möglichst nicht gestört werden. Dabei war ich durchaus intelligent und lernte noch vor der Einschulung rechnen und lesen. Sobald ich lesen konnte, verschlang ich ein Buch nach dem anderen und kreierte in Gedanken meinen eigenen Film dazu.
Ich erinnere mich an eine Situation, da sollte ein Pflegekind, ein Jahr älter als ich, eingeschult werden und musste einen Test machen. Das waren Aufgaben, die selbst ich schon lösen konnte. Meine Mutter versuchte, mich in einer Art dazu zu bewegen, mitzumachen, die mich stark unter Druck setzte. Ich wusste genau, wie die Lösung lautete, aber ich wollte sie unter diesem Druck einfach nicht aussprechen. Ich hörte nicht mehr zu und war nicht ansprechbar, sondern verzog mich in meine Welt und fand es ganz witzig, dass die mich umgebenden Leute nicht mitbekamen, wie schlau ich war.
Nun ja, das hat anschließend eine kräftige Ohrfeige gegeben, aber ich wusste, dass ich mich immer in mir zu Hause fühlen kann. Dementsprechend wurde ich oft als bockig, später dann als altklug bezeichnet– obwohl ich mir doch einfach immer nur sehr viele Gedanken machte.
Im Alter von 6 Jahren besuchten meine Mutter und ich meinen Vater, der auf Montage war. Er reichte mir eine Flasche und bat mich, Trinkwasser für ihn zu holen, und bemerkte dabei noch, dass ich das Wasser aus dem Hahn lange laufen lassen solle, bevor ich es abfüllte, denn dann sei es kälter. Nun ja, auch ein Vater kann sich doch einmal irren.
Ich wusste genau, dass es meinem Vater immer sehr warm wurde, wenn er viel arbeitete, er sich also viel bewegen musste. Warum sollte das bei Wasser anders sein? Ich beschloss, das Wasser nicht lange laufen zu lassen, mein Vater hatte bestimmt vergessen, dass das Wasser warm wird, wenn es lange läuft. Er hat sich im Übrigen nicht darüber beschwert …
Etwas Eigenartiges war das Kasperletheater, ich kann bis heute nicht verstehen, was die Menschen daran finden und warum dies ausgerechnet für Kinder lustig sein soll. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss mich vor dem Kasperl in Acht nehmen, es war nie eine positive Figur für mich. Und dann schenkten mir meine Eltern auch noch eine eigene Kasperlehandpuppe. Da soll ich etwas mit meiner Hand zum Leben erwecken, vor dem ich eigentlich Angst habe? Nein!
Auch Clowns, welcher Art auch immer, erschreckten mich. Selbst jetzt, im Erwachsenenalter, stehe ich Clowns immer noch mit gemischten Gefühlen gegenüber. Das bemalte und damit starre Gesicht wirkt auf mich wie eine Fratze. Ich hatte auch immer Angst vor Masken, Masken sind starr und verraten keine Gefühlsregung.
Ich war eines der Kinder, die gerne an den Weihnachtsmann, das Christkind und an den Osterhasen glaubten. Erst in der Schule erfuhr ich von meinen Mitschülern, dass es diese nicht geben sollte. Ich konnte es nicht wirklich glauben, kam ganz entsetzt nach Hause und erzählte es meinen Eltern. Denen blieb nichts anderes übrig, als meinen Mitschülern zuzustimmen. Ich war lange Zeit zutiefst betroffen und empfand das nächste Weihnachtsfest als äußerst bedrückend und enttäuschend.
Ich war, besonders in der Grundschule, eine sehr verschlossene Schülerin. Meine mündliche Leistung war nicht zu beurteilen, da ich gar nicht dazu kam, mich zu melden. Ich musste immer so lange überlegen, ob ich die Antwort auch wirklich wusste, ob ich die Frage überhaupt richtig verstanden hatte, dass viele Mitschüler schon längst alles hinausposaunt hatten. Allerdings wurde ich von den Lehrern immer als freundlich und zuvorkommend bezeichnet.
Probleme hatte ich auch meist mit ungünstigen Prüfungssituationen. Ich kann mich erinnern, dass ich während meiner Lehrzeit meinen Lehrjahrskollegen oftmals Nachhilfeunterricht gegeben habe, aber in den Prüfungen schlechter abschnitt als sie.
Damals wurde das Multiple-Choice-Verfahren eingeführt, und ich verstand oftmals die Fragen nicht. Ich dachte einfach zu kompliziert, die naheliegende Fragestellung erschien mir zu einfach, und ich musste ständig viel zu lange überlegen, wie man die Frage denn noch anders auffassen könnte.
Eigentlich war ich ein Stubenhocker. Ich hielt mich zwar oft im Garten auf und beobachtete die Natur, aber im Prinzip war es mir am liebsten, wenn ich allein in meinem Zimmer bleiben konnte. Dort bastelte ich stundenlang vor mich hin und vergaß darüber die Hausaufgaben.
Oder ich las, manche Bücher zum x-ten Mal, oftmals noch abends mit der Taschenlampe unter der Bettdecke.
Beim Lesen konnte ich alles um mich herum vergessen und tauchte in meine eigene Traumwelt ein. Mein Vater konnte mich diesbezüglich sehr gut verstehen, meine Mutter versuchte, mich unbedingt unter Leute zu bringen und beschwerte sich darüber, dass ich keine Freunde hätte. Sie versuchte, mich immer wieder dazu zu bewegen, nachmittags hinauszugehen, um mit anderen Kindern zu spielen, und bezeichnete mich als stur und bockig, wenn ich mich sträubte.
Ach ja, Sport war kein gutes Thema in der Jugendzeit, ich war damals alles andere als eine Sportskanone. Das änderte sich erst im Alter von fast 20 Jahren. Ich war das typische Mauerblümchen, das niemand in seiner Mannschaft haben wollte, da ich mich zu ungeschickt anstellte. Ich blieb immer übrig und wurde irgendeiner Mannschaft, gegen deren Willen, zugeteilt, welch Motivation …
Auch in Einzelsportarten stellte ich mich linkisch an. Meine Koordinationsfähigkeit ließ sehr zu wünschen übrig, und ich verletzte mich selbst bei leichten sportlichen Betätigungen sehr schnell. Kaum zu glauben, dass sich dies in den späteren Jahren völlig ins Gegenteil wandeln sollte.
Wettbewerb bedeutet für mich in keiner Weise einen Ansporn, schon im Kindesalter nicht.
Ich erinnere mich an Jugendwettspiele, damals auf dem Gymnasium, es ging um einen Fünfzigmeterlauf. Ich verpfuschte schon den Start und sah alle anderen Läuferinnen an mir vorbeiziehen. Daraufhin blieb ich einfach stehen, da ich in der ganzen Aktion keinen Sinn mehr sah, ich konnte die anderen nicht mehr einholen: ein Gefühl der Resignation, gefolgt von Desinteresse, da ich nirgends mithalten konnte.
Oh, das gab großen Ärger mit meiner Sportlehrerin, sie konnte meiner Argumentationskette so gar nicht folgen. Ich zog es in der Zukunft vor, bei den Jugendwettspielen krank zu sein. Auch schlechte Noten waren nie ein Ansporn für mich, ganz im Gegensatz zu vielen anderen Schülern.
Mein Wechsel zum Gymnasium war gefolgt von zwei Kurzschuljahren. Das Gymnasium befand sich in einer anderen Stadt, und ich kannte keinen einzigen Menschen dort. Meine Leistungen fielen rapide ab, vor allem in neuen Fächern wie Englisch und später Französisch. Also bekam ich Nachhilfeunterricht in Französisch.
Der arme Nachhilfelehrer tut mir noch heute leid, ich kann mich genau erinnern, wie wir beide an meinem Schreibtisch vor dem Fenster saßen, er verzweifelt versuchte, mir irgendetwas beizubringen, und ich nur stur zum Fenster hinaus in die Bäume geschaut habe. Irgendwann hat er aufgegeben, und ich durfte wieder ohne ihn am Fenster sitzen. Ich fand den Anschluss an meine Klasse nicht mehr.
Einmal musste ich eine Klasse wiederholen, das verbesserte die Situation allerdings auch nicht. Beendet war mein Vorhaben, Veterinärmedizin zu studieren, vor lauter Prüfungsangst ging ich in der zehnten Klasse ohne Prüfung ab und hatte damit meine mittlere Reife.
Später, während meiner Lehrzeit wurde es mir langweilig, und ich holte einfach nebenbei, auf dem zweiten Bildungsweg, die Fachhochschulreife nach.
Viele hochsensible Menschen lieben Kinder und gehen sehr sensibel mit ihnen um. Anscheinend hängt es davon ab, welche Erfahrungen eine hochsensible Person in ihrer Kindheit mit anderen Kindern gemacht hat.
Ich selbst wollte nie Kinder, mich haben Kinder immer gestört, sie waren zu laut, zu schrill, zu störend. Ich habe mich lieber mit Tieren umgeben, der Umgang mit ihnen fällt mir wesentlich leichter.
Aber natürlich kann sowohl Kinder zu haben als auch keine zu haben überaus erfüllend sein, jeweils auf seine Art und Weise.
Resümee
Einem hochsensiblen Kind sollte man Pausen gönnen, damit es die Sachlage überdenken kann. Es weiß sonst nicht, was es will, und wird schnell als bockig und stur betrachtet.
Hochsensible Kinder sind bei liebevoller Führung und Zuwendung einsichtiger als bei Strenge. Sie bevorzugen ruhige Spiele und fühlen sich an lauten Orten unwohl.
Hochsensible Kinder werden besonders schnell von einem vollgepackten Terminkalender überlastet. Man sollte viele Auszeiten einplanen und den Tag mit ruhigen Ritualen gestalten.
Hochsensible Kinder sollte man beim Einschlafen zur Ruhe kommen lassen. Ratsam sind gemäßigtes Licht und möglichst wenig Reize.
Für hochsensible Kinder ist Mittagsschlaf zum Abbau des Stresshormons Cortisol sehr wichtig.
1.2
Partnerschaft
○ Spüren Sie sofort, wenn „dicke Luft“ herrscht?
○ Verlieben Sie sich schnell?
○ Haben Sie sehr hohe Ansprüche an Nähe?
○ Geht Ihnen Unsachlichkeit sehr nahe?
○ Fühlen Sie sich für das Wohlergehen des Partners verantwortlich?
Selbstverständlich schätze ich als hochsensible Person die Nähe – wohl sogar mehr als weniger empfindsame Menschen –, aber nicht in ihrer alltäglichen oder unberechenbaren Form.