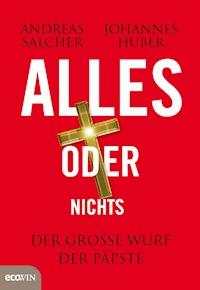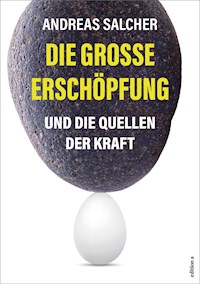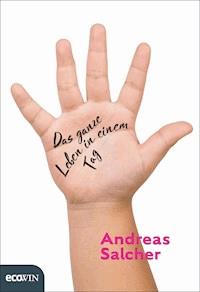Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ecowin
- Sprache: Deutsch
Das ist kein Buch über den Tod, das ist ein Buch über das Leben. Über jeden einzelnen der Tage, die noch vor uns liegen. Über unsere Träume und Wünsche, denen wir oftmals keine Chance auf Erfüllung geben. Über unsere Liebe zu anderen Menschen, die wir vielfach nicht auszusprechen wagen. Über die Liebe zu uns selbst, die in unserem Leben häufig nicht existiert. Über Möglichkeiten, die uns das Leben eröffnet, die wir aus Angst nicht ergreifen oder aus Unachtsamkeit nicht erkennen. Über vermeintlich erstrebenswerte Ziele, die uns im Nachhinein bewusst werden lassen, dass wir auf dem Weg dorthin viel Bedeutsameres einfach übersehen haben. Über das Leuchten in unseren Augen, das sich allmählich verliert. Unser Leben leben wir ein einziges Mal. Es gibt keine Chance, es das nächste Mal besser zu machen. Wirklich leben heißt, immer wieder den Versuch zu wagen, nach unseren eigenen Maßstäben zu leben. Es ist nie zu spät, die Reise zu seinen Möglichkeiten anzutreten. Dieses Buch ist ein Begleiter für die vielen noch ungeschriebenen, weißen Seiten Ihres Lebens.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 333
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andreas Salcher
Meine letzte Stunde
Andreas Salcher
MEINELETZTE STUNDE
Ein Tag hat viele Leben
Andreas Salcher
Meine letzte Stunde
Ein Tag hat viele Leben
Umschlagidee und -gestaltung: kratkys.net
tkclear
1. Auflage
© 2010 Ecowin Verlag, Salzburg
Lektorat: Dr. Arnold Klaffenböck
Gesamtherstellung: www.theiss.at
Gesetzt aus der Sabon
Printed in Austria
ISBN 978-3-7110-5000-7
www.ecowin.at
Gewidmet dem Menschen,der meine Hand halten wird.
Leserhinweis
Um die Lesbarkeit des Buches zu verbessern, wurde darauf verzichtet, neben der männlichen auch die weibliche Form anzuführen, die gedanklich selbstverständlich immer mit einzubeziehen ist. Für alle im Buch abgekürzt verwendeten Namen, die auf Wunsch der Betroffenen anonymisiert wurden, liegen dem Verfasser autorisierte Gesprächsprotokolle vor. Die besten Geschichten schreibt das Leben. So nicht ausdrücklich anders darauf hingewiesen, sind alle Fallbeispiele in diesem Buch wahr.
Inhaltsverzeichnis
I. Die Endlichkeit des Seins
Orientierung
Die letzte Stunde – der beste Freund für Dein Leben
Unendliche Gerechtigkeit – warum wir in der letzten Stunde alle gleich sind
Unsere Angst vor dem Tod – woher sie kommt und wie sie uns beherrscht
Glauben hilft zwar, nützt aber nichts – warum wir die Verantwortung für unser Leben an niemanden abgeben können
Das Ja zum Alter
II. Die Möglichkeit des Lebens
Die kleinen Todsünden – Unachtsamkeit, Sprachlosigkeit, Lieblosigkeit, Zeitverschwendung und gute Vorsätze
Anklage auf Hochverrat – wenn wir unsere Lebensträume aufgeben
60 Minuten unseres Lebens – eine Zwischenbilanz
Kann das schon alles gewesen sein – vom Sinn und Zweck des Lebens
Ein Lob der Arbeit
Liebe – die Essenz des Lebens
Vom Licht und der Finsternis
III.
Ein Besuch Deiner letzten Stunde
Persönliches und Danksagung
I. Die Endlichkeit des Seins
Orientierung
Fast alles in der Zukunft unseres Lebens ist unsicher. Die letzte Stunde ist fix. Wir bereiten uns auf alles genau vor, nur nicht auf unsere letzte Stunde. Dabei ist die letzte Stunde das Wichtigste. Sie entscheidet über unser ganzes bisheriges Leben. Alles was wir vorher gelebt haben, ist Bestandteil unserer letzten Stunde. Warum scheuen wir dann unser Leben lang davor zurück, uns damit zu beschäftigen? Die Antwort ist ganz einfach: Es ist unsere Urangst vor dem Tod und die Ungewissheit über das Danach.
Jede ernsthafte Beschäftigung mit der letzten Stunde führt unweigerlich zu einer Frage: Warum schätzen wir unser eigenes Leben wider jede Einsicht der Vernunft so wenig, solange wir es nicht bedroht sehen?
Warum vergeuden wir so viele wertvolle Stunden, als ob wir unendlich viele davon hätten? Warum ist es so schwer, den uns schon in der Schule eingepflanzten Mechanismus des Stundenfressens abzuschalten, ohne zu merken, dass es unsere eigene Lebenszeit ist, die wir vernichten? Noch zwanzig Minuten bis zur Pausenglocke, noch zwei Jahre bis zur Reifeprüfung, noch ein Jahr bis zum Studienabschluss, noch drei Tage bis zum Wochenende, noch vier Wochen bis zum Urlaub, in drei Monaten ist schon Weihnachten.
Wir leben, als würden wir immer leben. Wir achten nicht darauf, wie viel Zeit bereits vorüber ist, wir verschwenden sie, als wäre sie unerschöpflich, dabei könnte jeder Tag unser letzter sein. Wie oft vernimmt man die Äußerung: „Mit 60 gehe ich in Pension und mache nur noch das, was mir Freude macht.“ Doch wer garantiert uns diese wunderbaren Jahre in der Zukunft, bei wem können wir sie einklagen, wenn wir sie nicht mehr erleben sollten? Ist es nicht zu spät, mit dem Leben erst anzufangen, wenn man aufhören muss? Welche unfassbare Dummheit, was für ein gedankenloses Übersehen der Sterblichkeit bringt uns dazu, alle großen Pläne für unser Leben hinauszuschieben auf einen uns selbst unbekannten Punkt, bis zu dem wir es vielleicht nie bringen werden?[1]
Es gibt drei Möglichkeiten, sich mit der Endlichkeit des eigenen Lebens auseinanderzusetzen:
• Wir verdrängen dieses Thema ein Leben lang, um dann völlig unvorbereitet von unserem Tod überrascht zu werden.
• Die Konfrontation mit einer schweren Erkrankung oder einem Unfall: Entweder ist diese erste Begegnung mit unserer letzten Stunde auch schon die letzte und wir sterben. Oder wir erhalten noch eine Chance. Interessant ist, dass fast alle, die nach einer Lebensbedrohung weiterleben durften, diese nicht missen möchten.
In beiden Fällen brauchen wir gar nichts tun. Die letzte Stunde ist plötzlich sehr präsent. Für die meisten Betroffenen ist sie jedoch ein völlig Fremder, der massiv in ihr bis dahin so geordnetes Leben eingreift und ihnen ganz andere Spielregeln aufzwingt.
Dieses Buch will Ihnen einen dritten Weg anbieten:
• Die Chance, sich mit der vielleicht entscheidenden Erfahrung Ihres Lebens zu beschäftigen, bevor Sie davon betroffen sind.
Es gibt gute Gründe, sich für diese Alternative zu entscheiden. Nichts fürchtet der Mensch so sehr wie die Begegnung mit dem Unbekannten. Verdrängung macht diese Angst immer größer, jede konkrete Auseinandersetzung kann dafür ein Schritt zur Überwindung sein. Es ist daher sinnvoll, sich auf diesen dritten Weg einzulassen: Sie werden nicht nur mehr Vertrautheit mit dem Gedanken an die eigene Endlichkeit gewinnen, sondern vor allem die Erkenntnis, wie sehr Sie Ihr Leben lieben und was Sie alles noch gerne erleben würden.
Stellen Sie sich vor, dass Sie in Ihrer letzten Stunde die Möglichkeit hätten, die fertige Biografie Ihres Lebens vor sich zu haben und darin blättern zu können. Durch Zufall würden Sie genau jenes Kapitel aufschlagen, das Ihren gegenwärtigen Lebensabschnitt behandelt. Und nun würde man Ihnen die Gelegenheit geben, die folgenden Kapitel neu schreiben zu dürfen. Das Buch versteht sich als ein Angebot, genau dieses Experiment zu wagen.
Ist es nicht ein lohnenswerter Versuch, sich schon heute Zugang zu einigen der Erkenntnisse zu verschaffen, die das Leben in den nächsten 10, 20, 30, 40, 50 oder noch mehr Jahren für Sie bereithält? Denn egal, wie alt Sie sind, Sie sind jetzt genau mitten in jenem Kapitel der Biografie Ihres Lebens, das gerade geschrieben wird. Gelingt es Ihnen, sich dieser Vorstellung hinzugeben, dann wird Ihnen im gleichen Augenblick die ganze Größe der Verantwortung bewusst, die Sie in jedem Moment Ihres Lebens haben: die Verantwortung dafür, was aus der nächsten Stunde und was aus den darauf folgenden Tagen werden könnte.[2] Jede neue Seite in der Biografie unseres Lebens ist eben nicht durch unseren bisherigen Lebenslauf vorgegeben, sondern wir sind es selbst, die mit unseren Entscheidungen unser Schicksal bestimmen können.
Die Beschäftigung mit der letzten Stunde hat zwei Aspekte, die im I. und II. Teil behandelt werden:
I. Teil: Wie können wir lernen, gut mit der Tatsache zu leben, dass wir eines Tages sterben werden?
II. Teil: Wie können wir die daraus gewonnenen Erkenntnisse nutzen, um unserem ganzen Leben eine höhere Qualität zu verleihen?
Die großen Themen „Lebensträume“, „Sinn des Lebens“, „Liebe“, „Arbeit“ gewinnen sofort eine ganz andere Bedeutung, wenn wir sie aus dem Blickwinkel unserer letzten Stunde betrachten. So kann es hilfreich sein, schon jetzt zu wissen, mit welchen Fragen Menschen am Ende des Lebens ihre eigene Geschichte beurteilen:[3]
• Liebe: Habe ich genug Liebe gegeben und bekommen?
• Authentizität: Habe ich meine eigene Musik gespielt? Habe ich wirklich mit meiner Stimme gesprochen?
• Idealismus: Habe ich die Welt ein bisschen besser gemacht?
Mindestens so wichtig ist es auch, die vielen „kleinen Dinge“ aus der Perspektive der letzten Stunde sehen zu lernen: „Ist dieser Streit mit meinem Partner wirklich so wichtig?“, „Wie drücke ich meine Dankbarkeit aus?“ oder „Wie begegne ich den Blicken anderer Menschen?“ Ist nicht unser ganzes Leben oft ein einziges Übersehen? Wir bekommen so unendlich viele Hinweise, Worte, Blicke, Signale, dass wir glauben, es uns leisten zu können, die meisten davon vorbeigehen zu lassen. Wir schauen nicht hin, wir hören nicht zu, wir nehmen nicht wahr. Aber die Möglichkeiten werden nicht mehr, sondern immer weniger.
Die Geschichten von den großen und kleinen Helden, die spirituellen Weisheiten erfahrener Lehrer, das Wissen bedeutender Denker und Forscher, die Gedichte, die Zitate, die offenen Fragen und vor allem die Widersprüche und leeren Räume in diesem Buch dienen nur einem Zweck: Ihnen eine Annäherung an Ihre eigene letzte Stunde zu ermöglichen, auch ohne von einer bösen Diagnose betroffen zu sein.
„Geht es um besser leben oder besser sterben?“, werden Sie sich vielleicht manchmal beim Lesen fragen, denn die beiden Themen lassen sich nicht immer präzise abgrenzen. Natürlich habe ich versucht, Sie mit einem roten Faden durch das Buch zu leiten. Nur ist dieser rote Faden von mir gewebt und Sie werden sich mitunter einen anderen wünschen, der genau Ihrem Bedürfnis nach Orientierung entspricht. Wann immer Sie glauben, in diesem Buch den roten Faden verloren zu haben, gibt es eine Klammer, die die unterschiedlichen Dimensionen verknüpft und die einzelnen Kapitel zusammenhält: Es ist die Unachtsamkeit.
Sie ist auch der Bezug zu meinen beiden ersten Büchern. Beim „Talentierten Schüler und seinen Feinden“ geht es um die Unachtsamkeit gegenüber dem Talent jedes Einzelnen. „Der verletzte Mensch“ setzt sich mit der Unachtsamkeit im Umgang miteinander auseinander. „Meine letzte Stunde“ ist ein Buch über die größtmögliche Unachtsamkeit: die Unachtsamkeit gegenüber unserem eigenen Leben und dem Versäumnis, ihm jene Bedeutung zu geben, die es haben könnte.
Das ist kein Buch über den Tod, das ist ein Buch über das Leben
Es ist kein Kriminalroman, den man in einem absolvieren sollte, um am Schluss zu erfahren, wie er ausgeht. Das letzte Kapitel dieses Buches ist das Angebot, eine Schwelle zu überschreiten. Wie auch immer diese Begegnung verlaufen mag, sie wird Sie nicht in die Gleichgültigkeit entlassen. Dieses Buch geht am Ende nicht aus, es fängt erst an. Es kann Sie dabei unterstützen, auf jeden einzelnen Tag, der noch vor Ihnen liegt, ein bisschen genauer zu achten.
Ein Tag hat viele Leben. Doch wie viele dieser hundert möglichen Leben verpassen wir? Wegen unserer guten Vorsätze, die wir nie einhalten; wegen unserer Hoffnungen, denen wir selbst oft keine Chance auf Erfüllung geben, weil wir die vielen Gelegenheiten, die uns das Leben bietet, gar nicht erkennen oder aus Feigheit nicht nutzen. Es sind unsere Zweifel und Ängste, unsere kleinen und großen Befürchtungen, die wir, solange es nur irgendwie geht, vor anderen verbergen, die kleinen und großen Fallen, in die wir immer wieder tappen und so schwer erkennen, dass wir sie uns meist selbst in bester Absicht gestellt haben, die uns viele Leben rauben.
Drei Erlebnisse, die mich bestärkt haben, dieses Buch zu schreiben
An dieser Stelle haben Sie ein Recht darauf, meinen eigenen Zugang zur letzten Stunde zu erfahren. Als ich 30 wurde, dachte ich mir wenig dabei. Mit 40 kam dann die Bestätigung, dass alle recht hatten, die meinten, dass das Leben umso schneller verfliegt, je älter man wird. Heuer werde ich 50. Statistisch habe ich im besten Fall noch knapp 30 Jahre vor mir, also so lange wie von meinem
20. bis zu meinem 50. Geburtstag, das ist durchaus lange. Nur wenn diese Zeit doppelt so schnell vergeht wie bisher, sind es nur mehr 15 Jahre, und das ist ziemlich kurz. Es kann auch wesentlich schneller gehen. So wie bei meinem Freund Poldi.
„Was hast Du eigentlich?“, fragte ich ihn, als ich ihn endlich einmal nach einer ungewöhnlich langen Zeit, in der er nicht zurückrief, am Telefon erreichte. „Einen Krebs habe ich“, antwortete er nüchtern. Ein Satz, auf den mir keine richtige Antwort einfiel, sosehr ich sie auch suchte. Von diesem Augenblick an war ich Zeuge eines mit ungeheurer Willenskraft geführten Kampfes des damals erst 37-jährigen Musikjournalisten gegen einen unbezwingbaren Gegner. Beruflich war Poldi einer der ganz großen Musikjournalisten, der von den Beatles bis zu Michael Jackson alle Legenden persönlich interviewt hatte. Privat war er Marathonläufer, Vegetarier, Autorennfahrer und vor allem ein begeisterter Weltreisender, der allein die über 350 Kilometer lange Trans-Zanskar-Tour im Norden von Indien gemacht hatte. Am Anfang seiner Krankheit war er sich ganz sicher, dass er wieder gesunden würde. So jung zu sterben war für ihn absolut keine Option. Er träumte schon von der nächsten großen Reise, die er nach seiner Genesung machen würde. Als die Ärzte ihm einen künstlichen Darmausgang legen mussten, kamen ihm erste Zweifel, ob er damit zum Südpol würde reisen können, einem großen Ziel, das er sich gesetzt hatte. Er verfiel körperlich immer schneller, die Ziele wurden kleiner und zunehmend kurzfristiger.
Ich erlebte, wie der Krebs einen Menschen von innen auffrisst. Hatten wir früher nächtelang darüber diskutiert, was die Welt im Innersten zusammenhielt, wurden Gespräche nun immer schwieriger. Wie spricht man mit einem Todkranken? Für mich glich es dem unsicheren Tasten auf einer dünnen Eisschicht: ein falsches Wort und man bricht ein. Ich suchte nach Worten, die es nicht geben konnte, weil mir die Existenz einer Sprache der Hoffnung damals noch völlig unbekannt war. Diese besteht nicht aus Worten, sondern aus Gesten. So kann ein Händehalten, eine Umarmung oder ein einfacher Druck auf den Unterarm die verborgenen Kanäle der Hoffnung öffnen. Gott sei Dank hatte Poldi jemanden gefunden, der diese uralte Sprache des Herzens fließend sprach, Tseten, eine Tibeterin, die ihn begleitete.
„Nicht fragen, wie es mir geht, und bitte keine Alternativtherapien“ – das waren die Begrüßungsworte, die mir Poldi bei meinem letzten Besuch im Haus seiner Eltern entgegenschleuderte. Seinen Humor hatte er auch in den letzten Tagen seines Lebens nicht verloren. Durch Poldi habe ich das Fegefeuer kennengelernt. Das Fegefeuer ist die Zeit zwischen der Verkündung einer unheilvollen Diagnose und dem Akzeptieren, dass man sterben wird: eine scheinbar logisch ablaufende Folge von Phasen des Leugnens, des Schocks, des Protests, der Aufnahme des Kampfes, der kleinen Hoffnungen und der vielen großen Enttäuschungen bis zum erschöpften Sich-Fügen in das Unvermeidliche. Zu seinem Begräbnis kam ich zu spät, weil das gesamte Gebiet um den Friedhof herum von den vielen Freunden zugeparkt war, die ihm die letzte Ehre gaben. Es wird zu den immer verschlossenen Geheimnissen unserer Existenz gehören, warum manchmal gerade unsere besten und liebenswertesten Menschen viel zu früh gehen müssen.
Bei der ersten Begegnung mit meiner eigenen letzten Stunde hatte diese ebenfalls das Gewand einer bedrohlichen Diagnose gewählt. Ich litt längere Zeit an hartnäckigem Durchfall. Zuerst verdrängte ich das völlig und war durchaus fantasievoll im Erfinden plausibler Erklärungen dafür. Es funktionierte aber nicht. Irgendwann ging ich zum Arzt, in der Hoffnung, dass mir dieser ein Medikament verschreiben und nach einer Woche wieder alles normal sein würde. Doch das Normale war eine Folge von Routineuntersuchungen, die ergaben, dass eine Koloskopie unvermeidlich wurde. Sachlich teilte mir der Professor mit, dass die Symptome in Kombination mit dem Befund keine andere Alternative zuließen. Nur mühsam konnte ich mich zurückhalten, ihn mit Fragen zu bombardieren, ob er denn wirklich glaube, dass … Wie wahrscheinlich denn das Unaussprechliche in meinem Alter wäre?
In den drei Wochen zwischen der Terminvereinbarung und der Durchführung spürte ich auf einmal alle Symptome des Darmkrebses in mir, vor allem die tiefere Gewissheit, dass etwas nicht stimmte in meinem Bauch. Überall las ich plötzlich Artikel über Darmkrebs. Der Gedanke lähmte mich völlig, ich bereute, dass ich nicht auf einem früheren Termin bestanden hatte. Ich versuchte ganz normal weiterzuleben, doch davon konnte keine Rede sein. Die Angst begann sich in meinem Kopf immer mehr auszubreiten. Die Zeit bis zur Koloskopie verging immer langsamer, sie schien stehen zu bleiben. Umso mehr sich das Unvorstellbare, dass ich von einer tödlichen grausamen Krankheit zerfressen werden könnte, in mir ausbreitete, umso größer wurde mein Wunsch, dass es noch einmal gut gehen möge. Alle meine bisherigen sehr präzisen Ziele für meine Karriere und mein Privatleben, banale Wünsche wie ein besserer Tennisspieler zu werden, wurden auf einmal unbedeutend. Auch meine kleinen Ängste und inneren Unsicherheiten wurden völlig überlagert von dieser einzigen großen Furcht. Manchmal erfasste sie meinen Magen, dann umklammerte sie mein Herz. Im Leben gibt es ein Davor und ein Danach. Die Zeit, bevor man das erste Mal die nackte Angst vor dem Tod gespürt hat, und die Zeit danach. Die Angst vor einer bösen Diagnose ist der Urknall aller noch verbliebenen Ängste in unserer Wohlstandsgesellschaft.
Ich begann zu verhandeln, mit den mir unbekannten höheren Mächten, und wenn ich keinen Zugang zu ihnen fand, mit mir selbst. Überhaupt redete ich fast nur mehr mit mir selbst. Ich machte Versprechungen, was ich alles tun würde, wenn – ja, wenn trotz aller unheilvollen Anzeichen alles nur ein Irrtum war. In manchen Augenblicken wurde ich tief gläubig – abergläubig. Ich versuchte Zeichen zu sehen wie: „Wenn in der nächsten Stunde des Telefon läutet, dann werde ich gerettet.“ Ich fing an, mir Sorgen zu machen, ob ich denn die bestmögliche Therapie erhalten würde. Ich nahm mir vor, sollte das alles wie durch ein Wunder an mir vorbeigehen, würde ich sofort eine Zusatzversicherung abschließen. Versicherungen schließt man ja nicht ab, damit man im Schadensfall entschädigt wird, sondern damit dieser erst gar nicht eintritt. Früher versuchten die Menschen durch Opfer in Beziehung zu den höheren Mächten zu treten, auf die Götter durch Gaben und Rituale Einfluss zu nehmen, damit sie von ihrer Rache verschont blieben. Heute opfern wir, indem wir alles versichern, was wir unter keinen Umständen verlieren wollen: unser Haus, unser Auto, unsere Gesundheit, sogar unser eigenes Leben und das unserer Kinder. Schon das Wort Lebensversicherung erweckt in grotesker Weise den Eindruck, dass wir damit unser Leben sichern könnten. Vielleicht hatte ich mein Schicksal selbst herausgefordert, weil ich den Göttern meine Opfergabe verweigert hatte – ich hatte keine Zusatzversicherung abgeschlossen.
Ich versuchte die Zeit bis zum Termin der Urteilsverkündung totzuschlagen, ging zeitig ins Bett und kam in der Früh nicht heraus, obwohl ich ganz schlecht schlief. Wie ein kleines Kind wollte ich einfach die Augen fest schließen und beim Öffnen sollte alles wieder gut sein. Ich begann Listen mit Menschen zu erstellen, die ich noch unbedingt würde treffen wollen, stellte mir vor, wie stark und mutig ich ihnen vom baldigen Ende meines Lebens erzählen würde. Manchmal konnte ich meine Tränen nicht halten, wann immer diese „Warum das mir, ich habe es doch nicht verdient“-Gefühle in mir hochkamen, um mich dann in tiefes Selbstmitleid versinken zu lassen. Viel schlimmer war die Suche nach der Ursache. Kleine Sünden wurden durch kleine Strafen gesühnt, vielleicht wurde jetzt für meine ganzen Schlechtigkeiten und Vergehen die schwerste Strafe über mich verhängt.
Dann der Tag der Untersuchung. Ohne Narkose, ungemein schmerzhaft, um jede Schlinge meines Darms bahnte sich die Kamera den Weg. Die Ärzte sprachen in einer mir unverständlichen Sprache, ich lag auf der Seite auf dem kalten Behandlungstisch, nur mit einem offenen weißen Kittel, wie ein Opferlamm auf dem Altar der Hohepriester. Irgendwann war alles vorbei und der Arzt sagte nur beiläufig einen Satz zu mir: „Alles in Ordnung.“
Die ganze Anspannung, die ich drei Wochen lang aufgebaut hatte, fiel in einer Sekunde ab. Es sind zwei Buchstaben, die über Leben oder Tod entscheiden: o. B. Selbst medizinische Laien, die schon einmal auf einen kritischen Befund gewartet haben, wissen, was sie bedeuten. o. B. steht für „ohne Befund“, das heißt: „Hurra, ich darf weiterleben“, das bedeutet die Rückkehr in den Alltag. o. B. ist wie ein Funke, der die schon lange erloschene Leidenschaft zu unserem ganz normalen kleinen Leben heftig wiederaufflammen lässt. Selbst diese ganz kurze Trennung von der Normalität hat mir erst ihren Wert gezeigt. Ich genoss auf einmal die sonst von mir so tief verachtete Normalität. Die Sonne schien wieder – sehr kurz. Dann verlöschte das Strohfeuer an Dankbarkeit und Freude. Mein Leben ging weiter.
Das Gefühl, dass alles plötzlich vorbei sein kann, das gänzlich von mir Besitz ergriffen hatte, wich genauso blitzschnell, wie es gekommen war. All die guten Vorsätze, ab jetzt jährlich eine Vorsorgeuntersuchung zu machen, den Göttern in Form einer Versicherungspolice einmal im Jahr meine Opfergabe darzubieten, meine viel zu fleischreiche Ernährung umzustellen, waren genauso schnell vergessen wie die Liste mit jenen Menschen, die ich unbedingt treffen wollte. Innerhalb kürzester Zeit breitete die Normalität ihren üppigen Schleier über mir aus. Die Unachtsamkeit wurde wieder zum Wappen auf meinem Schild, den ich schützend vor mir hertrug, wenn ich gehetzt durch mein Leben raste. Ich war voll von Plänen und übersah die vielen Gelegenheiten, die mir das Leben bot, während ich die Zukunft plante. Erst jetzt im Rückblick wird mir bewusst, dass mein Leben aus besonderen Augenblicken und nicht aus grandiosen Plänen besteht.
Bei meiner zweiten Begegnung mit meiner letzten Stunde ging alles sehr schnell. Innerhalb weniger Sekunden wurde mir klar, dass das keine sichere Landung würde, dann krachte es schon und ich erlebte einen Flugzeugabsturz. „Aha, das ist jetzt ein Flugzeugabsturz“, dachte ich mir. „Und das ist noch nicht mein Ende“, fügte meine innere Stimme hinzu. Zwischen diesen beiden Gedanken lag hineingepresst meine vermeintlich letzte Stunde. Die Dauer der letzten Stunde lässt sich auch mit der besten Uhr der Welt nicht stoppen. Sie kann fast eine Ewigkeit dauern oder wie bei meinem Flugzeugabsturz im Zeitraffer blitzartig ablaufen.
Gegen jede statistische Wahrscheinlichkeit überlebten sowohl ich wie auch meine fünf Mitreisenden in der zweimotorigen Cessna. Noch auf dem Weg in das Spital ärgerte ich mich über den Verlust meines Terminkalenders. Wie sollte ich denn all die Termine rekonstruieren, die ich für den Herbst schon vereinbart hatte? Die Sorge, eine Verpflichtung ohne Entschuldigung zu versäumen, beschäftigte mich mehr als die Frage, ob denn mein Jochbein nun gebrochen sei. Ich funktionierte sehr schnell wieder.
Die universelle Macht der Verdrängung
Damals fehlte mir noch das Wissen über die unvorstellbar große Macht, mit der wir die eigene Sterblichkeit verdrängen. Die Macht der Verdrängung, dem Schicksal unseres Todes nicht entkommen zu können, ist etwas Universelles. Sie ermöglicht uns überhaupt erst, ein normales Leben im Alltag zu führen, oder wenn wir dem Tod gerade ins Angesicht geblickt haben, unsere Aufmerksamkeit ganz schnell auf den Terminkalender zu richten.
Die Arbeit an diesem Buch hat mir Angst gemacht. Es war nicht so sehr das Unbehagen der Beschäftigung mit dem Tod oder die immer wieder aufflammende Hypochondrie, wenn ich mit schwer erkrankten Menschen über ihre Symptome sprach oder darüber las. Meine größte Befürchtung war eine andere, eine sehr konkrete: Ich schreibe dieses Buch und bleibe ganz allein. Weil niemand in die Auseinandersetzung mit seiner letzten Stunde einsteigen will oder ganz schnell wieder aussteigt. Ich verstehe das sehr gut. Die letzte Stunde ist ein so großes Tabu, dass niemand ein Buch darüber lesen will, der nicht unmittelbar davon betroffen ist. Und Sie sind ja nicht betroffen, hoffentlich zumindest. Als mich dann noch meine Mutter gefragt hat, ob mein Buch nicht zu traurig werden würde, hat mich das noch mehr verunsichert. Um dieser Angst zu entkommen, habe ich instinktiv jenen Weg gewählt, den ich immer im Leben wähle, wenn ich großen Druck verspüre: den Weg des rastlosen Suchens, der intensiven Recherche, der Jagd nach den vielen großen und kleinen Geschichten, dem Ausreizen der Gegensätze.
Apropos Gegensätze: Ich bin nach Rom an die legendäre Universität „Santa Croce“ gereist, die Papst Johannes Paul II. dem Opus Dei übertragen hat. Dort habe ich mit Professoren über den Himmel, die Hölle und vor allem die Wahrheit diskutiert, denn die waren sehr überzeugt davon, die Wahrheit zu kennen. Ich habe mit dem Großmeister der deutschen Freimaurer gesprochen, um von ihm zu erfahren, was die Nichtfreimaurer von deren Ritualen über die Geheimnisse des Lebens und des Todes lernen könnten. Ich war in einem Hospiz und in einem Krankenhaus für krebskranke Kinder, um herauszufinden, ob und wie Kinder anders sterben als Erwachsene. Ich habe mit bekennenden Atheisten und Tiefgläubigen, mit Mönchen und Lebemännern lange Gespräche geführt. Manche meiner Gesprächspartner leben in den tollsten Penthäusern und andere in ganz einfachen Kommunalwohnungen, einer sogar auf der Straße. Ich habe eine Woche lang gefastet, ich habe 40 Stunden ohne Schlaf verbracht. Ich flüchtete mich in Effekthascherei und in die Suche nach prominenten Gesprächspartnern. Ich sammelte geniale Wissenschaftler, bekannte Ärzte und große Künstler und habe dabei lange jene übersehen, von denen ich viel mehr hätte lernen können. Ich war bei so viel Großartigem dabei, oder zumindest hatte ich davon gehört, ohne dass mir bewusst wurde, dass die Großartigkeit dieser Geschichten immer in den jeweiligen Personen selbst lag, und dass ich, ohne deren Erfahrung gemacht zu haben, anderen nicht einmal eine Ahnung davon vermitteln konnte. Im Kern blieb immer dieser Hauch von Fremdgeruch.
Meine Aufmerksamkeit war fast ausschließlich auf das Laute, das Strahlende, das Spektakuläre gerichtet, dabei liegt die letzte Stunde im Leisen, im Unsichtbaren und in den Zwischentönen. Wenn wir mit offenen Augen durch die Welt gehen, gibt es Dinge, die für uns sichtbar sind: Gebäude, die Umgebung, Menschen. Wenn wir Menschen genauer anschauen, dann wissen wir, dass es Dinge gibt, die da sind, obwohl wir sie nicht sehen können: Ängste, Hoffnungen, Gefühle, Vorbehalte. Um uns und andere besser zu verstehen, müssen wir lernen, genau diese Dinge, die wir nicht sehen können, sichtbar zu machen – nicht nur bei anderen, sondern vor allem in uns selbst.
Die Dimensionen der letzten Stunde
Die letzte Stunde ist keine Bilanz mit Plus und Minus, sondern die Summe der Antworten auf Fragen wie „Habe ich das Beste aus meinem Leben gemacht?“ oder „Habe ich genug zurückgegeben?“. Die gute Nachricht ist, dass wir noch viele Gelegenheiten erhalten, diese Summe unseres Lebens zu erhöhen, wenn wir sie nur sehen wollen. Denn das Leben ist eine Aneinanderreihung von Möglichkeiten, die wir nutzen oder vergeben können. Es gibt leider eine negative Kraft, die uns oft daran hindert, einen Blick zu erwidern, aus dem mehr hätte werden können. Oder eine Frage im richtigen Augenblick zu stellen. Oder einem Menschen, der uns wichtig war, das zu sagen, was uns schon lange auf der Zunge lag. Noch heute ärgern wir uns manchmal darüber. Wie oft wurden wir dagegen belohnt, wenn wir unsere Furcht vor Abweisung überwunden und es einfach gewagt haben.
Wenn wir älter werden, schaffen wir uns eine Lesebrille an, um die Zeitung noch lesen zu können. Altersweitsichtigkeit ist, wie der Name schon sagt, altersbedingt und tritt meistens zwischen dem 40. und 45. Lebensjahr auf. Auf unser Leben sollten wir dagegen unabhängig von unserem Alter jederzeit gut sehen können. Den Blick auf unsere letzte Stunde müssen wir aus der richtigen Distanz machen, weder zu scharf noch zu weich. Dieser Blick wird manchmal milder, manchmal härter ausfallen. Umso öfter sollten wir ihn wagen – solange wir es können: Die Häuser, die wir gebaut haben, die Kinder, die wir gezeugt, geboren oder verloren haben, die Erfolge, die wir erzielt haben, die vielen kleinen und großen Freuden, an die wir uns noch erinnern können, die Reisen, die geliebten Menschen, die großen Leidenschaften, die Freunde, die unerfüllten Träume, die enttäuschten Hoffnungen, Verrat und Betrug, die verpassten Gelegenheiten, das Geld, der Besitz, die Macht und der Ruhm, die wir angehäuft haben.
War das mein Leben? Wann ist die rechte Zeit, sich diese Frage zu stellen? Mit 20, mit 30, mit 40, in der Lebensmitte, später? Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass es zu spät sein kann. Ein Abendessen mit Freunden, anschließend fahren wir nach Hause, ein Unfall, und das kann es dann gewesen sein. Gibt es das wirklich nur im Kino? Bei manchen Menschen hört einfach das Herz zu schlagen auf und das große Rennen ist auf einmal vorbei für sie. Meist schieben wir die Frage auf, weil wir Wichtigeres zu tun haben, zumindest Dringenderes. Die Versuchung, die Frage zu verdrängen, bis es zu spät ist, ist sehr groß. Es ist wie in einer Beziehung, wo wir die vielen kleinen Signale unseres Partners erst überhaupt nicht wahrnehmen und sie selbst dann, wenn sie unübersehbar geworden sind, ignorieren, bis der Partner uns mitteilt, dass es aus ist. Dann überkommt uns Panik, wir sind bereit, alles zu tun, nur ist es dafür zu spät. Eine Chance ist vergeben. Doch in der Partnerschaft bekommen wir vielleicht eine neue Möglichkeit. Unser Leben haben wir nur einmal. Es gibt keinen Plan B. Wenn unsere Zeit abgelaufen ist, gibt es keine Chance mehr, es das nächste Mal besser zu machen, rechtzeitig hinzuhören.
Die letzte Stunde beginnt in diesem Augenblick. Wir können den Tod nicht beeinflussen, aber jede Stunde davor. Wir sterben, wie wir leben. Wir könnten einen Bruchteil der Zeit, die wir für die vielen Belanglosigkeiten verschwenden, für das nutzen, was uns wirklich wertvoll ist. Wann ist die beste Zeit, sich die wichtigste Frage zu stellen, unabhängig davon, wie alt man ist? Die Antwort ist ganz einfach. Wir brauchen nur einmal tief ein- und auszuatmen, um uns bewusst zu werden: Alles begann mit einem Atemzug und alles wird mit einem Atemzug enden.
Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die mit Abstand häufigste Todesursache, insbesondere im höheren Erwachsenenalter. An zweiter Stelle folgt Krebs. Krebs ist ein Tabuthema, das Wort bringt alles sofort auf den Punkt. Sie mögen beim Lesen dieses Buches den Eindruck gewinnen, dass zu viele Geschichten von Krebs handeln. Dafür gibt es zwei Gründe: Ein wichtiges Ziel ist es, Ihnen die Erfahrungen von Menschen zu vermitteln, die schlagartig mit der Tatsache konfrontiert wurden, dass ihre letzte Stunde sehr nahe sein könnte und dann noch eine Chance bekommen haben, weiterzuleben. Das plötzliche Ende durch einen Unfall oder Herzschlag ermöglicht diesen Erkenntnisprozess nicht. Außerdem wird Krebs in Zukunft die Herz-Kreislauf-Erkrankungen als häufigste Todesursache überholen. Auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir betroffen sein könnten – erfreulicherweise auch die Aussicht auf Heilung.
Viele Menschen hoffen, ihre letzte Stunde zu Hause umsorgt von ihrer Familie und ihren Freunden erleben zu können. Die Wirklichkeit des Sterbens sieht anders aus. Nur jeder Sechste stirbt im eigenen Bett, die überwiegende Mehrheit in einem Krankenhaus oder in einem Heim. Ziemlich sicher blicken wir in unserer letzten Stunde auf eine weiße Decke über uns. Wenn das Ende naht, werden die Wünsche sehr einfach: ein Zimmer, von dem wir am Tag den Himmel mit der Sonne und in der Nacht die Sterne sehen können, ein offenes Fenster, durch das wir das Zwitschern der Vögel hören. Vertraute Gesichter, die uns besuchen und mit denen wir sprechen können. Und wenn wir großes Glück haben, hält jemand unsere Hand. Diese Hand zu fühlen, wird dann zum Wichtigsten unseres ganzen Lebens.
Eine Vielzahl von Gedanken und Fragen geht uns durch den Kopf: Werden meine Kinder ohne mich zurechtkommen? Wie wird mein Partner damit fertig werden? War das schon mein Leben? Habe ich es so gelebt, wie ich es mir gewünscht habe? Habe ich etwas Wichtiges vergessen? Was kommt jetzt?
Die letzte Stunde – der beste Freund für Dein Leben
Der Tod war schon sehr nahe, als ich im November 2009 am Rande des Central Parks eine vertraute Stimme aus der vorbeidrängenden Menschenmenge hörte. „Hallo, Andreas, was machst Du in New York?“ Es war Geri, ein Freund von mir, der seit vielen Jahren erfolgreich im Investmentbereich tätig ist. Zwei Österreicher, die einander auf der Straße in New York treffen, welch ein Zufall. Wir nutzen die Gelegenheit zu einem Mittagessen bei einem kleinen, aber feinen Italiener. Ich erzählte ihm von diesem Buch und meinen Recherchen in den USA. Geri war begeistert von dem Thema und empfahl mir zwei Freunde von ihm, einen prominenten Sportler und den bedeutenden Krebsspezialisten Christoph Zielinski als Interviewpartner zu dem Thema. Nach einem tief gehenden Gespräch über uns, Gott und die Welt trennten wir uns.
Sechs Wochen später, am 25. Dezember hörte ich die sehr aufgekratzt klingende Stimme von Geri auf meiner Mailbox: „Hallo, Andreas, ich habe gehört, Dein Gespräch mit meinem Freund, dem Dr. Zielinski, war sehr ergiebig für Euch beide. Ich habe übrigens noch einen Interviewpartner für Dich. Mich selbst. Ich liege seit einer Woche hier beim Zielinski und habe einen riesigen Tumor im Bauch. Aber mir geht’s großartig. Wir lachen viel gemeinsam, der Christoph und ich. Rufe mich an oder besuche mich. Ich habe Dir jetzt noch mehr zu erzählen.“
„Alles hat mit einem leisen Ziehen in meinen Leisten begonnen.“ So eröffnete Geri das Gespräch mit mir, das acht Wochen nach seiner Nachricht auf meiner Mailbox, am ersten strahlenden Sonntag des Jahres, mitten in seiner Chemotherapie, im schönsten Penthouse der Stadt stattfand. „Mein erster Gedanke, als ich die Diagnose hörte, war nicht: ‚Warum ich?‘, sondern: ‚Aha, ich auch.‘ Das Adrenalin schoss hinein in mich und ich verspürte die dreifache Kraft. Bei mir war alles wie auf Schienen, keine Panik, kein Selbstmitleid. Offensichtlich wendet man das trainierte Verhalten auch in so einer Situation an, ich entwarf präzise Ablaufpläne und ‚To do‘-Listen für den Fall der Fälle.
In all meiner Geschäftigkeit hatte ich plötzlich einen Flashback, etwas, das ich bis dahin nur aus Erzählungen kannte. Mein gesamtes Leben lief innerhalb von Sekunden vor mir ab, es war, wie wenn die Zeit stehen geblieben wäre, und ich wurde mit den wesentlichen Fakten meines Lebens in einer ganz verdichteten Form konfrontiert. Wenn man das Leben als Geschenk betrachtet, dann hatte ich meines nicht so behandelt, wie man mit einem wertvollen Geschenk umgehen sollte. Ich habe fast nichts ausgelassen. Aber wenn es das schon gewesen sein sollte, dann hatte ich mein Leben eigentlich weggeschmissen. Mein Lebenskonzept war, ein Drittel Vollgas zu geben, beruflich sehr erfolgreich zu sein, da habe ich viel erreicht. Ein Drittel etwas für andere zu tun, also das ehrliche soziale Engagement, nicht der Klingelbeutel oder die Teilnahme an der Charity-Veranstaltung, um sein Gewissen zu beruhigen – da hätte ich viel mehr tun können. Und das dritte Drittel sollte die Lebensfreude sein, sich selbst etwas Gutes zu tun, das habe ich völlig verabsäumt. Ich habe immer für das Morgen gelebt, ich habe alles für die Zukunft gespart. Das Sparbuch muss dick sein, und die Aktienpakete hoch. Die meisten Abenteuer habe ich für den Kick gemacht. Nur wenn ich in die Berge gestiegen bin oder Skitouren gemacht habe, dann konnte ich wirklich genießen.
Schuldgefühle hatte ich, als ich bei dem Flashback meine Kinder gesehen habe, weil ich nicht nur zu wenig, sondern in Wirklichkeit überhaupt keine Zeit für sie gehabt habe. Statt dass ich das getan hätte, was mir selbst Spaß gemacht hätte, wie mit meinem Jungen auf den Fußballplatz zu gehen, habe ich einen Kundentermin gemacht, der ohnehin nicht so dringend war, wie ich mir einredete. Oder mit der Tochter Eislaufen gehen, ich gehe selbst gerne Eislaufen, warum habe ich das nicht gemacht? Es war mir immer etwas anderes wichtig. Noch schlimmer als die Schuldgefühle war die Erkenntnis, dass ich etwas nicht gemacht habe, was ich selber gerne getan hätte. Das hat mich am meisten traurig gestimmt.
Und dann bin ich draufgekommen, dass ich immer Ja gesagt habe, zu allen und zu allem. Ich kannte das Wort Nein nur mir selbst gegenüber, da war ich fast ein Asket. Wann immer jemand etwas von mir wollte, habe ich sofort Ja gesagt, auch wenn ich gar nicht helfen konnte, sondern dann erst mühsam versuchen musste, doch etwas für ihn zu tun. Auf die Frage ‚Kennst Du da jemanden?‘ gab es bei mir nur die reflexartige Antwort ,Ja‘. Selbst wenn zwei neben mir über ein Problem diskutiert haben, das mich überhaupt nichts angegangen ist, habe ich mich sofort eingemischt und meine Hilfe angeboten. All das tue ich in Wirklichkeit nur, um mich selber wichtig zu machen. Das Problem liegt aber gar nicht so sehr in dieser Eitelkeit, sondern dass ich so oft Ja gesagt habe, dass ich es dann oft einfach nicht mehr zusammenbringen konnte. Dann hatte ich zusätzlich noch das Gefühl, versagt zu haben. Meine wichtigste Lektion für die Zukunft: Ich werde sehr oft Nein sagen.
Ich habe keine Angst vor dem Versagen mehr. Mein ganzes bisheriges Leben war dominiert von der Angst vor dem Versagen. Heute habe ich doch keine Angst mehr davor, eine Aufgabe nicht zu schaffen, ich denke keine Sekunde mehr darüber nach, dass ich scheitern könnte, weil ich weiß, dass mein Leben unter normalen Umständen eigentlich schon zu Ende gewesen wäre. Als wir uns im November in New York getroffen haben, hatte die Krankheit in mir ein fast schon unheilbares Stadium erreicht. Es war eine Verkettung von glücklichen Zufällen, dass ich heute noch hier sitze. Ich brauche auf niemanden Rücksicht zu nehmen, ich brauche mich vor niemandem zu genieren. Es weiß ohnehin jeder, der mich mit meiner Wollmütze in einem Restaurant sitzen sieht, was los ist.
Nach dem Ende der Chemotherapie beginnt ein neues Leben. Und das, was bisher war, wird ein Baustein im nächsten sein. Wie kann ich mein weiteres Leben so verändern, dass es mir, wenn ich das nächste Mal zurückschauen muss, nicht leid tun muss, was ich alles nicht getan habe? Mir wurde aber auch bewusst, dass das, was ich bisher gemacht habe, nicht umsonst gewesen sein konnte. Alles was ich mir geschaffen habe, werde ich nicht wegschmeißen, sondern das wird die Basis für die Zukunft sein. Auf dem werde ich aufbauen.“
Die Wiederentdeckung der Sinnlichkeit
Mit Menschen, die sehr real mit der Möglichkeit ihres eigenen Todes konfrontiert werden, passiert etwas Seltsames. Es muss eine ganz andere, fundamentalere Erfahrung sein, als wenn man sich nur in seinen Gedanken mit seinem Ende auseinandersetzt. Wenn es wirklich ernst wird, ändert man als Erstes die Wahrnehmung für die Natur. Sie kehrt zurück ins Bewusstsein, obwohl sie seit unserer Kindheit ja nie verschwunden ist. Licht und Dunkel, in der Stadt ohnehin immer schwerer voneinander zu unterscheiden, werden auf einmal wieder bedeutsam, der tiefere Sinn der Geburt und des Endes eines jeden Tages dringt wieder in das Bewusstsein. Es gibt eine große Sehnsucht nach Licht und Sonne. Die Schönheit eines Baumes, der Duft einer Blume, der Geruch frischen Grases oder der Geschmack der Luft, bevor es zu schneien beginnt, der Blick in den Himmel, all jene Dinge, die man bis dahin wie eine ständig vorhandene Kulisse, vor der das eigene Leben abläuft, gar nicht wahrgenommen hat, erwachen plötzlich zum Leben. Der Weg durch die unmittelbare Umgebung erscheint verändert, jedes Haus löst sich auf einmal aus seiner fest gefügten Ordnung und erobert seine Einzigartigkeit zurück, selbst die scheinbar völlig gleichen Reihenhäuser gewinnen durch die Schuhe und Stiefel vor den Haustüren, das Kinderspielzeug, die Blumen und alle kleinen Details an Gestalt. Man spürt seinen Körper sehr präsent, vor allem die Muskeln, die man zu lange vernachlässigt hat. Man schmeckt sein Essen wieder, den Geschmack von frischem Orangensaft, den Duft von Kaffee, man erkennt wieder Süß und Sauer der Speisen, lässt sich jede Mahlzeit auf der Zunge zergehen. Ein Spaziergang durch einen Park oder das Laufen durch den Wald werden zu Ereignissen, die einen mit Freude erfüllen.
Aber das Negative wird ebenfalls viel stärker, man hält keine verrauchten Kaffeehäuser aus, sogar wenn man selbst einmal Raucher war. Auch beim Essen nimmt man das Negative stärker wahr und lehnt bestimmte Speisen intuitiv ab. Bei den Themen, die einen beschäftigen, gibt es einen entscheidenden Wechsel. Dinge wie die eigene Karriere, eine größere Wohnung, der nächste Urlaub verlieren fast völlig an Bedeutung, dafür befasst man sich vor allem mit Gedanken an geliebte Menschen. Die Frage, ob man genug gegeben hat, beschäftigt einen sehr. Themen wie Verantwortung, Verbundenheit mit der Natur, die eigenen Werte und die Sinnfrage bemächtigen sich des Denkens.
Warum bedarf es der Bedrohung ihres Lebens, um auch Menschen, die sich sonst wenig mit Achtsamkeit, Spiritualität und Liebe zu ihren Mitmenschen beschäftigt haben, von einer Sekunde zur anderen Zugang zu ihren inneren Möglichkeiten zu eröffnen, die sie sich sonst nur mit jahrelanger Übung hätten verschaffen können? Warum benötigen wir die Todesahnung, um das Wunder eines Sonnenaufgangs und die verklärte Schönheit eines Sonnenuntergangs wiederentdecken zu können? Auch wenn es klischeehaft klingen mag, es sind genau diese Themen und Gefühle, die ich in den vielen Gesprächen, die ich mit Menschen geführt habe, deren Leben ernsthaft gefährdet war, immer wieder gehört habe. Sie wiederholten stets, wie toll es sei, auf dieser Erde leben zu dürfen. Fast hatte ich den Eindruck, dass ich selbst blind und sie plötzlich sehend geworden waren, nur weil sie auf einmal verstanden, dass ihnen die Schönheit dieser Welt nur mehr sehr begrenzt offenstehen würde. Sie gehörten plötzlich einem recht exklusiven Club an, der seinen Mitgliedern gleich beim Eintritt ganz besondere Fähigkeiten verleiht, dem aber trotzdem niemand freiwillig beitreten will.