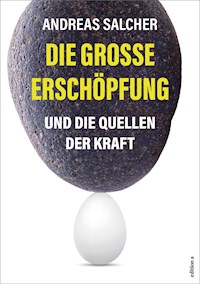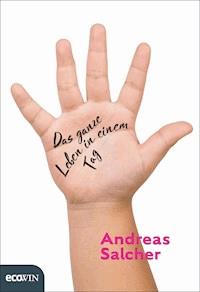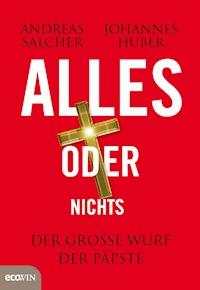
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ecowin
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die nächsten zwanzig Jahre ringt die Menschheit um eine Versöhnung von Wissenschaft und Spiritualität. Mit seinem Mut zur Veränderung hat Papst Franziskus der Kirche neue Hoffnung gegeben. Wer wird ihm im Amt folgen? Was werden seine Nachfolger tun? Zusammen mit dem Theologen und Mediziner Johannes Huber geht der Autor Andreas Salcher dieser Frage nicht nur nach, sondern entwirft ein Bild der Zukunft, das niemanden gleichgültig lässt. Fundamentalismus und Gotteskrise, künstliches Leben, Umweltkatastrophen und Aufstände sind nur einige der Herausforderungen unserer Zeit und der vor uns liegenden zwei Jahrzehnte. Wer wird in Zeiten der gewaltigen Umbrüche für Orientierung sorgen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andreas Salcher
Johannes Huber
ALLESODER NICHTS
Der große Wurf der Päpste
Leserhinweis:
Um die Lesbarkeit des Buches zu verbessern, wurde darauf verzichtet, neben der männlichen auch die weibliche Form anzuführen, die gedanklich selbstverständlich immer mit einzubeziehen ist.
© 2015 Ecowin Verlag bei Benevento Publishing,
eine Marke der Red Bull Media House GmbH, Wals bei Salzburg
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags, der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen sowie der Übersetzung, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Gesetzt aus der Sabon, Akzidenz Grotesk
Medieninhaber, Verleger und Herausgeber:
Red Bull Media House GmbH
Oberst-Lepperdinger-Straße 11–15
5071 Wals bei Salzburg, Österreich
Gesamtherstellung: Buch.Bücher Theiss, www.theiss.at
E-Book-Konvertierung: Satzweiss.com Print Web Software
ISBN 978-3-7110-5144-8
Gewidmet allen, die etwas wagen, scheitern,niederfallen, zweifeln, wieder aufstehen und niemals aufhören, für das zu kämpfen, woran sie glauben.
Orientierung –Worum es in diesem Buch geht
Die Sehnsucht der Menschen nach großen moralischen Autoritäten wird in Zukunft weiter wachsen. Nelson Mandela ist tot. Der Dalai Lama könnte mit hoher Wahrscheinlichkeit der letzte gewesen sein. Es bleibt der Papst. Eine Möglichkeit, vielleicht die einzige. Es wird sehr von den jeweiligen Persönlichkeiten der nächsten Päpste abhängen, wie sehr sie diese Chance nutzen können.
Dieses Buch erzählt die Geschichte der Welt bis in das Jahr 2035 aus der Perspektive von Papst Franziskus und seiner Nachfolger. Das entworfene Szenario für die nächsten 20 Jahre versteht sich als »Science Faction« – nicht »Science Fiction«. Es basiert auf 80 Gesprächen mit Insidern der Kirche, darunter einflussreichen Kurienkardinälen, Bischöfen, Äbten, Theologen, Jesuitenpatres von fünf Kontinenten, langjährigen Vatikanjournalisten ebenso wie einfachen Priestern und Ordensschwestern. Die meisten unserer Interviewpartner bestanden dabei auf der Zusicherung absoluter Vertraulichkeit. Sie sind daher nicht, wie sonst bei Sachbüchern üblich, im Quellenverzeichnis angeführt. Viele der wörtlichen Zitate von fiktiven Personen in diesem Buch stammen aber aus unseren vertraulichen Gesprächen mit Repräsentanten der Kirche und sind daher authentisch. Am Ende jedes Kapitels wird auf die realen Zusammenhänge und Fakten hingewiesen, um dem Leser die Orientierung zwischen Fiktion und Wahrheit zu ermöglichen.
Von Mark Twain stammt das berühmte Zitat, dass man sich vor Prognosen unbedingt hüten sollte, vor allem vor solchen, die die Zukunft betreffen. In seinem bedeutenden Buch »Megatrends« sagte John Naisbitt die großen Entwicklungen wie den Aufstieg Asiens oder »High Tech – High Touch« richtig voraus. Trotzdem konnte er im Jahr 1982 selbst mit seinen ausgefeilten Analysetechniken den Zusammenbruch des Kommunismus oder die Folgen von 9/11 nicht vorhersehen.
Manchem Leser werden die Veränderungen, die wir in unserem Zukunftsszenario beschreiben, als zu gewagt, ja unrealistisch erscheinen, vor allem für einen so kurzen Zeitraum. »Die katholische Kirche denkt in Jahrhunderten, nicht in Jahrzehnten«, hört man oft in Rom. Wir glauben das nicht, schon deshalb, weil die Kirche keine Jahrhunderte mehr Zeit hat, um im 21. Jahrhundert anzukommen. Die beschriebenen Veränderungskräfte werden sich wechselseitig beschleunigen, die Intelligenz und das Bewusstsein der Menschheit wachsen und die Probleme der Welt exponentiell zunehmen. An diesem kritischen Punkt wird die Menschheit entscheiden müssen: Untergang oder Einswerdung – alles oder nichts.
Heute schreiben wir das Jahr 2015, das Jahr 2035, in dem unser Szenario endet, scheint sehr nah, zu nah für radikale Veränderungen. Um zu erahnen, wie viel sich in den nächsten 20 Jahren verändern wird, kann es hilfreich sein, kurz in die Welt vor 20 Jahren zurückzukehren. Erinnern wir uns daran, wann wir das erste Mal eine E-Mail geschrieben haben? Bei 99 Prozent von uns wird das weniger als 20 Jahre her sein, weil im Jahr 1995 nur ein Prozent der Menschen über einen Internetanschluss verfügte. Haben wir vor 20 Jahren schon gegoogelt? Sicher nicht, denn Google wurde erst 1998 gegründet.
Das Internet ist ein typisches Beispiel für einen »Schwarzen Schwan«. Der Ausdruck stammt aus dem gleichnamigen Buch von Nassim Nicholas Taleb. Er bezeichnet damit ein Ereignis, das extrem unwahrscheinlich ist, völlig überraschend eintritt und sich im Nachhinein einfach erklären lässt. Wir gehen davon aus, dass die Entwicklung der Kirche und der Welt in den nächsten 20 Jahren massiv von »Schwarzen Schwänen«, also der Macht höchst unwahrscheinlicher Ereignisse beeinflusst werden wird. Die im Buch vorhergesagten »Schwarzen Schwäne« sind als Beispiele für unerwartete Ereignisse zu verstehen, die unsere Erwartungen an die Zukunft völlig über den Haufen werfen könnten.
Wir möchten zu Beginn einige Ausgangsthesen offenlegen:
>Der Veränderungsprozess in Richtung einer lebendigen Kirche, den Franziskus eingeleitet hat, ist unabhängig von seiner Person und seiner möglichen Nachfolger unumkehrbar.
>Das ständige Wachstum des menschlichen Gehirns und Bewusstseins ist ein Faktum. Die Ausdehnung des Kosmos ebenso. Wir folgen den Spuren eines genialen Jesuiten, der vor 60 Jahren erahnt hat, dass es einen Zusammenhang zwischen diesen Tatsachen gibt. Sein faszinierender Versuch einer Synthese von wissenschaftlicher Erkenntnis und Spiritualität ist das Fundament, auf dem wir aufbauen.
>Wir glauben, dass der rationale moderne Mensch sich darauf einlassen kann, dass es Dinge gibt, die er mit seinem Verstand nicht erfassen, von denen er sich aber berühren, überraschen und überwältigen lassen kann.
>Unsere Welt wird in den nächsten 20 Jahren nicht von der Auseinandersetzung zwischen dem Islam und dem Christentum, sondern vom Krieg »Fundamentalismus gegen Aufklärung« geprägt sein. Dieser Krieg findet innerhalb und zwischen den Religionen statt und beherrscht auch die politische Auseinandersetzung.
>Im besten Fall schafft die Kirche in den nächsten 20 Jahren den Schritt zu einem universellen Verständnis von Gott und Kosmos, von dem sich dann die in ihrem Bewusstsein erweiterten Menschen wieder mehr angesprochen fühlen.
>Die Kirche wird in 20 Jahren weiblicher, jesuitischer und spiritueller sein – oder sie wird nicht mehr sein.
Es gibt viele Szenarien über die EU, die USA, China oder das Weltklima. Ist die Frage, an wen oder was wir in 20 Jahren noch glauben werden, nicht mindestens so wichtig für jeden von uns? Wir freuen uns, wenn Sie uns auf dieser Reise in die Zukunft folgen.
Andreas Salcher und Johannes Huber
Wien, im September 2015
Liste der Päpste, die im Buch vorkommen
Petrus (Simon Petrus, Galiläa, heute Israel):
Bischof von Rom 33–67 n. Chr.
Mit seiner Einsetzung durch Jesus begründet die Kirche das Papstamt. Die Jahreszahlen seiner Amtszeit sind biblische Annahmen, nicht historische Fakten.
Alexander VI. (Rodrigo Borgia, Spanier):
Papst vom 11. 8. 1492 bis zum 18. 8. 1503
Gilt als berüchtigter Renaissancepapst.
Pius IX. (Giovanni Mastai-Ferretti, Italiener):
Papst vom 16. 6. 1846 bis zum 7. 2. 1878
Ließ am Ersten Vatikanischen Konzil die Unfehlbarkeit des Papstes beschließen.
Pius XII. (Eugenio Pacelli, Italiener):
Papst vom 2. 3. 1939 bis zum 9. 10. 1958
Seine Führung der Kirche durch die schwierige Nazi-Zeit ist historisch umstritten.
Johannes XXIII. (Angelo Roncalli, Italiener):
Papst vom 28. 10. 1958 bis zum 3. 6. 1963
Berief das Zweite Vatikanische Konzil ein und sorgte für Aufbruchsstimmung.
Paul VI. (Giovanni Montini, Italiener):
Papst vom 21. 6. 1963 bis zum 6. 8. 1978
Brachte das Zweite Vatikanische Konzil erfolgreich zum Abschluss. Seine Entscheidung, die »Pille« zu verbieten, belastet die Kirche bis heute.
Johannes Paul I. (Albino Luciani, Italiener):
Papst vom 26. 8. 1978 bis zum 29. 9. 1978
Verstarb nach nur 33 Tagen im Amt. Die durch eine verfehlte vatikanische Kommunikation ausgelösten Gerüchte um seine Ermordung halten den Fakten nicht stand.
Johannes Paul II. (Karol Wojtyła, Pole):
Papst vom 16. 10. 1978 bis zum 2. 4. 2005
Beliebt wegen seines Charismas und seines Sieges gegen den Kommunismus, umstritten wegen seines erzkonservativen Kurses und einiger missglückter Bischofsernennungen.
Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger, Deutscher):
Papst vom 19. 4. 2005 bis zum 28. 2. 2013
Langjähriger oberster Hüter der Glaubenslehre, trat nach schweren Indiskretionen in der Kurie aus gesundheitlichen Gründen zurück.
Franziskus I. (Jorge Mario Bergoglio, Argentinier):
Papst vom 13. 3. 2013 bis zum 31. 1. 2019
Derzeit amtierender Papst, der versucht, die Kirche grundlegend zu reformieren.
Franziskus II. (Thomas Gleeson, US-Amerikaner):
Papst vom 21. 2. 2019 bis zum 15. 1. 2029
Johannes XXIV. (Sanjay Xavier, Inder):
Wahl zum Papst am 4. Februar 2029
Prolog –Der Papst vom anderen Ende der Welt
In Rom lebte einst ein Papst, der im Appartement 201 im Gästehaus der heiligen Marta nahe den vatikanischen Gärten wohnte. Das fünfstöckige Gebäude erinnerte eher an einen kommunalen Sozialbau als an einen vatikanischen Palast. Der Papst, der den Namen Franziskus gewählt hatte, trug strahlend weiße Kleider und ausgetretene schwarze Schuhe. Er predigte eine Kirche der Armut und des Mitgefühls. Er scheute sich nicht, Häftlinge in Gefängnissen zu besuchen, auch wenn das, was er dort sah, schrecklich war. Von seinen Priestern forderte er, ihre Verpflichtung gegenüber den Bedürftigen aus nächster Nähe zu erfüllen. Man dürfe sich vor einem Armen nicht ekeln, man müsse ihm in die Augen sehen. Gute Hirten müssten wie ihre Schafe riechen.
Schafe riechen meist nicht gut. Vor allem für Kardinäle, die gewohnt waren, in Palästen zu wohnen. Deren einzige Berührung mit Schafen waren die purpurroten Socken, die sie bei »Euroclero« in der Via Paolo VI, 31 kauften. Doch die meisten bevorzugten die Ausführung in Seide. Bei diesem Meister der klerikalen Schneiderkunst quollen die Regale über vor Stoffballen aus feinster Seide, Wolle, Leinen und Popeline, dazu jede Menge Zöttelchen, Quasten, Seidenbordüren, Fransen und Knöpfe. Für die Prälaten[1] wurden die exakten Größen handgeschrieben in großen Folianten im Hinterzimmer für deren hohen Besuche bereitgehalten.
Die erste Schlacht gegen diesen barocken Ausstattungswahn focht und gewann der neue Papst unmittelbar nach seiner Wahl im Umkleideraum. Er lehnte sowohl die roten Schuhe als auch den Samtumhang, die Mozetta, ab. Als der Zeremonienmeister insistierte, machte er diesem mit wenigen Worten klar, wer der neue Herr im Vatikan ist: »Der Maskenball im Vatikan ist nun zu Ende.« Nach seiner ersten Ansprache am Petersplatz stand ein S-Klasse-Mercedes für ihn bereit. Darin wartete der Kardinaldekan, der in der Vakanz nach dem Rücktritt des alten Papstes die Geschäfte des Vatikans geführt hatte, auf den neu gewählten Stellvertreter Christi. Er wartete lange. Der Platz neben ihm, auf dem noch das Papstwappen seines Vorgängers eingestickt war, blieb leer. Franziskus stieg gemeinsam mit den anderen Kardinälen in einen Bus. Seitdem fuhren viele vatikanische Würdenträger mit der U-Bahn statt mit Limousinen mit dem Vatikankennzeichen SCV, dessen Bedeutung von den Römern immer als Se Christo vedesse – »Wenn Christus das sehen würde« verhöhnt wurde. Man reiste in der Economy-Klasse. Jesus begegnet einem nicht in der ersten Klasse, hatten sie sich sagen lassen müssen.
Viele im Hofstaat, genannt die Kurie, fürchteten ihren neuen Chef. Vor allem die italienischen Kurienkardinäle hatten ihre Macht unter seinen Vorgängern ständig ausgebaut und fühlten sich nun bedroht. Ihrer Ansicht nach war es unwürdig für einen Stellvertreter Christi, sich so weltlich zu verhalten. Hinter vorgehaltener Hand stellten sie die Frage, ob die Malachias-Prophezeiungen vielleicht doch recht hatten, dass mit Franziskus das Ende des Papsttums und sogar der Kirche drohte.
Genau das hatte Malachias, ein irischer Mönch und späterer Bischof von Armagh, der im 12. Jahrhundert lebte, einst düster vorhergesagt. Seine 112 Papst-Prophezeiungen begannen mit Papst Cölestin II. im Jahr 1143 und endeten mit dem 112. Franziskus war der 112. Papst in der Reihe. Nach ihm werde Rom zerstört werden und »der furchtbare Richter sein Volk richten. Ende.« Die Weissagungen des Malachias hatten sich tief in die römische Volksfrömmigkeit eingegraben, weil sie selbst in der Neuzeit auf rätselhafte Weise zuzutreffen schienen. So wurde Johannes XXIII. (1958–1963) beispielsweise als »pastor et nauta« (»Hirte und Seefahrer«) beschrieben, und tatsächlich war Angelo Giuseppe Roncalli vor seiner Wahl zum Papst Bischof der Seefahrermetropole Venedig gewesen. Auch die Weissagung für Johannes Paul II. »De labore solis« (»Von der Mühsal der Sonne«) konnte man dahin deuten, dass Karol Wojtyła am 18. Mai 1920 während einer Sonnenfinsternis geboren wurde. Nicht nur die totale Sonnenfinsternis im August 1999 fiel in sein Pontifikat, auch am Tag seines Begräbnisses verdunkelte sich die Sonne über dem Pazifik zu einer totalen Sonnenfinsternis.
Die Wahrheit war eine andere. Die Wissenschaft hatte die Malachias-Prophezeiungen schon lange als eine der vielen Fälschungen in der Kirchengeschichte entlarvt, eine besonders raffinierte allerdings. Forscher hielten Alfonso Ceccarello für den Urheber. Dieser war bei der Papstwahl 1590 Sekretär des Kardinals Girolamo Simoncelli und wollte mit der Fälschung wohl die Chancen seines Herrn im Konklave erhöhen, erfolglos jedoch. Um den Malachias-Prophezeiungen hohe Glaubwürdigkeit zu verleihen, hatte Ceccarello die Prophezeiungen einfach 500 Jahre zurückdatiert und Bischof Malachias untergeschoben. Nur deshalb wirkten die Vorhersagen so präzise, was die Vergangenheit betraf. In der Gegenwart wurden die Weissagungen des Malachias nun von den Gegnern des Papstes Franziskus als Waffe gegen ihn verwendet. Sie schürten die Ängste bei für Untergangsprophezeiungen anfälligen Menschen.
Offenen Widerstand gegen Franziskus wagte am Anfang niemand von den Wölfen im Kardinalspelz. Denn nur scheinbar verlief die Frontlinie zwischen den Verteidigern der ewigen Glaubenswahrheiten und den Kämpfern für grundlegende Reformen. Die bei Weitem stärkste Gruppe waren die Vorsichtigen und Ängstlichen. Die Frage, für welche Seite sie sich entscheiden sollten, war absurd für sie. Man überlebte im Vatikan, indem man rechtzeitig auf die richtige Seite wechselte.
Die besonders Vorsichtigen hatten sich in ihre eigenen vier Wände zurückgezogen und warteten, was passierte. Sie überlegten zweimal, ob sie weiterhin gerne in Luxusrestaurants gesehen werden wollten, solange ihr oberster Herr vornehmlich in der Kantine speiste. Um sieben Uhr morgens las Franziskus werktags die Messe und lud dazu jeweils 50 Gäste ein, mit ihm danach zu frühstücken. Diese Einladungen waren natürlich heiß begehrt, wurden aber nicht an politische oder wirtschaftliche Würdenträger vergeben, was viele Protokollbeamte zur Verzweiflung trieb. Erst kamen die Arbeiter, die Küchengehilfen, die Gärtner und die Feuerwehrleute dran. Dann bat der Papst Pfarrer aus Rom mit jeweils fünf Gemeindemitgliedern zum Frühstück. Bei den eingeladenen Pfarrern löste das immer Stress aus, denn wen sollten sie mitnehmen und wem absagen?
In der Öffentlichkeit wurde viel darüber diskutiert, dass der neue Papst vom »anderen Ende der Welt« kam. Dabei übersah man eine entscheidendere Tatsache: Er stammte im Gegensatz zu seinen Vorgängern nicht aus Kleinstädten wie Marktl am Inn, Wadowice oder Canale d’Agordo, wo die katholische Welt noch in Ordnung war, sondern aus einer Metropole mit 13 Millionen Einwohnern. Dort trafen die verschiedenen Religionen auf den Atheismus, so unterschiedliche Gruppen wie die Jesuiten oder die Freimaurer hatten eine große Tradition. Vor allem prallte extremer Reichtum auf ungeheure Armut. Diese Erfahrungen prägten den einstigen Erzbischof von Buenos Aires, wenn er jeden Tag mit der U-Bahn durch die Stadt fuhr.
Das satte, selbstverliebte Europa war für Franziskus 76 Jahre seines Lebens sehr weit weg. Ihn erschütterte, mit welcher Gleichgültigkeit man dort akzeptierte, dass jedes Jahr mehr Menschen in der Welt an den Folgen von Übergewicht als an Hunger starben. Ihm ging es darum, keinen Menschen seiner Würde zu berauben und ihn wie Abfall zu behandeln. Diese Überzeugung machte ihn aus: Hilf dem, dem Du helfen kannst. Rette nicht die Welt, aber Deinen Nächsten. Du brauchst nicht zwischen den Palästinensern und Israeli Frieden zu stiften, aber Du kannst jemandem, mit dem Du zerstritten bist, einfach sagen: Ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir leid.
War Papst Franziskus ohne Fehler oder gar ein Heiliger? Wo viel Licht ist, gibt es immer auch Schatten. Manches, was er sagte, klang im besten Fall seltsam, wie sein Bekenntnis zum Exorzismus. Wilde Empörung löste er aus, als er einen Vater ausdrücklich lobte, der seine Kinder manchmal schlug, wenngleich nie ins Gesicht, um sie nicht zu erniedrigen. Das war ein Satz, der lange haften blieb, den er nicht wieder so schnell loswurde.
Europa: Auf diesem ihm so fernen Kontinent fand er aus nächster Nähe alles bestätigt, was er aus der Ferne geahnt hatte. Das Heilige war schon lange aus dem Alltag der Menschen entwichen. Selbst im katholischen Italien mussten bei Hochzeiten und Taufen die Texte mit dem »Vaterunser« in den Kirchen aufgelegt werden, weil es die meisten Besucher sonst nicht mitbeten konnten. Kirchliche Feiertage wurden als willkommene Urlaubstage wahrgenommen, das Weihnachtsfest als Shoppingexzess gefeiert, Ostern für Städtereisen genutzt. Die Begriffe Sünde und Buße waren aus der öffentlichen Diskussion verschwunden. Ein italienischer Priester erzählte dem Papst von verschreckten Paaren, die ihn bei den Ehevorbereitungskursen fragend ansahen, wenn er von Keuschheit sprach: »Keuschheit, was ist denn das, können Sie das bitte erklären?« Sie verstanden ganz einfach das Wort nicht. Es war zum Fremdwort geworden.
Franziskus’ wichtigster Vorsatz war, unter allen Umständen sich selbst treu zu bleiben. Das ging am einfachsten, wenn er das Leben eines Jesuiten fortsetzte. So klingelte jeden Tag um 4.45 Uhr der Wecker. Nachdem er geduscht und sich rasiert hatte, begann er den Tag mit einem Gebet. Danach brühte er sich selbst seinen geliebten Matetee. Die wirkliche Herausforderung begann, sobald er sein Appartement verließ. Immer wieder hatte man versucht, ihm ein Protokoll und starre Zeitpläne aufzuzwingen. Eine seiner wirksamsten Gegenstrategien war seine Weigerung, in den Apostolischen Palast einzuziehen.
Er war der erste Papst, der Briefe einfacher Bürger nicht nur las, sondern auch selbst beantwortete. Berührte ihn eine E-Mail besonders, griff er zum Telefon und rief einfach an. So hatte ihm eine geschiedene Frau, die von ihrem Mann verlassen worden war, geschrieben, dass sich ihr Pfarrer weigerte, ihr die Kommunion zu spenden. Sie brauchte einige Zeit, um zu realisieren, dass es der Papst persönlich war, der ihr am Telefon riet, zu einem anderen Pfarrer zu gehen. Immer wieder passierte es, dass derartige Gespräche in die Öffentlichkeit gelangten. Das sorgte dann für Aufregung im Apostolischen Palast. Das war Franziskus ziemlich egal. Es gab wichtigere Fragen, die ihn bewegten: »Wie kann man einer Milliarde Menschen, die in Hunger und Armut leben, helfen?«, und: »Wie stoppt man die Entfremdung des modernen Menschen von Gott?«
»Gott ist nicht katholisch«, hatte Franziskus einmal zum Schrecken seiner Berater in einem Interview eingestanden. Sein Bild von Gott war viel größer. Im Laufe seines Lebens hatte er für sich immer klarer erkannt, dass Gott sich von keiner Religion vereinnahmen ließ. Gott stand allen Menschen offen, die guten Willens waren. So lautete die Lehre, die Jesus den Menschen verkündet hatte. Jesus schloss niemanden aus, seine Symbole waren keine festen Dogmen, sondern offen für viele Auslegungen. Deshalb waren seine Bilder wie die Bergpredigt so zeitlos. Alles Einzigartige, das sich vom Christentum trotz aller Stürme und Irrwege der Zeit bis in die Gegenwart erhalten hatte, entstammte diesem vortrefflichen Ursprung.
Franziskus sah sich selbst als einen Ruhelosen. Bei seinem Suchen und Finden Gottes in allen Dingen blieb immer ein Bereich der Unsicherheit. Der musste da sein. Es war der Zweifel, der den Gläubigen mit dem Ungläubigen verband. Wenn jemand behauptete, er sei Gott mit absoluter Sicherheit begegnet, und nicht berührt war von einem Schatten der Unsicherheit, dann lief etwas schief. Viele seiner Amtsträger fühlten sich wohl in dem, was sie wussten, statt sich nach dem zu sehnen, was sie noch zu lernen hatten. Einige völlig Verblendete hatten Papst Franziskus in Büchern sogar Häresie, also Ketzerei vorgeworfen, weil sie sich als Besitzer und nicht als Hüter der wahren Lehre verstanden.[2] Da waren Kreise am Werk, die schon die Rehabilitation von Galileo Galilei durch die Kirche im Jahr 1992, immerhin vier Jahrhunderte nach dessen Prozess, als völlig unnötigen Kniefall der Kirche empfanden.
Nachdem er sich ein umfassendes Bild gemacht und eine Vielzahl von Gesprächen geführt hatte, fühlte Franziskus sich sehr allein. Die Themen reichten von der ständig wachsenden Kluft zwischen der Lebensrealität der Mitglieder und den Lehren der Kirche, dem dramatischen Einbruch beim Priesternachwuchs und dem Aussterben vieler Orden über die Herausforderung durch den evangelikalen Fundamentalismus in den USA und Südamerika bis hin zu den finanziellen Schwierigkeiten, die sich durch den Schwund der zahlungswilligen Gläubigen in den reichen westlichen Ländern ständig verschärften. Kirchenkritische Kommentare spitzten sich nicht ganz ohne Berechtigung auf die Frage zu: »Wie soll die Kirche Verkünderin einer frohen Botschaft gegenüber einer Menschheit sein, die in ihrer erdrückenden Mehrheit nichts davon hören will?«
Die Bedrohungen würden sich in den nächsten zehn Jahren weiter verschärfen und stellten eine existenzielle Gefahr für die Kirche dar. Viele Gemeinden in Europa, aber auch in Lateinamerika oder Afrika hatten keine Pfarrer mehr. Ein Großteil der modernen Frauen verließ die Kirche schon frühzeitig. Neben den Frauen drohte auch ein Verlust der Jungen, die weder katholisch erzogen wurden noch den Religionsunterricht besuchten.
Um die Mission der Kirche erfüllen zu können, waren, wie in der Geschichte schon mehrmals bewiesen, mutige Schritte der Erneuerung notwendig. Die Reform musste dabei weit über die öffentlich diskutierten Themen wie geschiedene Wiederverheiratete, Geburtenregelung, Zölibat, Homosexualität und demokratische Bischofsbestellungen hinausgehen. Diese waren für die betroffenen Menschen wichtig und mussten gelöst werden. Das würde vielleicht die Zahl der Kirchenaustritte bei kritischen Menschen in Europa abschwächen, aber der Kern des Problems von Glauben und Kirche lag viel tiefer. Die Substanz des Christentums gründet auf einer frohen Botschaft. Die fundamentale Frage für Franziskus lautete: Wie konnte er diese frohe Botschaft so verkünden, dass diese gehört und verstanden wurde? Welchen Weg sollte er einschlagen, um seine Ziele zu erreichen? Er brauchte einen Plan.
Immer wenn er sich einer besonderen Herausforderung gegenübersah, holte Franziskus ein abgegriffenes Buch hervor, das mit vielen persönlichen Anmerkungen in seiner kleinen präzisen Handschrift versehen war. Dieses Buch hatte ihm in der dunkelsten Zeit seines Lebens einer seiner wenigen verbliebenen Freunde geschenkt. Damals wurde ihm von seinem Orden plötzlich die Lehrerlaubnis an der Universität entzogen und er musste fern der Hauptstadt Buenos Aires ins Exil nach Córdoba gehen. Dort saß er völlig isoliert fest, sogar seine Post wurde kontrolliert und Telefonanrufe für ihn nicht durchgestellt. Das stürzte ihn in eine schwere innere Krise. Offenbar war ihm bestimmt, den Rest seines Lebens ausschließlich im Gebet zu verbringen und über seinen autoritären Führungsstil nachzudenken, mit dem er sich so viele Feinde gemacht hatte.[3] Die Fähigkeit, sich viele Feinde zu machen, verband ihn mit dem Autor jenes Buches.
Diesen Mann, Jesuit wie er selbst, hatte es viel härter getroffen. Er galt als gefährlicher Neuerer und wurde von einer ängstlichen Kirche zu völligem Schweigen in der Öffentlichkeit verurteilt, obwohl sich die Welt nach seinen Ideen sehnte. Seine Werke durften zu seinen Lebzeiten nie veröffentlicht werden. »Ich kann meine Haltung genauso wenig ändern wie die Zahl meiner Jahre oder die Farbe meiner Augen«, hatte der französische Jesuit einmal über sich selbst gesagt. Franziskus fühlte sich diesem Schicksalsgefährten verbunden. Dessen verbotenes Buch begleitete ihn seit dem Exil in Córdoba als geheime Quelle der Inspiration und Ermutigung. Beim Durchblättern blieb er an einer Stelle hängen:
»Ich glaube, die Welt wird sich nicht zu den himmlischen Hoffnungen des Christentums bekehren, wenn sich nicht zuvor das Christentum zu den Hoffnungen der Erde bekehrt … Die Welt wird dem gehören, der ihr auf dieser Erde die größte Hoffnung anzubieten hat.«
I.Aufbruch –Die lebendige Kirche und ihre Feinde
2013: Der Plan des Franziskus
»Vergiss die Armen nicht«, hatte der unmittelbar nach der Verkündung seiner Wahl zum Papst im Konklave neben ihm sitzende brasilianische Kardinal Claudio Hummes zu Jorge Mario Bergoglio gesagt. Dieser eine Satz sollte die Wahl seines Namens begründen und seine Kernbotschaft werden, nicht nur in Worten, sondern vor allem in allen Handlungen.
Papst Franziskus war zum Zeitpunkt seiner Wahl 76 Jahre alt und lebte wegen einer schweren Kindheitserkrankung nur mit einem Lungenflügel. Er wusste, dass er nur eine begrenzte Zeit für seine Mission hatte. Wollte er die Kirche ins dritte Jahrtausend führen, so musste er sie zu ihren Ursprüngen vor 2000 Jahren zurückführen. Damals hatte die Kirche keine Dogmen, keine Besitztümer, keine Theologen, dafür eine klare Botschaft: Jesus liebt Dich. Diesen Weg hatte Jesus vorgezeichnet. Er hatte sich immer der Ärmsten angenommen und dafür die Mächtigen herausgefordert. Dort war der Platz der Kirche und ihrer Priester, nicht in den Palästen und theologischen Studierstuben. Kein Apostel hätte auch nur eine einzige Prüfung an einer theologischen Fakultät bestanden. Dafür würden heute viele Theologen bei der Umsetzung ihrer Theorien in angewandte Nächstenliebe scheitern. Petrus wandelte sich durch die Begegnung mit Jesus vom einfachen Fischer zum begabten Menschenfischer, als Apostelfürst hatte er sich nie gesehen. In dieser Nachfolge sah sich auch Franziskus.
Eine Kirche, die sich konsequent als Fürsprecherin der Armen verstand, würde auf viel Widerstand stoßen, außerhalb, aber auch innerhalb ihrer eigenen Reihen. Es bedeutete Konfrontation mit einer Wirtschaftsordnung, die zuließ, dass Millionen trotz harter Arbeit hungerten und in tiefstem Elend leben mussten. Gott hatte den Menschen das Geschenk des Brotes gegeben. Jeder hatte ein Grundrecht darauf, sein Brot durch eigene Arbeit zu verdienen. Die Arbeit verlieh Würde. Das tägliche Brot war für Franziskus kein Almosen, das die Reichen den Armen spendeten, ohne ihnen dabei in die Augen schauen zu müssen. Die Betrachtung des Menschen als reinen Kostenfaktor in der Marktwirtschaft machte diesen vom beseelten Subjekt zum seelenlosen Objekt. Es herrschte ein völliger Vertrauensverlust. Vor jedem Juweliergeschäft in den Stadtzentren stand ein privater Security-Mann, und viele Geschäftsinhaber hatten eine geladene Waffe unter ihrem Ladentisch.
Kein Wunder, dass immer mehr Menschen selbst nicht mehr daran glaubten, eine Seele zu haben. Das betraf sowohl die Reichen, die immer größere Haufen von Geld, Häusern und Luxusgütern ansammelten und dabei nicht glücklicher wurden, als auch die Masse der Armen, die so vom täglichen Überlebenskampf erschöpft waren, dass sie die Fähigkeit, an etwas Höheres zu glauben, verloren hatten.
So denkt Franziskus
Für Franziskus war die Verkündung der »Kirche für die Armen« keine strategische Entscheidung, weil das Hoffnungspotenzial für die Kirche in Südamerika und Afrika lag. Die Sorge für die Armen bildete für ihn die Wurzel des Christentums. Daraus war das Christentum entstanden, mit der Botschaft der bedingungslosen Nächstenliebe war es gewachsen und dorthin wollte Franziskus es wieder zurückführen.
Franziskus versuchte den Weg, den er in Buenos Aires begonnen hatte, in Rom weiterzugehen – gegen alle Widerstände. So setzte er sich drei klare Ziele, die er mit aller Kraft erreichen wollte:
1.Seine Mission war, eine »arme Kirche für die Armen« zu schaffen. Und das Zweite ging für ihn nicht ohne das Erste. Eine Kirche, die selbst ihre Besitztümer hortete, konnte nicht glaubhaft für die Armen da sein. Eine barmherzige Kirche, die sich um die Armen, die Verfolgten und Gestrauchelten kümmerte, war mit einer machtbewussten Staatskirche unvereinbar.
2.Mitfühlende Priester, die sich als Nachfolger von Jesus sahen, statt verweltlichte Kleriker und abgehobene Theologen. Das verlangte die Nähe zum Menschen, statt sich hinter einer Institution zu verschanzen. Deshalb sprach Franziskus von sich auch immer als Bischof von Rom und selten als Papst.
3.Die Versöhnung von Glauben und Vernunft: Viele Lehren der Kirche waren mit den Erkenntnissen der Wissenschaft unvereinbar und schufen unüberbrückbare Gräben zu den aufgeklärten Menschen der Gegenwart.
Doch wie weit durfte er gehen? Schon nach wenigen Monaten wurde Franziskus von Medien mit Michail Gorbatschow oder Barack Obama verglichen. Das waren keine wohlmeinenden Vergleiche, Gorbatschow scheiterte bekanntlich daran, ein starres, zentralistisches System von oben her zu reformieren und Obama konnte die Mauern, die ihm seine hasserfüllten Gegner aufbauten, nicht überwinden.
Gerade deshalb wollte Franziskus schnell und wirksam handeln, statt sich jahrelang mit dem hinhaltenden Widerstand einer veränderungsresistenten Kurie[4] herumzuschlagen. Noch verfügte er innerhalb der Kirche über keine organisierte Anhängerschaft. Es gab keine starken Organisationen, die sich für seine Mission öffentlich einsetzten, so wie es das Opus Dei[5] unter Johannes Paul II. getan hatte. Selbst der Beistand durch die Jesuiten[6], jenem Orden, dem er selbst angehörte, war mehr als überschaubar. Ehrliche Unterstützung kam weit eher von einfachen Menschen überall auf der Welt als von der innerkirchlichen Struktur. Das musste er ändern.
Der gewaltige Erneuerungsprozess, den Franziskus vorhatte, musste klug gesteuert werden, wenn er nicht schon im Ansatz scheitern sollte. Die Kirche hatte 1,2 Milliarden Mitglieder auf allen Erdteilen. Um eine Organisation dieser Größenordnung aus ihrer Erstarrung zu befreien und die positiven Kräfte zu entfesseln, die es Gott sei Dank gab, reichte auch die Macht eines absoluten Papstes nicht aus. Man konnte die Einstellung von über 500.000 Priestern und Ordensleuten nicht über Nacht mittels Glockenschlag im Petersdom ändern.
In Franziskus’ Kopf formten sich seine ersten Ideen zu einem klaren Plan. Er wollte einen Prozess einleiten, der einmal gestartet unaufhaltsam wirksam werden sollte. Dabei würde er sich der Möglichkeit bedienen, traditionelle kirchliche Strukturen wie Bischofssynoden[7] zu nutzen, diese aber im Gegensatz zur Vergangenheit mit offener Diskussionskultur und Entscheidungsmacht ausstatten. Zusätzlich sollten regelmäßige Befragungen aller Gläubigen die Kluft zwischen der kirchlichen Lehre und der Lebensrealität der Menschen dokumentieren und den Boden für Veränderungen aufbereiten. Die Seelsorger vor Ort, die Männer und Frauen im Dienst der Gemeinden und vor allem die Laien würden dadurch eine Stimme erhalten, die erstmals gehört werden musste.
Ohne Hang zur Selbstüberschätzung wusste Franziskus, dass die Zukunft der Kirche mit seiner Person eng verknüpft war. Die Wahl seines Namens stand als Programm. Der heilige Franziskus von Assisi[8] war ein Mann voller Entschlossenheit, der für seine radikale Lehre vom einfachen Leben kämpfte. Dann war da noch der Ordensgründer der Jesuiten, Ignatius von Loyola, der Franziskus ebenfalls stark geprägt hatte. An Ignatius bewunderte er die Kombination aus Disziplin und Durchsetzungsvermögen. Doch auch ein Heiliger wie Ignatius hätte den Orden der Jesuiten nicht ohne fähige Mitstreiter und kluge Berater aufbauen können. Teile dieses von den Jesuiten seit Jahrhunderten erprobten Systems wollte Franziskus auch auf die Spitze der Weltkirche übertragen.
Im Jesuitenorden stand jedem Provinzial[9], dem Obersten in einer Region, ein Beratungsorgan von herausragenden Köpfen zur Seite. Allein die Existenz eines derartigen Gremiums würde als Signal dafür gedeutet werden, dass kein Stein auf dem anderen bliebe. So betraute er kurz nach seiner Wahl ein ursprünglich aus acht, dann aus neun Kardinälen (K-9) bestehendes Kollegium mit der offiziellen Aufgabe, die Zusammensetzung und vor allem die Struktur der Kurie völlig neu zu gestalten. Diese sollte sich nicht mehr als Generalstab mit zentraler Befehlsgewalt, sondern als Einrichtung des Dienstes für den Papst und für die Bischöfe verstehen. Das würde vielfach auch neues Führungspersonal verlangen. Dieses galt es schnell zu finden. Die K-9 scheuten sich von Anfang an nicht, wichtige Entscheidungen der offiziell noch amtierenden Kurie an sich zu ziehen.
Vieles, das sich hinter den Mauern des Vatikans abspielte, blieb im Verborgenen. Von dem, was Franziskus plante und mit seinen Vertrauten besprach, erfuhr die Öffentlichkeit meist erst im Nachhinein. Das galt insbesondere für die Besetzung wichtiger Positionen. Umso mehr blühten Gerüchte, Spekulationen und gezielte Falschmeldungen, um unliebsame Kandidaten zu desavouieren. Die festgefahrene Tradition, »es war schon immer so«, galt nicht mehr. Die ersten Kardinalsbesetzungen zeigten schnell, dass die Weltkirche in Zukunft nicht mehr italienisch sprechen würde. Während der mächtige Patriarch von Venedig und der Erzbischof von Turin bei den ersten Kardinalsberufungen von Franziskus übergangen wurden, kamen auf einmal Bischöfe aus dem geplagten Haiti, aus Burkina Faso, aus Tonga, Myanmar oder von den Kapverdischen Inseln zum Zug.[10] Die Ränder rückten näher zum Zentrum.
2016: Die Gegner formieren sich inner- und außerhalb der Mauern des Vatikans
Warum Franziskus seinen Nachtisch nie allein aß
»Hoffentlich lebt Franziskus lange genug.« Diesen Satz hörte man von um das Leben des Papstes besorgten einfachen Menschen immer wieder. Denn der Papst hatte Feinde, die ihn so hassten, dass sie auch vor seiner Ermordung nicht zurückschrecken würden. Vor allem für die fundamentalistischen Islamisten bedeutete Franziskus eine große Bedrohung, weil er sich nicht als Feindbild des »Kreuzritters des christlichen Abendlandes« eignete, sondern sich im Gegenteil glaubhaft für die Versöhnung zwischen den Religionen einsetzte.[11]
Ein gelungenes Attentat auf Franziskus würde den Islamisten Auftrieb geben und das Christentum seiner charismatischen Symbolfigur berauben. Vor allem aber würde es den Herrschaftsanspruch jener islamistischen Terrorgruppe, die sich diese Tat auf ihre Fahnen heften konnte, über die anderen stärken. Wer je die laxen italienischen Sicherheitskontrollen vor den wöchentlichen Generalaudienzen von Franziskus erlebt hatte, der konnte nur hoffen, dass Gott ein wachsameres Auge auf seinen Stellvertreter auf Erden warf.
Doch auch innerhalb der Mauern des Vatikans hatte Franziskus gefährliche Feinde. Es sind bekanntlich nicht die großen bellenden Hunde, die beißen, sondern die kleinen, ängstlichen. Viele Mitglieder der Kurie fürchteten um ihren Lebenskomfort und ihre Karriere. Deren Abneigung gegen Franziskus zeigte sich oft in kleinen Bosheiten. Ein Journalist war Zeuge, wie ein hochrangiger Kurienvertreter einer Delegation von Religionsvertretern erklärte, dass Franziskus zwar gegen die Armut rede, aber leider über keinerlei Programm verfüge. Franziskus sei zweifellos ein spiritueller Mensch, aber völlig unpolitisch. Am Ende dieses seltsamen Empfangs verteilte der untreue Diener seines Herrn dann ungeniert kleine Bilder von Franziskus’ Vorgänger Benedikt XVI. als Erinnerung an die Delegationsmitglieder, die kopfschüttelnd weggingen.
Andere glaubten tatsächlich, dass Franziskus der katholischen Kirche ihre wesentlichen Prinzipien rauben und sie protestantisch machen wollte. Die Gruppe der Gegner war zwar unter den Gläubigen eine Minderheit, saß aber an vielen Schlüsselpositionen und lauerte auf den entscheidenden Augenblick, Franziskus nachhaltig zu beschädigen.
So summierte sich die Zahl jener, die schlicht auf das Ende seines Pontifikats hofften. Im Geheimen bereiteten sie schon seine Nachfolge vor, um, wie sie glaubten, die Kirche vor dem Untergang zu retten. Böse Zungen behaupteten, dass Franziskus schon wusste, warum er seine Mahlzeiten immer gemeinsam mit vielen Mitarbeitern in der Mensa einnahm. Es würde doch mehr Aufsehen erregen, wenn 50 Menschen nach einer Mahlzeit schwer erkrankten als nur einer.
Albträume und Kardinalspaläste
Franziskus hatte bei seinen wenigen Besuchen vor seiner Wahl in Rom immer mit Abscheu beobachtet, wie privilegiert und abgeschottet von der Wirklichkeit die meisten Mitglieder der Kurie lebten. Sie fühlten sich als elitäre Spitzenbeamte, die im Zentrum der Welt das Wohl der Kirche oder das, was sie dafür hielten, verwalteten. Wenn man einen von ihnen fragte: »Wie leben Sie eigentlich?«, würde es wohl nur ganz wenige geben, die einen in ihre Wohnung einluden. Nein, sie würden nur antworten, dass sie in einem kleinen Appartement im Vatikan lebten. Sie ließen nur ihre engsten Freunde in ihre vier Wände, aus Angst davor, dass man ihren Lebensstil kritisieren könnte.
Für viele Kurienkardinäle war Franziskus ein Albtraum, von dem sie täglich zu erwachen hofften. Für ihn dagegen war es ein Albtraum, wie einige von ihnen lebten. Er erinnerte sich, als er bei einem seiner seltenen Spaziergänge in der Nähe von Santa Marta die gewaltige Baustelle im prachtvollen Palazzo San Carlo entdeckte. Es bedurfte des Einsatzes seiner gesamten Autorität, bis man ihm gestand, dass dies der Alterssitz des entlassenen Kardinalstaatssekretärs werden würde. Dafür legte man eigens die Wohnungen von zwei verstorbenen Würdenträgern zusammen. Damit wurde eine Wohnfläche von 700 Quadratmetern für den einstmals mächtigsten Mann im Vatikan und die drei Nonnen, die seinen Haushalt führten, geschaffen. Als die Geschichte ohne Franziskus’ Zutun kurz darauf in die Medien kam, folgten peinliche Dementis, die die öffentliche Empörung noch verstärkten.[12]
Nur seine große Beliebtheit weit über den Kreis der gläubigen Katholiken hinaus hatte ihn bisher vor den Angriffen dieser Nomenklatur geschützt, die um ihre Privilegien fürchtete. Zu seinen öffentlichen Generalaudienzen auf dem Petersplatz jeden Mittwoch strömten regelmäßig bis zu 70.000 Menschen. Unter Benedikt XVI. waren es selten mehr als 10.000. Immerhin war es Franziskus gelungen, dass die meisten Katholiken den Papst wieder als ihre höchste moralische Autorität anerkannten. Während der Zeit seines Vorgängers Benedikt XVI. hatte eine Mehrzahl der Katholiken im Dalai Lama und nicht im Papst die wichtigste geistliche Führungspersönlichkeit gesehen, was Benedikt sehr gekränkt hatte. Doch würde es in Zukunft ausreichen, sich auf symbolische Gesten und sein persönliches Charisma zu beschränken?
Seit Franziskus selbst in Rom lebte, fragte er sich immer, woher die Angst seiner höchsten Würdenträger kam. Bei manchen hegte er den Verdacht, dass sie einfach kein Vertrauen in Gott hatten oder noch schlimmer, dass sie in Wahrheit nicht an Jesus glaubten. Ihre größte Angst bestand darin, dass jemand in ihr Innerstes schaute und erkannte, dass da nur Leere war. Sie hingen an ihren Ämtern, Ritualen und Kleidern, weil sie sonst nichts hatten, was sie erfüllte. Eitelkeit war ein gutes Füllmaterial für geistige Hohlräume. Franziskus scheute sich nicht, diese Themen öffentlich anzusprechen. Er konfrontierte die Kleriker mit sich selbst.
Die Friedhöfe sind voll von Kardinälen, die sich für unersetzbar hielten
Nur wenige Eingeweihte wussten, dass Franziskus aus seiner Zeit in Buenos Aires die Praxis übernommen hatte, vor wichtigen Predigten E-Mails mit präzisen Fragen an ihm vertraute Personen zu schicken. Diese warteten immer gespannt, ob und welche Antworten sich dann in den offiziellen Reden wiederfanden. Das Donnerwetter, das bei der Weihnachtsansprache von Franziskus am 22. Dezember 2014 im Clementina-Saal über die Kurie hereinbrach, war also kein spontaner Ausbruch, sondern wohl vorbereitet.[13] Zeitzeugen berichteten, welchen Schock seine Worte bei einigen Kardinälen und Bischöfen auslösten, die wie unter körperlichen Schlägen immer wieder zusammenzuckten. Ihr oberster Vorgesetzter diagnostizierte geistige Alzheimer, weil sie vergessen hatten, wem sie zu dienen hatten, nämlich Gott und den Menschen und nicht ihrer Karriere. Eitelkeit und Machtstreben wucherten wie Krebsgeschwüre in dem abgeschlossenen Kreis der Kurie, während es an Selbstkritik mangelte. Die Botschaft war ganz klar: Wer nicht bereit war, seine Geisteshaltung zu überprüfen und auch zu ändern, werde bald zur Seite treten müssen. Die Atmosphäre war alles andere als vorweihnachtlich. Ohne jeden Zweifel handelte es sich um die schonungsloseste öffentliche Abrechnung eines Papstes mit seinen eigenen Mitarbeitern, wie sie in der Geschichte bis dahin noch nie vorgekommen war. Gar nicht so wenige fragten sich, ob sie bei der Weihnachtsfeier in einem Jahr überhaupt noch dabei sein würden.