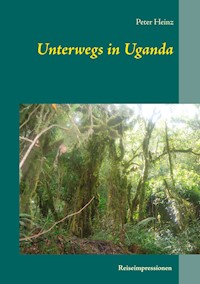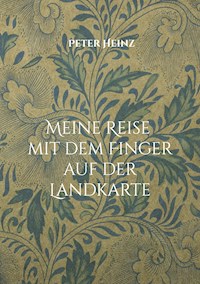
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
In einem Antiquariat in Trier stieß ich auf eine alte afrikanische Landkarte, die mein Interesse weckte. Da ich gelegentlich zu spontan Käufen neige, befand sie sich schon bald bei mir zuhause, und ich begann mich damit zu beschäftigen. Daraus resultiert nun dieses kleine Büchlein und viele spannende und interessante Monate, die ich mit einer Reise
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 212
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Jodocus Hondius, frühe Jahre in den Niederlanden
Exkurs: Der Achtzigjährige Krieg
Jodocus Hondius in London bei Richard Hakluyt
Kleine Abschweifung zum Magnetberg
Jodocus Hondius in London bei Eduard Wright
Die Erfindung des Geert de Cremer (kleine, aber bahnbrechende Exkursion)
Jodocus Hondius in London: Eduard Wright Teil 2
Jodocus Hondius in Amsterdam
Die Reise zu den Quellen der Karte
Leo Africanus
Philippo Pigafetta und Duarte Lopez
Kurzer Umweg zu Magellan und der ersten Weltumsegelung
Giovan Battista Ramusio
De Barros
Jan Huyghen Van Linschoten
Nun aber wirklich mit dem Finger auf der Afrika Karte
Teil 2 des Buches Afrikanische Karten und Entdeckungen
Erste Karten von Afrika von Afrikanern
Frühe Karten
Arabischer Einfluss auf Afrikas Landkarten
Einfluss der Chinesen auf Afrikas Landkarten
Der mittelalterliche Blick auf Afrika
Portolankarten
Die Kartierung Afrikas in der frühen europäischen Renaissance anhand Fra Mauros Weltkarte
Beginn der europäischen Erkundung Afrikas
Die portugiesischen Entdeckungsreisen
Die Portugiesen in Afrika
Die Ankunft anderer Europäer
Teil 3 des Buches Weltkarten und Landkarten Afrikas im Laufe der Zeit
Ptolemäische Karten: Die frühesten gedruckten Karten von Afrika
Signifikante Weltkarten, die den Kontinent Afrika zeigen
Henricus Martellus, Manuscript World Map, C.1489-1492
Francesco Rosselli, Printed World Map, Florence, C.1492-1493
Martin Behaim, Manuscript Terrestrial Globe 1492
Juan de la Cosa, Manuscript Planisphere, 1500
Alberto Cantino, Manuscript Planisphere, 1502
Nicolo de Caveri, Manuscript Planisphere, C. 1504-1505
Giovanni Contarini-Francesco Rosselli, Printed World Map, Venice or Florence. 1506
Martin Waldseemüller, Printed World Map, Strasbourg 1507
Übersicht der gedruckten Karten von Afrika von 1505 bis 1700
Afrikanische Kartographie vom anonymen Holzschnitt um 1505 bis zu Sebastian Münster 1540
Die wegweisenden Karten von Gastaldi und Ortelius
Das sich entwickelnde Verständnis von Afrika und die Mercator-Karte
Die Dominanz der Holländer und das Blaeu-Modell
Der wissenschaftliche Blick auf Afrika, beginnend mit der Karte von Nicolas Sanson 1650
Die Entwicklung der Kartierung Afrikas: Der Einfluss von Jaillot und Duval
Delisle-Modell von 1700
Gedanken zum Schluss
Anhang
Beschreibung der Jodocus Hondius Karte von 1606 in Mapping of Africa, Richard L. Betz 2007: 208-210 in deutscher Übersetzung
Lateinische Beschreibungen und Sätze auf der Hondius Afrika Karte
Einige wichtige Ortsnamen auf alten Afrika Karten
Zeittafel der afrikanischen Entdeckungen und wichtiger Afrika Karten Veröffentlichungen
Endnoten
Literatur
Web Links
Bilder
Prolog
Den Spruch „mit dem Finger auf der Landkarte“ hörte ich zunächst als Kind von meinem Vater.
Ein gern gebrauchter Begriff von Menschen die sich weite Reisen, eigentlich Urlaubsreisen im Allgemeinen, nicht leisten konnten.
Ich empfand diese Art des Reisens nie als Makel. Da meine weitesten Reisen in jungen Jahren die gelegentlichen, etwa zwanzig Kilometer weiten Busfahrten, zu Verwandten, in den vorderen Odenwald waren, kam die weite Welt in Form von Landkarten im Schulatlas und Reiseberichten in Büchern zu mir nach Hause und wurde von meiner Fantasie illustriert.
In der Grundschule, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, während andere Ereignisse der gleichen Zeit längst in den Fluten des Vergessens verschwunden sind, lernte ich anhand des erloschenen Vulkans Vogelsberg eine Landkarte zu lesen. Höhenlinien und Maßstab, Farbgebung und Legende wurden mir vertraut.
Das setzte sich im Gymnasium, oftmals im erschreckenden Ausmaße, fort. Denn während ich dem offiziellen Geografie Unterricht nur oberflächlich mit einem Ohr folgte, war ich in auf den Inseln der Karibik unterwegs. Ich besuchte San Francisco und Alaska, streifte durch die Inselwelt Indonesiens und verweilte gerne an einer meiner Lieblingsstellen, dem Caprivi Streifen im südlichen Afrika, dessen Name und Form es mir angetan hatten.
In meiner damaligen Unwissenheit nahm ich an, bei Caprivi handele es sich um einen exotischen Namen unbekannter Herkunft. Die so seltsam anmutende Form konnte ich mir zunächst auch nicht erklären. Das waren die eigentlichen Fragen, die mich beschäftigten, während vorne an der Tafel der Lehrer über Braunkohleabbau im Ruhrgebiet dozierte.
Kurzweilige Abwechslung brachte der Wettstreit des Städtesuchens mit Freund und Banknachbar Thilo.
Dazu nannte man eine möglichst versteckt, am besten weit außerhalb des Gesichtsfeldes, nahe der Falz des Atlanten oder in irgendeiner Ecke der Karte liegende Kleinstadt, deren schwarz geschriebener Name bestenfalls durch das tiefe Braun eines Gebirges oder hohen Berges leicht übersehbar war.
Trotzdem fanden wir jeden Ort der Welt in erstaunlichem Tempo.
Wer kennt beispielsweise schon Chaguaramas, das wir anfangs irrtümlich für einen kleinen Ort oder eine Kleinstadt hielten.
Gemeinhin ist damit das Gebiet westlich der St. Peters Bay bzw. der Tucker Valley Road gemeint. Und nachdem Chaguaramas dank Landkarte und unserem Suchspiel im Bewusstsein aufgetaucht war, wurde der Begriff immer lebendiger und mit Wissen gefüllt.
Wir gründeten sogar eine eigene Fußball-Liga, die aus den „mit dem Finger auf der Landkarte“ Expeditionen gefundenen und für gut befundenen Orten und Städten bestand.
Die Spieltage der Liga wurden jeweils in den Geografiestunden abgehalten und erfreuten sich wachsender Begeisterung. Ob Richard, „Maluk“, „Lupo“, oder Thilo, und all die anderen, wir waren mit größter Begeisterung bei der Sache.
Das unsere Wissenserweiterung über Bergbau an der Ruhr oder andere weitgehend periphere Lerninhalte darunter litten, störte uns wenig.
Wären wir über die Lage von Orten dieser Welt am Ende des Schuljahres geprüft worden, zumindest Thilo und ich wären mit glatten Einsern in die Ferien gegangen. Aufgrund unseres nur oberflächlichen Wissens über den Kohleabbau im Ruhrgebiet reichte es allerdings nur zu einer eher mittelmäßigen Note.
Ich bin abgeschweift.
Aber diese kleine Exkursion zurück ins Klassenzimmer und auf die harte Holzschulbank, die in der Weichzeichnung der Erinnerung manche schöne Anekdote bereit hält, sei einem alten Mann verziehen, der ob der Erinnerung schmunzelt, zum Fenster hinaus schaut und mit einem Earl Grey Tee in der Hand, auf den Nebel eines raureif-kalten Januarmorgens blickend, in eine längst vergangene Jugendzeit reist und versucht diesen Moment auf der Schulbank festzuhalten, den er gerade aus dem Vergessen geholt hat, in ihm zu schwelgen und diesen Zustand ausgiebig zu genießen.
Vielleicht versteht aber auch der Leser meine Affinität und meine Begeisterung für Landkarten, dadurch etwas besser.
Um es einmal ganz kurz in einem Satz zu formulieren:
Ich bin schon immer mit Begeisterung „mit dem Finger auf der Landkarte“ gereist und ohne Landkarten würde mir etwas fehlen.
Als ich dann irgendwann später mit beiden Füßen mitten im Caprivi Streifen stand, war es fast als wäre ich nach Hause gekommen So gut kannten wir uns schon, der Caprivi und ich.
Aus meinem „Fantasie Caprivi“, den ich zwar aufgrund meiner physischen Anwesenheit im Zielgebiet verlor, gewann ich die Realität dazu, die durch eine bisher fehlende visuelle und olfaktorische Wahrnehmung bereichert wurde.
Ich liebe es zu Reisen.
Neben der typischen Reise mit Flugzeug, Auto, Fahrrad, Schiff oder anderen Fortbewegungsmitteln stehen mir durch meine Erfahrungen mit den Landkarten, ebenso wie durch das Versinken in Büchern, die Bilder im Kopf entstehen lassen, sogar mehrere Möglichkeiten des Reisens zur Verfügung.
Ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die abschätzig auf den „mit dem Finger auf der Landkarte Reisenden“ blicken.
Ich habe allerdings gerade auch diese Form des „in der Welt unterwegs Seins“ zu schätzen gelernt. Ein gewissenhafter Landkartenreisender wird besonders heutzutage mit dem immer zur Verfügung stehendem Wissens des Internets, manchmal näher und intensiver einen Ort bereisen, als mancher körperlich am Reiseziel anwesender Urlauber, der unter Umständen, außer schnell durchgereist zu sein, keine weiteren Erfahrungen, Eindrücke und weiteres Wissen sammeln konnte.
Von jedem neuen Land, das ich nach meiner Schulzeit in späteren Jahren besucht habe oder das ich noch besuchen will, habe ich selbstredend Landkarten in Papierform.
Digitale Landkarten garantieren nicht annähernd dasselbe Vergnügen das eine Landkarte in Papierform mir bietet.
Die Königinnen der Landkarten, mit denen man am weitesten und intensivsten reisen kann, habe ich aber noch gar nicht angesprochen, obwohl diese doch das Thema des weiteren Manuskripts sein werden.
Vor ein paar Tagen kam über ein Antiquariat in Trier eine Reise in Form einer Landkarte zu mir nach Hause, die ich gerade erst angetreten habe und die mich noch lange in Atem halten wird. Von den Vergnügen der Entdeckungen, die auf mich zukommen, ganz zu schweigen.
„NOVA AFRICAE TABULA AUCTORE Jodoco Hondio“ steht auf dem guten Stück.
Mein alter Lateinlehrer, Herr Sille, hätte nun seine wahre Freude daran, mir zu zulächeln und seine Bestätigung zu finden, dass mir spätestens jetzt (wäre es nicht schon seit Beginn meiner naturwissenschaftlichen Ausbildung passiert) ein Licht aufginge und sich bewahrheiten würde, was er mir immer wieder nach einer schlechten Lateinarbeit, nach der ich in Selbstzweifel ob der Wahl dieses Schulfaches verfiel, mit auf den Weg gab: Ich wäre noch froh, Latein als erste Fremdsprache gewählt zu haben.
Die Kupferstichkarte von Jodocus Hondius oder Jodoco Hondio oder eigentlich Josse de Hondt, ihn lernen wir gleich näher kennen, ist 37,5 cm x 50 cm groß, altkoloriert und stammt aus dem Amsterdam des Jahres 1606 und schaut somit auf eine über 400 Jahre alte Existenz zurück.
Allein der Gedanke an dieses Alter lässt mich nachdenklich werden.
Was hat diese Karte schon alles miterlebt, was alles überlebt. Wo und in wessen Besitz ist sie gewesen, welche Dramen und Schicksale spielten sich um ihre Besitzer ab.
Aber was will er mit einer so alten Karte, mag sich manch einer fragen, außer sie anzusehen?
Zu was ist sie nutze?
Ich will, natürlich, reisen und diese Landkarte hilft mir zu reisen.
Nicht nur nach Afrika, nein, auch zurück in der Zeit und zurück zu dem, was ich noch so alles auf meiner Reise entdecken werde, deren Verlauf und Ende zum jetzigen Zeitpunkt noch völlig offen ist Der Leser dieser Zeilen ist nun herzlichst eingeladen, mich bei dieser Reise zu begleiten. Es wird eine Reise, von der ich im Moment da ich diese Zeilen schreibe, noch gar nicht weiß, wohin sie uns führen wird.
Beginnen wir erst einmal mit dem Mann, der diese Karte hergestellt hat: Jodocus Hondius.
Jodocus Hondius, frühe Jahre in den Niederlanden
Jodocus Hondius alias Josse de Hondt, wurde am 17. Oktober 1563 in dem Ort Wakken in Flandern geboren.
In seinem Geburtsjahr begann der Erste Hugenottenkrieg und zeitgleich, als würde ein Krieg nicht ausreichen, der Dreikronenkrieg. Der äthiopische Herrscher Minas stirbt und sein Sohn Sarsa Dengel wird zum Negus negest von Äthiopien gekrönt, was ich nur erwähne, um einen ersten kleinen Bezug auf Afrika zu kreieren.
Zu guter Letzt, in einer längeren Reihe anderer Ereignisse, die sein Geburtsjahr 1563 charakterisieren, beginnt auch der Bau von El Escorial bei Madrid, dem größte Renaissancebau der Welt, der seit 1984 ein Teil des Weltkulturerbe ist.
Jodocus blieb nicht lange in seinem Geburtsort, einem kleinen Dorf in Flandern.
Zusammen mit seinem Vater Olivier de Hondt und seiner Mutter Petronella d'Havertuyn zieht Josse schon im ungefähren Alter von zwei Jahren nach Gent, wo er an der lateinischen Schule eine sehr umfassende Ausbildung in Mathematik und den klassischen Sprachen bekommt. Bereits in jungen Jahren etabliert sich der Autodidakt als Graveur, Instrumentenbauer und Künstler.
Als Kupferstecher erlernte er einen Beruf, der bis Mitte des 19 Jahrhunderts sehr gefragt war, um danach von der Lithographie abgelöst zu werden.
Kupferstecher waren sowohl Handwerker als auch Künstler, wie beispielsweise die berühmten Kupferstecher Albrecht Dürer oder Lucas Cranach.
Im Jahr 1584 ging er, wie viele andere Niederländer auch, nachdem Gent in die Hände des Königs von Spanien gefallen war, nach London. Es waren sehr unruhige Zeiten in den Niederlanden jener Zeit, zu denen damals noch das heutige Belgien und damit Flandern gehörte. Durch seine Flucht vor den religiösen Verwerfungen im Rahmen des Freiheitskampfes der Niederlande hängt sein Werdegang unmittelbar mit diesem Krieg zusammen. Deshalb wenden wir uns ihm nun etwas ausführlicher zu. 1
Exkurs: Der Achtzigjährigen Krieg
Etwa Mitte des 16 Jahrhunderts, bedingt durch die Reformation, verbreitete sich in den Niederlanden der Calvinismus und mit ihm keimte der Wunsch sich vom katholischen Spanien zu lösen.
Zu jener Zeit waren die Häfen der Niederlande, Antwerpen und Rotterdam, wichtige Umschlagplätze für Waren aus Übersee, speziell für die neuen Kolonien in Südamerika.
Zudem war Antwerpen ein Zentrum des europäischen Kapitalhandels.
Vor allem aus diesen Gründen, aber auch aufgrund der hervorragenden strategischen Lage des Landes, waren die spanischen Habsburger nicht bereit, die Niederlande aus ihrem Besitz zu entlassen.
Als 1555 Philipp II. die Herrschaft über die Niederlande von seinem Vater Karl V. übernahm, führte er die bereits unter seinem Vater begonnene Inquisition konsequent fort, obwohl bereits Unruhen während der Herrschaft seines Vaters entstanden waren 2.
1559 setzte er einige Änderungen der ständischen Freiheiten durch und ging 1560 zurück nach Spanien, nachdem er Margarethe von Parma als seine Statthalterin eingesetzt hatte. Ein Jahr später zog er auch seine Truppen ab.
Mitglieder des niederländischen Staatsrates unter der Führung von Wilhelm von Oranien sowie der Grafen von Hoorn und Egmond protestierten gegen diese Änderungen und erzwangen zunächst den Rücktritt des Bischofs Granvelles, den Philipp II. Margarethe von Parma zur Seite gestellt hatte.
Im sogenannten „Adelskompromiss von Breda“, einer Bittschrift, forderten die Aufständischen von Margarethe von Parma das Ende der Inquisition und der Verfolgung der Calvinisten, ebenso wie die Wiederherstellung ihrer ständischen Freiheiten die Philipp II. 1559 gekürzt hatte.
Der Protest der Geusen, wie sich die Aufständischen selbst nannten, erreichte im gleichen Jahr durch die Bilderstürme der Calvinisten einen ersten Höhepunkt.3 Als Konsequenz hob Philipp II. zwar die Inquisition auf, setzte aber 1567 den Herzog von Alba, Fernando Alvarez de Toledo, zum neuen Statthalter ein und entsandte mit ihm die spanischen Truppen zu einer Strafexpedition in die Niederlande.
Alba unterdrückte die regionalen Aufstände mithilfe eines Sondergerichts, dem sogenannten „Blutrat von Brüssel“, und ließ dabei mehr als 6000 Aufständische, darunter die Grafen von Hoorn und Egmond, hinrichten.
Im gleichen Jahr musste sich ihm auch das niederländische Heer unter Wilhelm von Oranien geschlagen geben.
Aufgrund der rücksichtslosen und willkürlichen Art Albas flammten aber neue Aufstände auf, die dieses Mal das ganze Land erfassten.
Mit der Schlacht von Heiligerlee begann1568 der Achtzigjährige Krieg, der mit der Ausnahme des Zwölfjährigen Waffenstillstands von 1609 bis 1621, bis in das Jahr 1648 anhielt.
Im Rahmen dieses Krieges gab es auch Kampfhandlungen in den spanischen Kolonien.
Niederländische Kaperfahrer, die Wassergeusen, deren größter Erfolg die Befreiung der Provinzen Zeeland und Holland im Jahr 1572 war, störten ab dem Jahre 1600 die Handelsrouten der Spanier in den Gewässern der Philippinen gewaltig. Bei einem ersten Aufeinandertreffen der Wassergeusen mit den Spaniern am 12 Dezember 1600 wurde die spanische „San Diego“ versenkt.
Als die Niederländer immer stärker wurden, versuchten sie im Jahr 1646 sogar das Archipel der Philippinen zu erobern. Der Versuch schlug allerdings fehl und wurde in den fünf Seeschlachten der „Naval de Manila“ abgewehrt. 4 Der Westfälische Friede, der sowohl den Achtzigjährigen Krieg sowie den Dreißigjährigen Krieg, beendete, brachte dann die internationale Anerkennung der Republik der Vereinigten Niederlande.
Johann Wolfgang von Goethe hat dem Grafen von Egmond, 220 Jahre nach dessen Enthauptung auf dem Marktplatz von Brüssel, mit seinem gleichnamigen Buch ein literarisches Denkmal gesetzt.
Auch Friedrich Schiller beschäftigte sich anhand einer Novelle mit dem Achtzigjährigen Krieg, ebenso wie Wilhelm Raabe, der den Kampf der Wassergeusen in seiner Novelle „Die schwarze Galeere“ beschreibt oder wie Charles de Coster den Aufstand der Geusen im „Ulenspiegel“ schildert.
Die Flucht von Jodocus Hondius nach London ist im zeitgenössischen Kontext begründet und ein folgerichtiger Schritt in seinem Leben.
Die Reise zu den Hintergründen meiner Landkarte ist damit einen Schritt weitergekommen und wir begleiten neugierig Jodocus Hondius weiter nach England.
Jodocus Hondius in London bei Richard Hakluyt
Von 1584 an ist London die neue Heimat von Jodocus Hondius.
Er arbeitet in London unter anderem zusammen mit dem Geografen und Schriftsteller Richard Hakluyt sowie mit Edward Wright, einem Mathematiker und Geografen zusammen.
Während Hondius Zeit in London besiegen die Engländer die spanische Armada 1588 und Richard Hakluyt heiratete 1590 eine Verwandte des Freibeuters und dritten Weltumseglers Thomas Cavendish.
Jodocus Hondius fertigte 1595, als er bereits wieder in Amstrdam war, eine Weltkarte an, die mit den Reiserouten der beiden englischen Weltumsegler Sir Francis Drake und Thomas Cavendish versehen war.
Auch die Gravur der bekannten, von E. Molyneux ab 1592 publizierten, Erd- und Himmelsgloben mit 62 cm Durchmesser führte Hondius aus.
Darüber hinaus fertigte Hondius verschiedene bekannte Porträts von Sir Francis Drake und war maßgeblich an der Veröffentlichung dessen Arbeit beteiligt. 5 Hakluyt, der in Oxford studiert hatte, führte als Professor der Kosmographie den Gebrauch der Globen im englischen Schulunterricht ein.
Das Hauptwerk Hakluyts „The principal navigations, voyages and discoveries of the English nation etc.“ erschien 1589 und wurde 1598 bis 1600 überarbeitet.
Dieses Buch enthielt Reiseberichte von Entdeckern und Kapitänen, von Gebieten, die für die englische Exportwirtschaft von Bedeutung sein konnten, aber auch viel Unbewiesenes wie die Beschreibung des Magnetberges in der Arktis.
Kleine Abschweifung zum Magnetberg
Ich kann es leider nicht lassen etwas vom Thema abzuschweifen, aber der Magnetberg ist meiner Meinung nach einen kleinen Abstecher wert.
Man nahm an.dass sich dieser Berg in der Arktis befinden sollte und dies wurde vor allem von Forschern im 16 Jahrhundert als vermeintliche Tatsache wissenschaftlich zu untermauern versucht.
Als Sagen oder Seemannsgarn erzählte man sich gar fantastische Geschichten um den Magnetberg. Er solle Schiffe an- oder die Eisennägel aus den Planken ziehen, so dass die Schiffsmannschaft dem Untergang in eisigen Wassern geweiht ist. Sindbad der Seefahrer erreicht in einer späteren Fassung der Märchen aus „Tausendundeiner Nacht“ den Magnetberg, der auch bei Jules Verne (Die Abenteuer des Kapitän Hatteras) auftaucht und zu guter Letzt auch bei Michael Endes „Jim Knopf und die wilde Dreizehn“ eine Rolle spielt.
Im 16 Jahrhundert war der Magnetberg die Bezeichnung für die Polarregion bzw. er wurde zumindest dort vermutet.
Auch der große Gerhard Mercator, mit dem wir uns noch ausführlicher beschäftigen werden, da er eine sehr wichtige Rolle auf der Reise zu meiner Afrika Karte spielt, beschreibt den Magnetberg 1577 in einem Brief an John Dee. 6
Genauere Informationen darüber erhalten wir vom Niederländer Johannes Ruysch (geb. 1460 in Utrecht gest. 1533 in Köln), dessen zweitälteste „Weltkarte der neuen Welt“ in gedruckter Form 1507 entstand. Darauf ist der Magnetberg als ein 33 deutsche Meilen großer Felsen unterhalb des Nordpols eingezeichnet. Um ihn herum befindet sich das Bernsteinmeer mit vier Inseln, von denen zwei bewohnt seien. Dies impliziert die Theorie vom eisfreien Nordpolarmeer, die von Hakluyt in seinem Buch wieder aufgegriffen wird.
Mit Hakluyts Buch glückte mir jetzt doch wieder der Bogen zurück zu Hakluyt und damit zu Jodocus Hondius und zu der Afrika Karte und wir kehren nach England zurück.
Jodocus Hondius in London bei Eduard Wright
Obwohl Richard Hakluyt bereits eine wichtige Person in Hondius Leben darstellt, so spielt doch Wright eine noch größere Rolle bei seinem Werdegang.
Bei Wright finden wir Grundlagen zu den Karten von Hondius, die ihr Erscheinungsbild stark beeinflusst haben.
Aber zunächst einige biographische Hinweise zu Eduard Wright.
Der Mathematiker und Kartograf wurde am 8.Oktober 1561 in Garveston getauft und verstarb im November 1615 in London.
Der aus einfachen Verhältnissen stammende Wright studierte an der Universität von Cambridge und war von 1587-1596 Fellow des Colleges Gonville and Caius.
Im Jahr 1589 wurde er beurlaubt, um im Auftrag von Königin Elisabeth I. Karten zu erstellen.
Zunächst im Zusammenhang mit einer Kaperfahrt des Earl of Cumberland zu den Azoren, die er 1599 in seinem Buch „Certaine Errors in Navigations“ veröffentlichte, in dem er die häufigsten Fehler erläuterte, die bei der Herstellung der Seekarten, dem Gebrauch des Jakobsstabs, des Kompasses und bei der Zusammenstellung von astronomischen Deklinationstabellen auftraten.
Allen, die Wrights Namen bei Cumberlands Kaperfahrt vermissen, sei gesagt, dass er sich auf dieser Fahrt Capitain Edwarde Carelesse nannte.
Schon im gleichen Jahr (1589) war er wieder zurück in Cambridge und wurde kurz danach in London ansässig. 7 Zusätzlich zu „Certaine Errors in Navigations“, das den Grundstein für die mathematischen Grundlagen der „Mercator- Projektion“ legte, veröffentlichte er zusammen mit dem Globenhersteller Emery Molyneux auch die erste englische Weltkarte in Richard Hakluyt „Principal Naviations“.
Diese Karte war auch die erste Karte nach Gerhard Mercator, die dessen „Mercator .Projektion“ benutzte.
Mercator selbst hatte die Details seiner Methode nie veröffentlicht.
Wright holte dies als detaillierte Tabelle nach, so das nachfolgende Kartografen auf einfache Weise eine solche Projektionskarte erstellen konnten.
In dieser Tabelle stand zu jeder jeweiligen geografischen Breite der zugehörige Abstand vom Äquator auf der Karte.
1610, in einer zweiten Auflage, erweiterte Wright diese Tabelle auf dreiundzwanzig Seiten mit Einträgen, die eine Bogenminute Breitendifferenz entsprachen.
Die Erfindung des Gerhard Mercator
Um die Bedeutung Mercators richtig zu würdigen, sollte man sich bewusst sein, dass die „Mercator-Projektion“ die Grundlage der Navigation ist, die man in jedem GPS Gerät findet und die bei der Satellitentechnik genutzt wird. 8 Seine Grundlagenarbeiten helfen Schiffen und Flugzeugen bis heute sicher zu navigieren.
Auch heute beruhen See-und Landkarten noch immer auf der von ihm erdachten Kartenprojektion. Jeder Schüler im Geografie Unterricht sitzt, wenn er einen Atlas aufschlägt, vor der Mercator – Projektion. Auch der Name „Atlas“, der nach Mercator für jede weitere Kartensammlung bis heute verwendet wird, stammt von ihm.
Auch deshalb muss ich auf diese neue bahnbrechende Technik der Kartenherstellung eingehen und damit wie bereits angekündigt zu Gerhard Mercator.
Mercator wurde 1512 in Rupelmonde in Flandern geboren, studierte in Löwen, und starb 1594 in Duisburg, wo er ab 1552 als Professor für Kosmografie lehrte.
Bereits zu seinen Lebzeiten wurde er als Ptolemäus seiner Zeit angesehen und sein Ruhm strahlte bis hinein in die arabisch islamische Welt.
Obwohl heute als Kartograf und Globenhersteller berühmt, war er auch Kosmograf, Theologe und Philosoph und in diesen Bereichen von großer Bedeutung im 16. Jahrhundert.
Seine erste Karte „Amplissima Terrae Sanctae descriptio ad utriusque Testamenti intelligentiam“ schuf er 1537, die erste Weltkarte 1538.
Es folgte 1539 eine Karte von Flandern. Seinen ersten Globus stellte er 1541 her.
Weltruhm erlangte Mercator mit seiner großen Weltkarte von 1569 (Nova et aucta orbis terrae descriptio ad usum navigantium), die bis heute aufgrund ihrer Winkeltreue für See- und Luftfahrt wichtige Projektion, die als Mercator Projektion bekannt wurde.
Die entscheidende Neuerung an seiner Art von Karten war, das die einzelnen Punkte der Erde vom Mittelpunkt eines Globus auf einen den Äquator berührenden Zylinder projiziert wurden.
Erst kurz vor seinem Tod beendete Mercator die Kosmografie „Atlas, sive Cosmograpgicae Meditationes de Fabrica Mundi et fabricati figura“, sein Hauptwerk, das posthum 1595 veröffentlicht wurde (bei der aber aufgrund seines Todes einige Länderkarten fehlten).
Dieser Atlas landete sowohl per Dekret der römischen-katholischen Kirche vom 7.8.1603 auf dem Index librorum prohibitorum (Verzeichnis der verbotenen Bücher), als auch in Form der Druckplatten in den Händen von Jodocus Hondius.
Zweiteres erst etwas später wie wir aber bald sehen werden.
Jodocus Hondius in London: Eduard Wright Teil2
Wir reisen wieder zurück zu Wright und nach London.
Wie wir bereits wissen hatte Wright zusammen mit Emery Molyneux in Richard Hakluyt „Principal Naviations“ die erste englische Weltkarte nach dem Mercator Projektion veröffentlicht.
Alle diese bisher erwähnen Personen wie Richard Hakluyt, Eduard Wright und der Globenhersteller Emery Molyneux, der Francis Drake auf seiner Weltumseglung begleitet hatte und der, zwar noch ungesichert, aber sehr wahrscheinlich, auch Thomas Cavendish, den dritten Weltumsegler 1587/88 begleitet hatte, hatten Kontakt und waren bekannt mit Jodocus Hondius.
Und da Hakluyt mit einer Verwandten von Cavendish verheiratet war, liegt der Schluss nahe, das auch er mit Hondius bekannt war und sich damit der Kreis dieser berühmten Gesellschaft schließt, die in London in der einen oder anderen Form miteinander gearbeitet hat.
Dazu zählt auch der berühmte Sir Francis Drake, den Hondius, wie bereits erwähnt, mehrmals porträtiert hatte und dessen und Thomas Cavendish´s Route ihrer Weltumsegelungen er auf seiner Weltkarte von 1595 eingestochen hatte. Darüber hinaus gab es etliche weitere Arbeiten, die Hondius und Drake zusammen ausführten. 9 Ein bis heute widersprüchlicher, nicht gesicherten Sachverhalt liegt auf der Zusammenarbeit von Wright und Hondius, der bis heute nicht endgültig geklärt ist.
Dabei geht es um das Handbuch mit den von Wright angefertigten Tabellen.
Verschiedene Teile seines Handbuchs wurden ohne seine Erlaubnis verwendet und nachgedruckt.
Einer, der das Verfahren von Wright nutzte, war auch Jodocus Hondius, der sich angeblich ein Manuskript von ihm ausgeliehen und versprochen hatte, gerade dieses nicht zu tun.
Bewiesen ist diese Aussage nicht, es gibt auch Quellen die das anzweifeln. Das dieses Handbuch allerdings von größtem Nutzen für seine Landkarten war, steht außer Zweifel.
Shakespeare setzte der Karte von Wright, die die Vorarbeiten Mercators auf eine mathematische Grundlage stellte, ein Denkmal.
In „Was ihr wollt“ amüsiert sich die Kammerzofe Maria über den Haushofmeister Malvolio
„ He does smile his face into more lines than is in the new map with the augmentation of the indies“ 10
Die von ihr erwähnte „Vergrößerung“ Indiens hing einerseits mit der Projektionsform und andererseits der Verkleinerung Europas zusammen. Offentsichtlich und das ist das eigentlich Bemerkenswerte an dieser Metapher, hatten sich die ptolemäischen Karten zuvor rasch in den Köpfen Shakespeare und seiner Zeitgenossen verankert, sodass ihnen der Wandel durch Mercator auffiel. Es muss ihnen so ergangen sein wie vielen Deutschen, als die Tagesschau Ende der 1980er Jahre ihre auf Mercator basierende Weltkarte ersetzte.11
Jodocus Hondius in Amsterdam
Hondius verließ 1593 London und ging nach Amsterdam, wo er sich darauf spezialisierte Globen und Karten herzustellen.
Sehr wahrscheinlich begleitete ihn sein Schwager Petrus Kaerius, dessen Schwester Colette er in England geheiratet hatte und mit dem er zuvor auch nach England geflohen war.12
Er bezog ein Haus in der Kalverstraat und nannte sein Geschäft „ de wackere Hondt (der wachsame Hund). Dieser Name ist sowohl eine Anspielung auf seinen Geburtsort Wakken und seinen Nachnamen Hondt als auch ein Wortspiel, das auch „der Hund aus Wakken“ bedeuten kann.13
Mit dem Globenbau hatte er bereits um 1590 in London begonnen und wurde zurück in Amsterdam zum Konkurrenten des niederländischen Globenherstellers Willem Janszoon Blaeu (15711638)