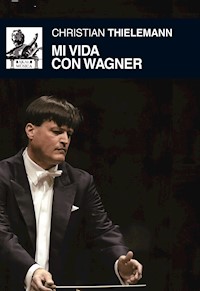16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
«Für mich ist die Beschäftigung mit Beethoven mehr als die Aufgabe, geniale Noten zum Leben zu erwecken (was schon nicht wenig wäre): Sie ist eine Existenzweise, ein Credo. Davon möchte ich in diesem Buch erzählen.» Ludwig van Beethoven hat Christian Thielemann auf seinem musikalischen Lebensweg geprägt wie kaum ein anderer Komponist. In seinem Buch führt der berühmte Dirigent durch das Universum von Beethovens Musik und schildert, warum es ein ganzes Leben braucht, um ihr gerecht zu werden.
Beethoven hat in seiner Musik den ganzen Kosmos der Kunst und des Lebens durchmessen: zarteste Unschuld und wildes Wühlen, frenetischen Jubel und tiefste Trauer. Darin liegt für Christian Thielemann das von Grund auf Menschliche dieser Musik und der Kern ihrer immer neuen Faszination. In diesem Buch erklärt er, was die unübertroffene Größe von Beethovens Symphonien ausmacht, wieso dem Komponisten bei der Oper kein Glück beschieden war und warum die Missa solemnis sein Beethovensches Herzensstück ist. Vom Violinkonzert, das als Krone der Schöpfung gilt, und von den Klavierkonzerten ist die Rede, aber natürlich auch von den Klaviersonaten und Streichquartetten. Christian Thielemann denkt über das ewige Streitthema des «deutschen Klangs» nach, über gutes und schlechtes Pathos und über den Skeptiker Beethoven. Berühmte Beethoven-Interpreten haben ihren Auftritt, und zugleich vermittelt Thielemann, welche ungeheuren Schwierigkeiten sich bei dem Komponisten für jeden Dirigenten stellen. Dies ist das Buch eines Künstlers, der wie wenige andere in Beethovens Werkstatt geschaut hat und den Spuren seines Genies nachgegangen ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Christian Thielemann
Meine Reise zu Beethoven
Unter Mitwirkung vonChristine Lemke-Matwey
C.H.Beck
Zum Buch
«Für mich ist die Beschäftigung mit Beethoven mehr als die Aufgabe, geniale Noten zum Leben zu erwecken (was schon nicht wenig wäre): Sie ist eine Existenzweise, ein Credo. Davon möchte ich in diesem Buch erzählen.»
Ludwig van Beethoven hat Christian Thielemann auf seinem musikalischen Lebensweg geprägt wie kaum ein anderer Komponist. In seinem Buch führt der berühmte Dirigent durch das Universum von Beethovens Musik und schildert, warum es ein ganzes Leben braucht, um ihr gerecht zu werden.
Beethoven hat in seiner Musik den ganzen Kosmos der Kunst und des Lebens durchmessen: zarteste Unschuld und wildes Wühlen, frenetischen Jubel und tiefste Trauer. Darin liegt für Christian Thielemann das von Grund auf Menschliche dieser Musik und der Kern ihrer immer neuen Faszination. In diesem Buch erklärt er, was die unübertroffene Größe von Beethovens Symphonien ausmacht, wieso dem Komponisten bei der Oper kein Glück beschieden war und warum die Missa solemnis sein Beethovensches Herzensstück ist. Vom Violinkonzert, das als Krone der Schöpfung gilt, und von den Klavierkonzerten ist die Rede, aber natürlich auch von den Klaviersonaten und Streichquartetten. Christian Thielemann denkt über das ewige Streitthema des «deutschen Klangs» nach, über gutes und schlechtes Pathos und über den Skeptiker Beethoven. Berühmte Beethoven-Interpreten haben ihren Auftritt, und zugleich vermittelt Thielemann, welche ungeheuren Schwierigkeiten sich bei dem Komponisten für jeden Dirigenten stellen. Dies ist das Buch eines Künstlers, der wie wenige andere in Beethovens Werkstatt geschaut hat und den Spuren seines Genies nachgegangen ist.
«Es gibt unzählige Interpretationen dieser Symphonien, aber Thielemanns überragt alle anderen.»
Die Presse
Über den Autor
Christian Thielemann wurde 1959 in Berlin geboren. 1988 wurde er in Nürnberg Deutschlands jüngster Generalmusikdirektor. Von 1997 bis 2004 war er Generalmusikdirektor der Deutschen Oper Berlin, von 2004 bis 2011 leitete er die Münchner Philharmoniker. Seit 2012 ist er Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle Dresden und übernahm 2013 zudem die Künstlerische Leitung der Osterfestspiele Salzburg. 2015 wurde er Musikdirektor der Bayreuther Festspiele. Mit den Wiener und den Berliner Philharmonikern verbindet ihn schon lange eine regelmäßige Zusammenarbeit. Bei C.H.Beck erschien 2012 sein Buch Mein Leben mit Wagner (32013, Paperback 2016).
Inhalt
Vorwort
1: In die Todeszone und immer wieder zurück – Mit Beethoven leben
2: Ein Septakkord, viel Theaterlärm und ein zweifelhafter Triumph – Die Symphonien 1 bis 3
Alle Neune: Der Zyklus
Tempofragen, Satzbezeichnungen, Spielanweisungen
Der erste Abend
Symphonie Nr. 1 C-Dur Opus 21
Symphonie Nr. 2 D-Dur Opus 36
Symphonie Nr. 3 Es-Dur Opus 55 (Eroica)
Die Ohren und der Wein
3: Heiter bis heroisch – Beethovens Universum
Menschliches, Allzumenschliches
Klassiker oder Romantiker?
Dirigieren heißt: Neue Wege finden
Schubert zum Beispiel
Das Genie
Singspiel und Utopie: Fidelio
4: Ein Anfang in Moll und ein hymnischer Welt-Ohrwurm – Die Symphonien 4 und 5
Der zweite Abend
Symphonie Nr. 4 B-Dur Opus 60
Wien
Das Violinkonzert
Beethovens politischer Nimbus
Symphonie Nr. 5 c-Moll Opus 67
5: Helles im Dunkeln – Der deutsche Klang
6: Ein episches Maiengrün und entfesselte Energien – Die Symphonien 6 und 7
Der dritte Abend
Symphonie Nr. 6 F-Dur Opus 68 (Pastorale)
Nochmal: Taubheit
Streichquartette und Klaviersonaten
Die Klavierkonzerte
Symphonie Nr. 7 A-Dur Opus 92
7: Eine gnadenlose Aufgabe – Beethoven aufführen
Räume
Der Dialog mit dem Orchester
Ausgaben
Die technische Seite
Der Funke des Augenblicks
Historisch informiert
Eine Frage des Geschmacks
Atmosphäre
Metronomzahlen
Konzertprogramme
So viele Aufnahmen
8: Ein Kurzresümee des Lebens und Zukunftsmusik – Die Symphonien 8 und 9. Und die Missa solemnis
Der vierte Abend
Symphonie Nr. 8 F-Dur Opus 93
Symphonie Nr. 9 d-Moll Opus 125
Missa solemnis D-Dur Opus 123
9: «Von Herzen – Möge es wieder – zu Herzen gehen» – Schluss
Dank
Anhang
Bildnachweis
Personenregister
LvB
Vorwort
Meine Reise zu Beethoven beginnt mit Herbert von Karajan und den Berliner Philharmonikern. Mit ihrem hellen, fast apollinischen Orchesterklang bin ich aufgewachsen. Später kam für mich die Dirigentengeneration vor Karajan dazu – dunkleres Timbre, flexiblere Tempi –, und ich ahnte: Mit Beethoven bist du nicht schnell fertig. So war es auch, so ist es bis heute. Je besser man sein Werk kennt, desto höher schießen die Fragen in den Himmel.
Meine Reise zu Beethoven ist eine Lebensreise, obwohl es natürlich Phasen gibt, in denen ich kaum Beethoven dirigiere, weil andere Projekte im Vordergrund stehen. Trotzdem bleibt er immer präsent. Auch wenn ich an Bach oder Mozart arbeite, an Wagner, Schumann, Bruckner oder Mahler, kreisen meine Gedanken viel um ihn. Auf Beethoven, denke ich, zielt alles hin, von Beethoven geht alles aus. Und jeder wählt seine eigene Reiseroute: Die Geigerin oder der Pianist hat eine andere als der Musikwissenschaftler, die Streichquartett-Spieler eine andere als die Sänger, das Publikum oder die Presse. Meine Route als Dirigent führt hauptsächlich über die Symphonien, die Ouvertüren und Konzerte.
Ein Leben ohne Beethoven kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Sein 250. Geburtstag bietet mir die Gelegenheit, meiner Beziehung zu ihm ausführlicher auf den Grund zu gehen. Was fasziniert mich (immer wieder) am Gang durch die neun Symphonien, warum scheue ich mich bislang vor seiner einzigen Oper Fidelio, und was lernt man als Dirigent von den 32 Klaviersonaten?
Interessanterweise ist die deutsche Musik gern Gegenstand widerstrebender Betrachtungen. Dann heißt es, sie sei schwerblütig, (zu) kompliziert, nicht heiter und nicht leicht genug. Sind solche plakativen Begriffe vielleicht auch eine Folge der politischen Vergangenheit? Ein Jascha Heifetz, ein Artur Rubinstein, ein Vladimir Horowitz, Wilhelm Kempff, Edwin Fischer oder der unvergleichliche Wilhelm Furtwängler hätten solche Assoziationen weit von sich gewiesen. Von Zeit zu Zeit kulminiert das Ganze in der Debatte um den sogenannten deutschen Klang, der mich seit Langem beschäftigt. Der deutsche Klang: Das ist nicht nur eine Facette der Interpretation oder eine Frage der eigenen ästhetischen Überzeugung, sondern vor allem ein Stück gelebte, praktizierte musikalische Tradition von Bach bis Schönberg und darüber hinaus. Und der Komponist, an dem sich das alles am besten diskutieren lässt, heißt Ludwig van Beethoven. Weil er, auf den Schultern der Tradition, wie kein Zweiter in die Zukunft blickt. Deswegen steht in der Mitte dieses Buches ein Kapitel zum deutschen Klang.
Ansonsten möchte ich chronologisch durch Beethovens symphonisches Werk gehen, an vier Konzertabenden gewissermaßen, so wie ich auch meine Beethoven-Zyklen dirigiere. Die neun Symphonien sind Herz und Gipfel der symphonischen Tradition und ein Kosmos für sich, den man ein Leben lang erforschen kann. Aber auch das Violinkonzert und die fünf Klavierkonzerte sind aus einem Dirigentenleben nicht wegzudenken. Und ohne die Klaviersonaten und Streichquartette, die späten zumal, wäre mein Beethoven-Bild ebenso wenig vollständig wie ohne die Missa solemnis. In ihr, finde ich, kristallisiert sich der ganze Beethoven.
Beethoven zu dirigieren bedeutet, Farbe zu bekennen. Man bekennt ganz unweigerlich Farbe, indem man sich so intensiv wie bei kaum einem anderen Komponisten mit musikalisch-praktischen Fragen auseinandersetzt: mit Tempi und Metronomzahlen, mit größeren oder kleineren Besetzungen, mit Details der Artikulation, der Dynamik und mit den verschiedenen Editionen. Im Folgenden soll es auch um solche Fragen gehen, gerade um solche Fragen, um einen Einblick in die Werkstatt des Beethoven-Dirigenten zu gewähren. Beethoven entlässt uns nie aus der Pflicht. Das gilt auch für eher lebensweltliche Themen. Ein Musiker, der sein Gehör verliert und weitermacht? Ein Symphoniker, von dem so gut wie keine politische Äußerung überliefert ist – der aber bis heute hochpolitisch rezipiert wird? Das regt die Fantasie an, bei Biographen, bei Interpreten und bei den Zuhörern. Genauso wie die Frage, die mich partout nicht loslässt: Wie soll man Beethoven bloß einordnen? Als Klassiker, als Romantiker? Oder steht er über allen Kategorien?
Für mich ist die Beschäftigung mit Beethoven mehr als die Aufgabe, geniale Noten zum Leben zu erwecken (was schon nicht wenig wäre): Sie ist eine Existenzweise, ein Credo. Davon möchte ich in diesem Buch erzählen.
1
In die Todeszone und immer wieder zurück
Mit Beethoven leben
Beethoven wird mich bis an mein Grab beschäftigen.
Beethoven war mir immer nah, ist mir immer nah. Er ist mir Grundnahrungsmittel wie Bach oder Mozart. Alles, was Beethoven erfunden hat, begegnet uns später wieder. Bei Wagner, bei Brahms, bei Schönberg, bei allen. An Beethoven entscheidet sich alles. Er ist der Orgelpunkt eines jeden Musikerlebens. Mehr als Bach, nein: anders als Bach. Denn Bach wurde in den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts von der historisch informierten Aufführungspraxis gekapert – und aus dieser Haft nie wieder ganz entlassen. So etwas gibt es bei Beethoven nicht. Beethoven gehört allen: den Aufführungspraktikern wie den Romantikern, den Exzentrikern und auch den politischen Exegeten. Das macht ihn modern. Das bringt ihn uns nah.
In meiner Kindheit und Jugend ist mir von allen Seiten vermittelt worden, zu Hause, in der Schule, von meinen Lehrern: Ein guter Musiker ist einer, der Beethoven kann. Beethoven ist die Nagelprobe. Wenn du ein echter Musiker sein willst, hieß es, musst du auf gutem Fuß mit Beethoven stehen. Das habe ich mir nicht zweimal sagen lassen. Wenn man Beethoven sucht, findet man ihn schnell. Ich habe keinen komplizierten Zugang zu Beethoven gehabt.
Was das Orchester betrifft, war Beethoven für mich der Erste. Bei uns zu Hause gab es eine Platte mit der Egmont-Ouvertüre, die war etwas beschädigt und hatte so eine leichte Ausbuchtung. Das weiß ich noch wie heute. Auf der Plattenhülle war die Nike von Samothrake abgebildet, das war für mich zugleich die erste Begegnung mit griechischer Kunst. Ein wunderbares Cover der fünfziger, sechziger Jahre! Die Egmont-Ouvertüre hat mich umgehauen (obwohl ich gar nicht mehr weiß, wer dirigiert und gespielt hat). Sie ist einer der Gründe, warum ich Dirigent geworden bin. Da war ich ganz jung, sechs oder sieben. Seither begleitet mich der Beginn dieser Ouvertüre durch alles. Gar nicht einmal das erste Forte-F, sondern die dunklen Farben, das f-Moll. Ich weiß nicht, warum mich dieser Klang so fasziniert hat. Es war wohl die Gewalt, die davon ausging, so düster und echt. Beethoven strotzt hier förmlich vor Kraft. Und er weiß oft nicht, wohin damit, daher die vielen Sforzati in den Noten, dieser vehemente Nachdruck.
In der Egmont-Ouvertüre macht uns die erste Note bereits zur Schnecke. Und dann diese Stretta – ich wusste damals gar nicht, was eine Stretta ist, aber dass das am Schluss dieses kurzen, kaum zehnminütigen Stücks so losgeht, mit Hörnern und Piccoloflöte, dieser Jubel, dieser Allegro-Sieg über Kampf und Finsternis, das hat mich unglaublich ergriffen. Als mir irgendwann die Furtwängler-Aufnahme in die Hände fiel, war es endgültig um mich geschehen. Das war für mich die Bestätigung des Dunkelgrundierten, sofern es die noch gebraucht hätte. Fehlt das Dunkle bei einer Beethoven-Interpretation, wird es herausgefiltert, warum auch immer, dann ist mein Genuss «getrübt» (wie die Gräfin in Capriccio von Richard Strauss sagt). Beethoven kann auch ohne das Dunkle sehr schön dirigiert sein, zweifellos, aber man bleibt ihm etwas schuldig. Er hat in seiner Musik etwas Erdiges. Ich denke mir manchmal, vielleicht ist er ja sechzehn oder siebzehn Mal in Wien umgezogen, weil er so gerne Wurzeln geschlagen hätte.
Für mich hatten seine Symphonien früh Farben. Die Vierte ist grün, die Dritte hat ein helles Orange. Wobei das keine spezifischen Beethoven-Farben sind, sie richten sich mehr nach den Tonarten. A-Dur ist blau, As-Dur lila, c-Moll ist schwärzlich oder grau.
Die nächste Beethoven-Erinnerung habe ich an die fünfte Symphonie, die ich als Kind sehr oft gehört habe, vor allem, weil mich der Schluss so fasziniert hat, diese acht Akkorde! Das hört gar nicht mehr auf, aufzuhören! Die Fünfte hat für mich so etwas, das in die Tiefe der Beine fährt. Wie bei lauter Popmusik, die hat auch einen Rhythmus, eine Art Stampfen, dem man sich nicht entziehen kann. Auch zur Missa solemnis bin ich sehr früh gekommen, über eine Karajan-Aufnahme mit den Berliner Philharmonikern, da muss ich zwölf oder dreizehn gewesen sein. Die Missa hat mir sofort eingeleuchtet und gefallen, und im Gegensatz zu vielen von mir hoch verehrten Kollegen habe ich später nie gefunden, dass sie uns dirigentisch vor unlösbare Probleme stellt. Meine erste Missa habe ich mit dem Chor und dem Orchester der Deutschen Oper Berlin im Schauspielhaus am Gendarmenmarkt dirigiert (wie es damals hieß). Und schon da dachte ich: Die Missa ist kein unbezwingbarer Berg. Inzwischen habe ich sie an die fünfzehn Mal dirigiert. Vielleicht darf man vor diesem Typen mit der grimmigen Miene und den wilden Haaren einfach keine Angst haben. Jedenfalls ist und bleibt die Missa solemnis mein absolutes Herzensstück.
Auch am Klavier bin ich früh mit Beethoven in Berührung gekommen. Als Erstes gespielt habe ich die erste Sonate, Opus 2 Nr. 1, wieder f-Moll. Technisch ist das für einen Elf- oder Zwölfjährigen gut zu bewältigen. Schnell bin ich auch zur Pathétique gekommen, die gar nicht so schwer ist – sie klingt nur schwer. Opus 10 Nr. 3 ist schon ein anspruchsvolleres Stück. Und dann die späten Sonaten natürlich: Opus 109 und Opus 110 habe ich sehr genau studiert – und mit Opus 111, Beethovens letzter Sonate, hatte ich gerade angefangen, da wurde ich Korrepetitor an der Deutschen Oper Berlin und habe irgendwann aufgehört, Klavier zu üben. Ob ich Beethoven damals verstanden habe? Aus heutiger Sicht würde ich das bezweifeln. Es ist ein Unterschied, ob ich mit den Fugati in Opus 109 keine Probleme habe, weil ich schnell auswendig lerne, oder ob ich strukturell wirklich begreife, wie Beethoven hier die Form unterläuft. Das gilt auch für Beethovens Bagatellen für Klavier, die merkwürdigsten aller Gebilde überhaupt.
Was die Kammermusik angeht, hätte ich eigentlich gerne Bratsche im Streichquartett gespielt, aber man ließ mich nicht, einfach weil ich am Klavier besser war als auf der Bratsche. Also musste ich Klaviertrio spielen.
Ein Schlüsselerlebnis hatte ich mit Helmut Roloff, meinem damaligen Klavierlehrer. Ein Erlebnis, das weit über Beethoven hinausweist. Es ging um den Variationensatz der Sonate Opus 109, der E-Dur-Sonate, Andante molto cantabile ed espressivo, «sehr sangbar und ausdrucksvoll». Ich dachte, ich muss hier doch irgendwas machen. Roloff aber sagte: Machen Sie einfach ein paar Takte wenig, fast nichts – und gehen dann auf, fangen dann an zu singen. Dieses und dann war für mich eine existenzielle musikalische Erfahrung. Eine Zeit lang mit Ausdruck ohne Ausdruck zu spielen, auf einen Ausdruck oder Höhepunkt hin, das habe ich bei Roloff gelernt. Das gilt übrigens auch fürs Dirigieren. Nichts zu machen mit Intensität, wenig zu machen mit voller Intensität, das ist der Schlüssel zu vielem. Der langsame Satz der Eroica ist dafür ein absolutes Paradebeispiel: 2/4-Takt, Marcia funebre, Trauermarsch. Wenn das gut dirigiert wird, kommen die Sargträger von weit her, was nicht nur eine Frage der Dynamik ist. Es bedeutet vielmehr, dass die Streicher anfangs etwas distanzierter spielen sollten, mit weniger Vibrato – aber nicht ohne Vibrato! Nur so stellt sich die leichte Ermattung und Depression ein, die dieser Satz braucht.
Von Anfang an hat mich der späte Beethoven besonders beschäftigt. Ein Streichquartett wie Opus 131 in cis-Moll ist im Grunde ja der helle Wahnsinn. Sieben Sätze – und keiner stimmt! Das Scherzo steht an der falschen Stelle, einen richtigen langsamen Satz gibt es auch nicht, alles scheint sich aufzulösen, ist bloß mehr Rezitativ. Ähnliches gilt für die späten Klaviersonaten. Ist die Auflösung der Form die Konsequenz aus den Freiheiten, die Beethoven sich als Komponist nimmt – und auch seinen Interpreten zugesteht?
Solche Fragen haben mich fasziniert. Man hat als Jugendlicher ja so eine Phase, in der man besonders das vermeintlich Entlegene, die Verrücktheiten liebt. Diese Phase kam bei mir relativ früh, und Beethoven besaß irgendwie auch den Reiz des Verbotenen. Jeder erwachende Mensch sucht nach Extremen, macht Drogenerfahrungen. Meine Droge war die Musik, und Beethoven stellte für mich ein ähnliches Erlebnis dar wie Wagner. Auch Konzertabende von Maurizio Pollini und Daniel Barenboim mit späten Beethoven-Sonaten zählten dazu. Schwere Kost für einen Schüler, sollte man meinen, aber das Extreme war mir bald geläufig, ich bin ja auch mit Wagners Tristan und Isolde bedenklich früh in Berührung gekommen. Beethovens musikalische Sprache hatte für mich von Anfang an etwas unmittelbar Vertrautes. Ich habe es nie verstanden und verstehe es bis heute nicht, dass viele Menschen mit dem späten, tauben, ach so verrückten Beethoven ein Problem haben. Bei mir war es eher so, dass ich den jungen, frühen Komponisten nicht begriff, ich dachte, da interessiert Beethoven mich nicht, weil er noch so harmlos ist. Was natürlich nicht stimmt. Und dann habe ich versucht, das Werk von hinten aufzudröseln, und habe beim frühen Beethoven vieles gefunden, was mich an den späten erinnerte. In der Klaviersonate Opus 10 Nr. 3 zum Beispiel entdeckt man, wenn man genau hinhört, gewisse Dinge aus der Missa solemnis! Also kann ich eigentlich jedem Interpreten nur raten, fangt mit dem späten Beethoven an!
Auch weil Beethoven viel verträgt. Der geht nicht so schnell kaputt. Insofern sollte man möglichst früh ran als junger Dirigent und Pianist: ran an die Neunte, um an ihr zu scheitern, ran an Opus 111, um festzustellen, was für ein Klaviervirtuose Beethoven gewesen sein muss. Als Dirigent habe ich mit der vierten Symphonie begonnen, eher aus Zufall, in Italien, das war eine Frage der Orchesterbesetzung. Dann habe ich mir relativ schnell die Dritte vorgenommen und bin krachend gescheitert – eine wichtige Erfahrung! Als junger Generalmusikdirektor in Nürnberg habe ich einmal ein Programm mit der Eroica und den Metamorphosen von Strauss dirigiert. Das fand ich absolut genial – war’s aber leider nur auf dem Papier. Erst kam die Eroica, dann die Metamorphosen. Ich kann mich gut erinnern, dass ich überhaupt keinen Plan hatte, wie ich den ersten Satz der Eroica innerlich gliedern sollte. Seither weiß ich: Diese Symphonie gehört ans Ende eines Konzerts.
Joseph Haydn, 1792 porträtiert von Thomas Hardy. Im selben Jahr siedelte Beethoven nach Wien über
Beethovens Musik scheint so weit über allem zu stehen, dass man sich für seine Person oder sein Leben kaum interessiert. Zumindest kann ich das von mir so sagen. Ein eigensinniges, stilles Wunderkind soll er gewesen sein. Am Klavier konnte er improvisieren, mit vierzehn tritt er in die Bonner Hofkapelle ein, spielt Orgel und Bratsche, mit achtzehn übernimmt er die Vormundschaft für seine beiden jüngeren Brüder (die Mutter stirbt an Schwindsucht, der Vater ist Alkoholiker). Anfang zwanzig übersiedelt er endgültig nach Wien und geht bei den Besten der Besten in die Schule: bei Haydn, Albrechtsberger und Salieri. Kurz darauf beginnt seine steile Karriere: Er konzertiert (als Klaviervirtuose und Improvisator) und reist, als überzeugter Bürger sucht er die Nähe zum europäischen Adel, findet dort Gönner, komponiert immer mehr und hat Erfolg. Mit Ende zwanzig aber bemerkt er, dass er schlecht hört, zwei Jahrzehnte später ist er komplett taub. Beethoven gilt allgemein als Willensbolzen und «faustisch Suchender». Von Goethe wird der interessante Ausspruch überliefert, es käme ihm so vor, als sei Beethovens Vater ein Weib und seine Mutter ein Mann gewesen. In der Liebe hatte Beethoven kein Glück. Die Seneca-Losung «per aspera ad astra» («durch Nacht zum Licht»), die als Motto für die Fünfte ebenso taugt wie für seine einzige Oper Fidelio, für die Missa solemnis wie für die Neunte, wächst ihm als Kompositions- und Lebensprinzip zu. Selbstüberwindung zum Heil der Kunst? Was für eine romantische Vorstellung!
Dazu kommt das sogenannte Politische, das bei Beethoven eigentlich immer das Menschliche war. Seine anfängliche Begeisterung für das napoleonische Zeitalter und die Ideale der Französischen Revolution, die politische Ernüchterung in der Metternich-Ära – darüber wurden Romane geschrieben, die Appassionata heißen, und Kinofilme gedreht wie Eroica von 1949 mit Ewald Balser in der Rolle des Komponisten. All das besitzt einen gewissen Unterhaltungswert. Auch weil Beethoven nicht nonkonformistisch war, um nonkonformistisch zu sein – er war wirklich so. Das macht ihn mir sympathisch. Beethoven hat aufbegehrt, er hat zum Ausdruck gebracht, wenn ihm etwas gegen den Strich ging. Er musste aus sich nichts machen, das war einfach sein Genie. Und das hat man akzeptiert.
Beethoven ist so populär, weil bei jedem irgendwann das «Schicksal an die Pforte pocht» (so soll er auf Nachfrage das Vier-Ton-Motiv am Anfang der fünften Symphonie erklärt haben). Wir alle finden uns in ihm wieder. Das gilt natürlich auch für andere Komponisten. Doch Bach war ein Kraftkerl, spielte toll Orgel und riss sich hin und wieder die Perücke vom Kopf. Mozart war ein Kind, Haydn hat viel gelacht und besaß ein sonniges Gemüt. Beethoven aber war ein Solitär und als solcher schwierig. Solitäre reiben sich oft an den Umständen, den sozialen wie den politischen oder ästhetischen. Sie können sich schlecht einfügen. All das hören wir in Beethovens Musik. Und dafür muss ich nicht unbedingt wissen, was für ein grauenerregender Untermieter er gewesen ist oder wie viele Flaschen fuseligen Wein er pro Tag trank. Trotzdem frage ich mich: Wie konnte er persönlich so ungebärdig sein und so organisiert arbeiten?
Mit Beethoven muss man leben als Musiker. Und immer wieder neu kämpfen. Ich halte gar nichts davon, sich erst im vorgerückten, reiferen Alter die Gipfelwerke des Repertoires zuzutrauen. Flapsig formuliert: Mit Mitte fünfzig ist bei Beethovens Neunter der Zug abgefahren! Die Reife dafür erwirbt man, indem man sich von dieser Symphonie gleichsam berieseln lässt und viele, viele Jahre lang weder ein noch aus weiß. Das muss man aushalten. Denn nur so beginnt es in einem zu reifen. Viele junge Dirigenten wollen heute vor allem Mahler dirigieren. Ich würde den Spieß umdrehen: Für Beethoven muss man jung sein, an Beethoven sollte man sich so früh wie nur irgend möglich die Pfoten verbrennen. An Mahler verbrennt man sie sich ohnehin, damit kann man auch noch etwas warten. Beim einen wie beim anderen muss man lernen, die Dinge mit Abstand zu sehen – und nicht in jede Falle zu tappen. Mahler stellt uns eine Falle nach der anderen; Beethoven ist eine einzige Falle. Im Grunde ist er unüberwindbar.
Deshalb muss Beethoven über Jahre und Jahrzehnte in einem gären. Sobald ich eine Beethoven-Partitur zur Hand nehme, trete ich in einen Dialog mit mir selbst: Immer hast du an dieser Stelle ein Ritardando gemacht – jetzt machst du es einmal nicht. Oder: Diesen oder jenen Satz hast du immer sehr schnell genommen, nimm ihn doch einfach langsamer! Solche Kopfgespräche mögen banal klingen und nach Willkür, aber sie setzen die vollkommene Kenntnis der jeweiligen Partitur voraus – und die ist nie banal. Jede kleine Entscheidung hat Konsequenzen, alles strahlt durchs ganze Werk hindurch. Von Furtwängler gibt es eine Auflistung seiner gesamten Konzerte, aus der zu ersehen ist, wie oft er in seinem Leben allein die Fünfte dirigiert hat. Das geht in die Hunderte! Da wundert man sich dann nicht mehr, warum er so gut war. Man hört es auch an gewissen Details, an der Fugato-Stelle aus dem Schlusssatz der Neunten etwa, die im Übergang sehr heikel ist. In drei verschiedenen Aufnahmen meistert Furtwängler diese Stelle auf drei verschiedene Weisen. Ich darf also auch nicht denken, dass mir, wenn ich etwas anders mache als sonst, gleich ein Zacken aus der Krone bricht. Das Gesamtbild stimmt möglicherweise trotzdem.
Als junger Dirigent hat man für Beethoven entschieden zu viel Kraft – wie für Wagners Tristan oder eine Bruckner-Symphonie. Man brettert los, man brettert durch und stellt in der Wirkung der Musik, im Ergebnis bald erste Abnutzungserscheinungen fest. Plötzlich steht die Ökonomie-Frage im Raum. Jedenfalls war das bei mir so. Man hat die Kraft, die Musik ist irre intensiv – und trotzdem ist man nicht zufrieden mit sich. Die richtige Ökonomie für Beethoven habe ich letztlich bei Wagner gelernt. Ich habe meine Wagner-Erfahrung auf Beethoven appliziert und vom Großen aufs Kleinere geschlossen, in einem reziproken Prozess. Durch das Wagner-Dirigieren, würde ich denken, ist mein Beethoven besser geworden. Wer wie ich die typische Kapellmeister-Laufbahn absolviert, geht von der Oper her auf Beethoven zu. Da legt man dann andere Maßstäbe an die Flexibilität des Musizierens im Moment, am Abend an, nicht nur in Sachen Tempo. Denn in der Oper geht es einfach nicht ohne Flexibilität. Auch daraus hat sich mit der Zeit mein Beethoven-Bild geformt.
Heute sehe ich in einer Beethoven-Partitur, wenn ich sie zur Hand nehme, vor allem, was ich darin bisher übersehen habe. Und ich erinnere mich an meine Fehler. Ich habe Beethoven lange als sehr monumental empfunden. Doch da lag ich falsch. Und gerade am Anfang habe ich ihn sicher zu monumental interpretieren wollen. Ich hatte gute Absichten, aber wahrscheinlich habe ich erst jetzt das Maß gefunden, mich an gewissen Stellen zurückzuhalten, um das Monumentale an anderen besser ausspielen zu können. Karajan zum Beispiel hat die Eroica mit acht Kontrabässen spielen lassen, mit der größten Streicherbesetzung. Da denkt man als junger Mensch, das muss so sein, das gehört so, außerdem ist es schön. Auch Furtwängler war kein Feind des vollen Saftes, wenngleich er oft viel filigraner (und schneller!) musiziert, als man ihm das unterstellt. Und was macht man dann, wenn man – endlich – selber darf? Man versucht, das, was man bewundert, noch zu übertrumpfen, und das geht natürlich schief. Es geht schief, weil sowohl Furtwängler als auch Karajan die Grenzen des Möglichen bereits überschritten hatten, auf ganz verschiedene Weisen.
Nachdem ich die Alten gehört hatte, die Romantiker unter den Interpreten, die die Höhepunkte setzen konnten und zu denen auch Furtwängler zählt, konnte ich Beethoven besser einordnen. Mit den Nur-schnell-Seienden, Alles-richtig-machen-Wollenden bin ich von Anfang an nicht zurechtgekommen. Toscanini ist von seinen Tempi in einer Weise überzeugt, dass man sich der Wirkung kaum entziehen kann. Gefallen hat mir sein Beethoven nie – oder sagen wir: selten. Aber seine innere Überzeugung, Beethoven so und nicht anders dirigieren zu müssen, die hat sich mir sehr stark mitgeteilt.
Der Nachkriegsgeneration unter den Dirigenten wurde vielfach unterstellt, sie lege zu viel Wert auf Äußerlichkeiten. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich stimmt. Karajan habe mit der Kommerzialisierung der Musik begonnen, heißt es, mit seinen Beethoven-Filmen, seinem Jetset-Leben, Schulter an Schulter mit mächtigen Agenturen wie Columbia Artists. Sicher brachte Karajan für das Mediengeschäft ein Talent mit. Er war fotogen, und wenn er sich seine Haare richtig föhnen ließ, dann sah das toll aus. Aber es gab auch den anderen Karajan. Den, der in seiner Garderobe im Sessel lümmelte und von seiner Zeit in Aachen erzählte. Ganz unprätentiös und normal. Neben Karajan war Leopold Stokowski so eine schillernde Gestalt. Überhaupt ist der amerikanische Einfluss auf den Musikmarkt Mitte des 20. Jahrhunderts nicht zu unterschätzen. Auch Leonard Bernstein hatte ein «Image», wie man damals sagte, mit Silberlocke und rotem Einstecktuch. Trotzdem galt er als authentisch. Das ist interessant. Bernstein wurde als Gesamtkunstwerk wahrgenommen. Er war das Bindeglied, wenn man so will, zwischen den Alten und den vermeintlichen Jüngern des Kommerzes. Bernstein war sexy, er hatte ein bisschen etwas Amerikanisch-Gelacktes, aber künstlerisch war er wahrhaftig. Diese Mischung vermissen wir heute. Gerade als Beethoven-Dirigenten schätze ich Bernstein sehr.
Auf der Suche nach dem eigenen Weg lernt man allerdings auch, Meinungen zu achten, die einem contre coeur gehen. Für mich sind das oft die britischen Kollegen Roger Norrington oder Simon Rattle, bei denen es grundsätzlich rhythmischer zugeht. Überhaupt: Man wird gelassener. Und erkennt, dass ein Forte vor 50 oder 250 Jahren ganz anders klang als heute.
Ich gelte gemeinhin als Stimmungs- und «Instinktmusiker», und ganz falsch ist das nicht. Wobei ich selbstverständlich nicht ohne Idee vor Beethoven stehe, ebenso wenig wie die Kolleginnen und Kollegen «Konzeptmusiker» ohne ein Gefühl für Stimmungen, für Atmosphäre auskommen. Darüber hinaus gibt es viele Unwägbarkeiten, das macht sich das Publikum oft nicht klar. Die Nachmittage vor einer Aufführung oder vor einem Konzert können wirklich quälend sein. Mal habe ich einen leichteren Herzschlag, mal bin ich so müde, dass der Orchesterwart mir einen Espresso bringen muss. Manchmal fühle ich mich aber auch müde, gehe aufs Podium – und bin total wild. Dem allen darf man sich natürlich nicht restlos ausliefern. Auch davor schützt einen die Erfahrung. Im entscheidenden Augenblick geht im Kopf eine rote Lampe an, die sagt: Achtung! Das geht zu weit! Andererseits darf man gerade bei Beethoven seine Unschuld nicht verlieren, das ist ganz wichtig. Es wäre ja furchtbar, wenn man nur noch als alter Sack zum Pult schlurft und denkt: Ich weiß sowieso alles. Das wäre das Ende der Musik.
Mit den Wiener Philharmonikern 2008 bei der Aufführung von Beethovens neunter Symphonie im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins
Mit Beethoven muss man Qualen erleiden, wie gesagt. Halbwegs zufrieden mit «meinem» Beethoven war ich erst in Wien, beim Zyklus aller neun Symphonien mit den Wiener Philharmonikern von 2008 bis 2010. Ich sage halbwegs, weil mir manchmal noch der Puls in der Musik abhandengekommen ist und ich mich zu sehr habe übermannen lassen von den Ausbrüchen der Musik. Zufrieden war ich vor allem wegen des Orchesters und seines Konzertmeisters Rainer Küchl. Ein guter Konzertmeister inhaliert die Temperatur des Abends, dann stimmt das Tempo, dann stimmt das Vibrato, dann stimmt alles. Mit Küchl habe ich mich nie über Details wie Vibrato-Fragen unterhalten müssen. Das Vibrato muss einfach angemessen sein, diesen schönen Satz hat sein Kollege Matthias Wollong von der Dresdner Staatskapelle geprägt. Damit ist alles gesagt, mit beinharten Regeln kommt man da nicht weiter.
Ich kenne die Beethoven-Partituren in- und auswendig. Trotzdem frage ich mich: Dirigiere ich besser ohne Partitur oder besser mit? Ich lerne sehr schnell auswendig, zumindest wenn mir etwas musikalisch logisch erscheint. Anders ist es, wenn das nicht der Fall ist und ich die Noten regelrecht mathematisch pauken muss. Dazu habe ich meistens keine Lust. Und dann gibt es immer wieder viele Stolperfallen. Wie viele Schlussakkorde hat Beethoven am Ende seiner Symphonien noch gleich notiert? Ein Alptraum wäre es, einen wegzulassen oder, noch schlimmer, alleine weiterzudirigieren, während das Orchester bereits fertig ist. Alles schon passiert in der Musikgeschichte. Auch Generalpausen muss ich mir immer wieder anschauen, manche sind nur dann in meinem inneren Bauplan verankert, wenn sie sich für mich aus dem natürlichen Fluss der Musik ergeben. Es gibt Kollegen, die wissen so etwas einfach, weil sie ein untrügliches fotografisches Gedächtnis besitzen. Ich finde nicht, dass es ein Sakrileg ist, Beethoven mit Partitur zu dirigieren. Man darf nur nicht zu viel reingucken.
Die Tempi bei Beethoven sind ein neuralgisches Thema, schon wegen der aberwitzigen Metronomzahlen, die er hinterlassen hat. Aberwitzig heißt in den meisten Fällen: aberwitzig schnell, an der Grenze der Spielbarkeit (oder darüber hinaus). Sollen wir diese Schlagzahlen wörtlich nehmen oder mehr als «Hinweise» verstehen auf einen bestimmten Musiziergestus? Ich denke, jede Tempovorgabe ist eine Momentaufnahme – und so wollte Beethoven es auch verstanden wissen. In Zwickau gab es 2017 eine herrliche Ausstellung: «Robert Schumann und das Metronom». Da ging es um die damals noch neuartigen Apparate von Mälzel (dem Erfinder), Härtel oder von Collin. Die meisten liefen nicht rund, vor allem lieferten verschiedene Bauweisen und Typen jeweils verschiedene Ergebnisse. Im Rahmen der Schumann-Gesamtausgabe hat Clara sich die «Neumetronomisierung» der Werke ihres Mannes vorgenommen – und wurde darüber schier verrückt: «Denken Sie, ich gebe das Metronomisiren auf», schrieb sie 1878 an den Komponistenfreund Heinrich von Herzogenberg. «Gott, ist das eine Qual! heute fixire ich ein Tempo, morgen fände ich es unrichtig – das ist ja zum Verzweifeln. Ich lasse es – wer die Tempi’s nicht selbst findet, mag ganz von den Werken bleiben.» Genauso hat Beethoven das auch gesehen. «Weshalb ärgern sie mich, indem sie nach meinen Tempi fragen?», schreibt er in einem Brief. «Entweder sind sie gute Musiker und sollten wissen, wie meine Musik gespielt werden sollte, oder sie sind schlechte Musiker und in dem Fall wären meine Hinweise nutzlos.» Furtwängler hat dieses Zitat gerne benutzt.
Und was macht die Postmoderne daraus? Sie erklärt die Metronomzahlen zur Bibel! Und alle Interpreten, die sich nicht daran halten, zu Geschichtsklitterern. Das finde ich nicht nur falsch, sondern absolut unbeethovensch. Beethoven war so ein sensibler Zeitgenosse, ein Seismograph, warum hätte er seine Musik für alle Zeiten festklopfen wollen?