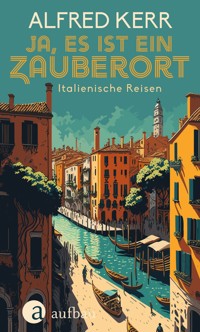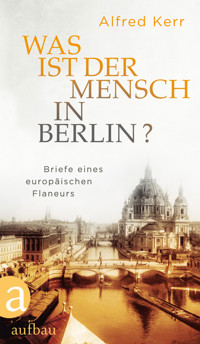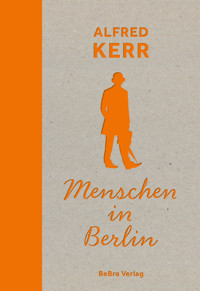
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BeBra Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der heute vor allem als Theaterkritiker bekannte Alfred Kerr war ein talentierter Chronist seiner Zeit. Seine zwischen 1895 und 1922 für verschiedene Zeitungen verfassten "Berliner Briefe" zeugen von seiner messerscharfen Beobachtungsgabe. Geistreich, ironisch und immer unterhaltsam bringt er die Eigenheiten seiner Zeitgenossen auf dem Punkt und schreibt mit spitzer Feder über das zeitlose Phänomen der Hauptstadttouristen. Die hier ausgewählten Texte zeichnen das Panorama einer Zeit der Umbrüche - vom Deutschen Kaiserreich bis zur Weimarer Republik.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 140
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ALFRED KERR
Herausgegeben und mit einem Nachwortvon Ingrid Feix
BeBra Verlag
INHALT
Ein alter Herr mit Hut und ein höllischer Festgreis
Drei Dramatiker, eine schauspielernde Malerin und die kaiserliche Gunst
Die falsche Erzherzogin
Fremde in der Stadt
Der hochdekorierte Maler
Der Kainz gab den Faust
Der Entdecker der Kathodenstrahlen
Die Italiener
Ein betagter Sträfling
Vertreter des Volkshumors
Das populäre Haus der Brüder Wertheim
Die Fürstin und der kunstliebende Kanzler
Ein französischer Star
Berliner Künstler und ihre Revolution
Parade einer Wiener Burgschauspielerin
Ein Münchner Dichter, aber ein Sohn Berlins
Die größte Schauspielerin der Welt
Beim Besuch im Reichstag
Die Gesellschaft zum Tee
Kriegsgefangene
Wirtshausbesucher im dritten Kriegsjahr
Der Ostpreuße Lovis Corinth
Ein Freund aus dem ehemaligen Feindesland
Die Wirtschaftslage und Chaplins Publikum
Nachwort
Über die Herausgeberin
EIN ALTER HERR MIT HUT UND EIN HÖLLISCHER FESTGREIS
Der Berliner Westen – diese elegante Kleinstadt, in welcher alle Leute wohnen, die etwas können, etwas sind und etwas haben und sich dreimal so viel einbilden, als sie können, sind und haben – hat in dieser Woche zwei Jubelgreise gefeiert. Ludwig Pietsch und Theodor Fontane. Pietsch ist siebzig, Fontane fünfundsiebzig Jahre geworden. Aber es gibt zwischen ihnen mehr Unterschiede als diese fünf Jahre. Der eine ist ein Temperamentsmensch, der andere ist ein nachdenklich-skeptischer Betrachter. Der eine ist ein lauter, aufgeknöpfter Amüseur, der andere ein stiller, zurückgezogener Mann. Der eine betrachtet die Erscheinungen, und es kommt ihm darauf an, äußere Eindrücke zu beschreiben; der andere betrachtet gleichfalls das äußere Leben, aber es kommt ihm darauf an, dabei seelische Zusammenhänge zu schildern. Der eine ist, kurz, ein Journalist, der andere ist ein Dichter. Nun hat der Journalist den Professortitel bekommen; der Dichter durfte nur, versehen mit den Tröstungen des Dr. phil. honoris causa, ins sechsundsiebzigste Lebensjahr schreiten.
Ein alter, großgewachsener Herr ist Theodor Fontane, mit schmalem Seitenbärtchen und grauem Schnurrbart. Ein großes Tuch um den Hals gelegt, das über dem dicken Mantel sitzt, schreitet er die Potsdamer Straße entlang. Er geht gewöhnlich dicht an den Häusern, weil es ihm keinen Spaß machen würde, von den hundert Bekannten, die dort jeder Bewohner des Westens täglich trifft, angehalten zu werden. Nicht als ob er unfreundlich wäre. Aber es lohnt wahrhaftig nicht, ein paar Banalitäten auszutauschen und sich dafür zu erkälten. Vor dem Erkälten hat er nämlich große Angst, und darum hält er das berühmte graugrüne Tuch stets vorn mit der Hand zusammen. Unter dem Hut blicken die guten klugen und großen grauen Augen in die Ferne, und mit raschen Schritten geht er, etwas nach vorn geneigt, unaufhaltsam seines Weges. Wenn es windig ist, schreitet er rascher, und er hält das Tuch fester und höher, bis über den Mund weg. Die grauen Locken bewegen sich dann leise, die dem alten Herrn über dem Nacken schweben. Es sind keine Künstlerlocken! Er sieht nicht aus wie ein greiser Barde, von dem zu befürchten ist, dass er eine Leier aus der Manteltasche zieht. Er hat etwas Altfränkisch-Militärisches. Er hat das Gesicht eines friedlichen pensionierten Offiziers aus den dreißiger Jahren. Über dem ganzen Mann schwebt im Äußeren, auch in der Kleidung, bis auf Halsbinde und Kragen ein Hauch der guten alten Zeit.
Und das Staunenswerte ist: Diese unmoderne Persönlichkeit hat unglaublich moderne Ansichten. Der älteste unter den deutschen Literaten ist zugleich der entschlossenste Parteigänger der jüngsten. Er wird von ihnen geliebt wie kein Zweiter. Nicht minder von demjenigen Kreis der übrigen literarisch Interessierten, welcher nicht in rohen Bumbum-Effekten und verlogenen Sentimentalitäten den Gipfel der Kunst erblickt, sondern sich zu ehrlicher Lebensabschilderung und feinerer Seelenkunde hingezogen fühlt. Sie alle bestaunen ein Phänomen in dem Manne, der sich, im zarten Alter von sechzig Jahren, entschloss, ein naturalistischer Dichter zu werden; der sich hinsetzte und in »Irrungen und Wirrungen« flugs den besten Berliner Roman schrieb; der heut mit fünfundsiebzig Jahren noch ein wundervolles, lebenstiefes Abendstück von reifer und inniger Kunst zustande bringt.
Der Alte hat ein lebendiges Interesse an allem, was auf literarischem Felde vorgeht. Und was er für bedeutsam und richtig hält, dem spendet er unaufgefordert, in jugendlicher Herzlichkeit, sein Lob. Er braucht einen Menschen nicht zu kennen und tritt ihm plötzlich – ich hab es mit tiefer Freude an mir erfahren – durch einen Brief näher, weil ihm irgendetwas auffiel und gefallen hat. Und er ist ein Kritiker. Er hat in den langen Jahren, in denen er die zeitgenössische Dramatik, berufsmäßig richtend, verfolgte, unendlich fördernde, herbfrische, knappe Kritiken geschrieben, zugleich knorrig und fein, zugleich scharf schneidend und schmiegsam nachfühlend.
Er schrieb für die Vossische. Und für die Vossische schrieb auch sein Leben lang der andere: Pietsch. Das ist wieder eine ganz andere Nummer! Ein großer, kräftiger, jünglinghafter Greis, mit geröteten Wangen, die Silberhaare künstlerisch drapiert, in den feurigen, grauen Augen ein rheinweinfeuchter Schimmer, die Manieren elegant, sicher, verbindlich, dabei in allem Tun und Lassen ein leiser Rest von Bohème und Sichgehenlassen, was die ungewöhnliche Liebenswürdigkeit, die von dem Mann ausgeht, wirkungsvoll steigert. Er ist ein Draufgänger, mit seinen siebzig Jahren, aus allen Gliedern zuckt ihm die joie de vivre, er lebt aus dem Vollen, er hat schwerlich die Hoffnung aufgegeben, Frauen noch gefährlich zu werden, er ist bei jedem notablen Festessen, bei jeder Première, in jeder Ausstellung, bei jeder Einweihung. Er geht mit dem Kaiser nach England und beschreibt Flottenmanöver, er geht zum Zarenbegräbnis nach Moskau und ist am Abend nach der Rückkehr im Opernhaus, um am nächsten Vormittag ein Champagnerfrühstück mitzumachen, um dann bei Schulte gesehen zu werden, einen Spaziergang durch den Tiergarten zu machen, eine Redaktionskonferenz abzuhalten, rasch einen Artikel zu schreiben, abends Gäste bei sich in der Landgrafenstraße zu empfangen und schließlich mit ihnen ins Café zu gehen. Er ist mit allen einflussreichen Künstlern intim, duzt sich mit Ministerialdirektoren und kommandierenden Generälen, drückt im Vorübergehen einem Kommerzienrat die Hand, küsst einer Schauspielerin den Ellbogen und kneipt mit Eugen Zabel von der »Nationalzeitung«, dem Maler Warthmüller und einer Handvoll Premierlieutenants an dem berühmten runden Tisch bei Hausmann. Bei allen Frauen hat er einen Stein im Brett; denn wenn er sie schon durch seine Persönlichkeit bezaubert, wissen sie doch, dass er ihre Kostüme beschreiben kann … Ein Subskriptionsball kann ja ohne Pietsch gar nicht abgehalten werden! Er schildert die Lichter, den Glanz, die Pracht, die Farben, die Mull- und Tüllkleider und was sie nicht bedecken, er schildert die Parfums, die Musik, die Rosen und Heliotropen, die Fräcke, die Orden, die Gesichter, er schildert die jungen Mädchen – die Komtessen und die portemonnaie-aristokratischen –, er schildert die schönen Witwen und die glücklichen Gattinnen, die tapferen Krieger und die alten Exzellenzen, er schildert alles – bloß die Gedanken nicht, die seine Objekte im Herzen tragen. Hier macht er halt, und hier liegen auch die Grenzen seines Könnens. Er malt die Oberflächen, und er grämt sich nicht, dass er nicht mehr malen kann. Er ist mit sich zufrieden. Er schafft leicht, er verdient zwar keine Millionen, aber bei seinem Beruf führt er ohne Millionen ein Glanzleben. Er findet die Welt schön und will keinem Nebenmenschen Ursache geben, sie hässlich zu finden. Er verletzt niemanden, auch in seinen Kritiken nicht, höchstens die jüngeren Freilichtmaler bekommen ’mal ein paar Hiebe – er ist der denkbar liebenswürdigste Kollege, auch gegen jugendliche Berufsgenossen von beschämender Kameradschaftlichkeit, seine Intimität mit den Granden steigt ihm nie zu Kopfe, und er scheint seinen versammelten Zeitgenossen in jeder Minute die Parole zuzuzwinkern: »Kindlein, liebet euch!« oder »Freut euch des Lebens« oder »Mensch, ärgere dich nicht« oder »O Gott, wie ist die Welt so schön, wenn man gesunde Glieder hat« …
Dass dieser alte Jüngling an seinem siebzigsten Geburtstag ungewöhnlich zahlreiche Huldigungen empfing, ist begreiflich. Er verlebte das Jubiläum in etwas eigenartiger Weise. Es fiel auf den 25. Dezember; sein Wiegenfest begann also offiziell am 24. Dezember nachts zwölf Uhr. Da begann er denn auch mit der Feier. Er feierte in einer Tour von Weihnachten durch bis zum Anbruch des 26. Dezember. Er ging nicht schlafen, sondern – empfing. Die ganze Nacht durch waren Gäste da, sie kamen und gingen. Gegen Morgen entfernte sich der Jubeljüngling, nur auf fünfzehn Minuten, um eine kalte Douche zu nehmen. Er wollte dieser Gewohnheit nämlich nicht entsagen, da er ihr seit grade siebzig Jahren treu geblieben war. Die Gäste kamen und gingen. Er drückte unzählige Hände, ließ sich umarmen, teilte Küsse aus, tat gerührt, machte Honneurs, nahm ungezählte Telegramme und einen Professortitel entgegen, rauchte, trank Wein, stieß an und war glücklich. Man konnte kaum zur Tür hinein, so dicht gedrängt standen, saßen, schoben und pufften die Gratulanten; jeder, der zehn Minuten in dem von Kuchendünsten, Büfettdüften und Blumengerüchen angenehm geschwängerten Raum sich aufgehalten hatte, wurde abgespannt, nur einer nicht: der höllische Festgreis. Am 27. Dezember sah ich ihn bereits im Deutschen Theater, nachher waren wir bei Ronacher zusammen. Nachts um eins wandelte er behaglich nach Hause.
Breslauer Zeitung, 1.1.1895
DREI DRAMATIKER, EINE SCHAUSPIELERNDE MALERIN UND DIE KAISERLICHE GUNST
Herr Kammergerichtsrat Wichert ist ein freundlicher Mensch, etwas am Ausgang der Fünfzig. Ein mittelgroßer hagerer Mann mit einem primitiv gehaltenen grauen Vollbart, der sich in zwei Zipfel teilt. Ewig im offenen schwarzen Rock, ewig den Kneifer mit der schwarzen Schnur auf der Nase, ein Bild sehr verständiger, etwas nüchterner Bürgerlichkeit und vernünftigen grauen Beamtentums. Er redet nicht in Paradoxen: er zieht bewährte Wendungen vor. Er verwirrt nicht durch allzu individuelle Äußerungen: Er geht auf das Große, auf das Ganze, auf das Allgemeine; der Vorwurf, dass der Inhalt seiner Äußerungen noch nicht dagewesen sei, wird ihn kaum treffen. Einen leisen wohltuenden Humor verleiht es ihm, dass er dennoch seine Äußerungen mit einem gewissen Brustton sagt, mit einer freundlichen Unentwegtheit, wie sie den Verkündern eigen ist. Herr Kammergerichtsrat Wichert ist durch seinen Titel eine nie versagende Kraft für journalistische Repräsentation: auf Schriftstellerkongressen, im Verein Berliner Presse, bei Deputationen und so weiter. In zweiter Reihe kommt seine andere Eigentümlichkeit: Er ist ein deutscher Dichter. Er schreibt Romane, er schreibt Stücke; er schreibt lustige Stücke, er schreibt traurige Stücke, er schreibt lange und kurze Stücke, er schreibt historische und bürgerliche Stücke, er schreibt gute und schlechte Stücke. An die letzte Art hat er sich am konsequentesten gehalten.
»Marienburg« ist sein neuestes, und es gehört wieder zu der letzten Art. Die Gattin eines Thorner Ratsherrn namens Tilemann vom Wege lernte einst den Hochmeister des Deutschen Ordens kennen; so gut, dass sie einige Zeit darauf einem Mägdlein das Leben schenkte. Der Gatte war von diesem Vorfall unangenehm berührt und setzte sie in der Wildnis aus. Aber Frau Tilemann wurde gerettet und lebte fürder als einfache Waldfrau in einem dichten Forst mit ebendieser Tochter Ursula, die bald zu einer blühenden Jungfrau heranreifte. Herr Tilemann besaß einen Sohn, Jost, der zu einem nicht minder blühenden Jüngling heranreifte. Wie das der Zufall nun so fügt, verliebte sich Jost unter den mehreren Millionen Mädchen, in die er sich hätte verlieben können, in keine andere als gerade in jenes Mädchen, das in einem dichten Forst lebte und in das er sich am wenigsten von allen hätte verlieben dürfen. Er liebte sie mit namenloser Leidenschaft, und als er erfuhr, dass sie seine Schwester sei, besann er sich daher rasch auf eine gewisse Magdalena, die im Bürgermeisterhause zu Marienburg in Züchten vegetierte, und näherte sich jetzt dieser mit inniger Aufrichtigkeit. Zugleich liebte glücklicherweise der Bruder dieses Marienburger Mädchens – die Sache ist etwas verzwickt – die Schwester dessen, der nun seine Schwester liebte. Zugleich beging der Bürgermeister einen Meineid. Zugleich feierte die verstoßene Waldfrau ein Wiedersehen mit ihrem alten Tilemann. Zugleich feierte ebendieselbe ein Wiedersehen mit ihrem alten Verführer. Zugleich wurde der Hochmeister von der Marienburg verjagt. Zugleich lernte ebenderselbe seine uneheliche Tochter kennen. Zugleich wurde eine Verschwörung zur Wiedereroberung der Marienburg ins Werk gesetzt. Zugleich wurde ein Toast auf die Hohenzollern ausgebracht, welche dereinst – u. s. w. Kurz, es ist ein sinniges Stück.
Als dieses Drama – halb dramatisierter [Volks- und Jugendschriftsteller Gustav] Nieritz halb dramatisierter [Butzenscheibendichter] Julius Wolff, ein bisschen Kolportage, ein bisschen [Historiendramatiker] Wildenbruch, und alles umwittert vom poesieverlassensten Philistertum –, als das im Berliner Theater gespielt wurde, sah alles nach der linken Proszeniumsloge, ob der Kaiser anwesend sei. Denn der Kaiser hat den Verfasser einmal ausgezeichnet: wegen des Schauspiels »Aus eigenem Recht«; das ist also gewiss ein gutes Stück, ich kenne es nicht. Und dem ganzen Abend gab dies die Signatur: das einzige Interesse, ob der Kaiser da sei, ob nicht, ob er kommen würde, ob nicht. Das scheint merkwürdig. Aber in Wirklichkeit liegen die Dinge in Deutschland jetzt so, dass das ganze Schicksal eines Kunstwerks und eines Künstlers wesentlich beeinflusst werden kann von dem Maß der Teilnahme, das ihm der Kaiser bekundet. Deshalb wohl die Neugierde. Das haben verschiedene Dramatiker erfahren, und in dieser Saison bekanntlich zwei: Herr [Carl] Niemann und Herr [Richard] Skowronnek. Herr Niemann schrieb sein Dessauer Stück, das recht nett und kurzweilig ist; Herr Skowronnek schrieb das Lustspiel »Halali«, über das ich mich des Urteils enthalten will. Beide hätten nicht so glatte Triumphzüge über die deutschen Bühnen erlebt, wenn nicht die kaiserliche Empfehlung ihnen den Weg gebahnt hätte. »Es ist ein Stück, das man durch drei Bohlen hindurch loben muss«, sagte ja der Monarch zu Herrn Niemann; und auch Herr Skowronnek hörte recht freundliche Worte. Seitdem sind die beiden plötzlich obenauf. Die Berliner Direktoren und die Theateragenten – die leidigen Organisatoren des Erfolgs, reißen sich um sie. Vorher konnten beide mit ihren Musenkindern hausieren gehen. Da diese beiden Herren, die Genossen des Dichters Wichert, wahrscheinlich auf dem literarischen Markt noch eine Zeitlang eine Rolle spielen werden, zeichne ich sie gleichfalls nach. Persönlich sind beide sehr nett. Skowronnek ist ein alter Corpsstudent mit zerhaunem Gesicht, und durch sein ganzes, offenes Wesen leuchtet ein gemütlicher Bierhumor, halb ein Rest studentischer Tage, halb ein Ergebnis seiner ostpreußischen Abstammung. Der großgewachsene Mann, der nicht viel über dreißig zählt, ist der beste und renommierteste Witzeerzähler der Berliner Schriftstellerwelt, und wenn er nach einem Souper der vornehmen »literarischen Gesellschaft« im Palasthotel loslegt, hocken alle um ihn herum – auch [Friedrich] Spielhagen und [Karl Emil] Franzos, [Hermann] Sudermann und Max Halbe, der Kammergerichtsrat Wichert und der General von Dincklage –, und sie horchen und schreien vor Lachen. Niemann ist stiller. Er ist kein Witzerzähler, er ist ein Humorist. Ein schmächtiger, blasser, recht lebendiger Herr, dem man seine vierzig Jahre nicht ansieht. Er ist in seiner leise-humoristischen, herzlichen Art ein unendlich fesselnder Mensch; und wenn er mit seinem dessauischen Accent gewisse Bemerkungen macht, halb gutmütig, halb karikierend, spürt man einen Humor von dieser Persönlichkeit ausgehen, der viel hinreißender und überwältigender ist als das bisschen, das er in seinem Stück zum Besten gab. Skowronnek hat ein hübsches, frisches, knochiges Gesicht, das er zeitweise durch ein Monocle verschönt; Niemanns geistvolles Antlitz ist ein klein wenig abgelebt. So sehen zwei künftige deutsche Dioskuren aus.
Wenn Herr Wichert der Dritte im Bunde ist, ist Frau Vilma Parlaghi die Vierte. Wie der poetische Kammergerichtsrat ist auch sie jetzt wieder – das wievielte Mal? – in aller Munde. Natürlich wegen der ausgestellten hundertundvier Bilder, welche der Kaiser besichtigt hat. Ich habe die Bilder nicht gesehen und könnte sie daher rezensieren; aber mich interessiert wieder vorwiegend die Persönlichkeit. Man trifft sie oft genug da, wo die westliche Gesellschaft verkehrt. Eine gut gebaute, ziemlich auffallende Erscheinung, mit einem Stich ins Hoheitsvolle in der Haltung, mit regelmäßigen, etwas kalten Zügen; die ganze Person etwas angedunkelt. Mit unleugbar fürstlichem Anstrich rauscht sie durch Theaterfoyers und Gesellschaftsräume, und ihre Toiletten zeigen jenen spezifischen Geschmack, den man im westlichen Berlin an Künstlerfrauen oft trifft: ein Gemisch von raffinierter Einfachheit und dreister Originalität. Im Ganzen, das muss ihr der Neid lassen, ist sie eine ungewöhnlich gewandte Frau, ein entwicklungsfähiges Geschöpf, das wahrhaftig mehr Künste versteht als bloß malen. Sie hat es ja gezeigt! Sie ist in Mußestunden eine tüchtige Privatschauspielerin, die auf einer kleinen Hausbühne gelegentlich ihre Freunde entzückt. Und von der Diplomatie hat sie offenbar nicht nur die Anfangsgründe weg. Dass sie ihre Bilder zum Besten der protestantischen Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche ausstellt, ist wieder ein interessanter Zug, und es ist anzunehmen, dass er nicht unbelohnt bleiben wird. Sie selbst ist freilich Katholikin. Vor einiger Zeit gab sie den israelitischen Glauben ihrer Väter, in dem sie großgezogen wurde, auf und verleibte sich der römischen Kirche ein. Die Eltern waren einfache, wackere Leute aus Ungarn. Auch den Namen Parlaghi führt sie, wie der Kammergerichtsrat Wichert sagen würde, aus eigenem Recht, aus euphonischen Rücksichten. Der Energie und der taktischen Klugheit der Frau wird man jedenfalls eine gewisse Bewunderung nicht versagen können.