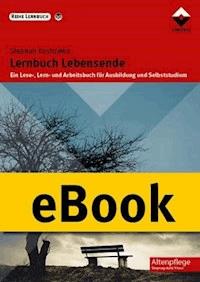35,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe, vorm. Verlag Hans Huber
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Wie können wir Menschen mit geistiger Behinderung am Lebensende begleiten? Menschen mit geistiger Behinderung werden in Deutschland immer älter, pflegebedürftiger und versterben zunehmend in Ïnstitutionen. Diese neue Situation wirft viele Fragen auf: Welche Vorstellungen haben Menschen mit geistiger Behinderung vom Sterben? Sollten Mitarbeiter dieses schwierige Thema mit ihren Bewohnern ansprechen? Wie verarbeiten Menschen mit geistiger Behinderung das Sterben von Mitbewohnern? Wie können Konzepte der Hospizarbeit und Palliativversorgung auf Menschen mit geistiger Behinderung übertragen werden? Wie lässt sich ein Palliativkonzept in einer Einrichtung der Behindertenarbeit erarbeiten, einführen und verstetigen? Antworten auf diese Fragen gibt der erfahrene Autor und Dozent Stephan Kostrzewa. In verständlicher Sprache führt er Heimleitende, Heilpädagogen, Heilerziehungspflegende, Pflegefachpersonen, Pflegeassistenten sowie Seelsorgende und Sozialarbeitende in der Welt der Palliative Care für Menschen mit einer geistigen Behinderung ein. In der zweiten Auflage zeigt der Autor, wie das neue Hospiz- und Palliativgesetz umgesetzt wird und man besser mit dem Hausarzt zusammenzuarbeitet. Er beschreibt, wie Wünsche und Bedürfnisse zum Sterben von alten Menschen mit geistiger Behinderung erfasst werden und wie der Expertenstandards zur "Beziehungsgestaltung bei Menschen mit Demenz" wird für die Behindertenarbeit angepasst wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 365
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Menschen mit geistiger Behinderung palliativ pflegen und begleiten
Menschen mit geistiger Behinderung palliativ pflegen und begleiten
Stephan Kostrzewa
Wissenschaftlicher Beirat Programmbereich Pflege:
Jürgen Osterbrink, Salzburg; Doris Schaeffer, Bielefeld;
Christine Sowinski, Köln; Franz Wagner, Berlin; Angelika Zegelin, Dortmund
Wissenschaftlicher Beirat Programmbereich Palliative Care:
Christoph Gerhard, Dinslaken; Markus Feuz, Zürich
Stephan Kostrzewa
Menschen mit geistiger Behinderung palliativ pflegen und begleiten
Palliative Care und geistige Behinderung
2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage
Stephan Kostrzewa. Dipl. Sozialwissenschaftler, Altenpfleger, Organisationsberater und Projektbegleiter.
Wallstraße 4, DE-45468 Mühlheim an der Ruhr
E-Mail: [email protected]
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autoren bzw. den Herausgebern große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autoren bzw. Herausgeber und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.dnb.de abrufbar.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Anregungen und Zuschriften bitte an:
Hogrefe AG
Lektorat Pflege
z.Hd.: Jürgen Georg
Länggass-Strasse 76
3012 Bern
Schweiz
Tel. +41 31 300 45 00
www.hogrefe.ch
Lektorat: Jürgen Georg, Valeria Barucci, Linnéa Hölterhoff, Lena-Marie Klose
Herstellung: René Tschirren
Umschlagabbildung: Getty Images/LPETTET
Umschlag: Claude Borer, Riehen
Illustrationen (Innenteil): Peter Kuliew, Basel
Satz: punktgenau GmbH, Bühl
Format: EPUB
2., vollst. überarb. u. erw. Auflage 2020
© 2020 Hogrefe Verlag, Bern
© 2013 Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern
(E-Book-ISBN_PDF 978-3-456-95954-2)
(E-Book-ISBN_EPUB 978-3-456-75954-8)
ISBN 978-3-456-85954-5
http://doi.org/10.1024/85954-000
Nutzungsbedingungen:
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden.
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Audiodateien.
Anmerkung:
Sofern der Printausgabe eine CD-ROM beigefügt ist, sind die Materialien/Arbeitsblätter, die sich darauf befinden, bereits Bestandteil dieses E-Books.
Inhalt
Inhalt
Widmung
Vorwort
Vorwort zur 2. Auflage
Einleitung
Federleicht
Was mein Leben reicher macht
1. Sichtweisen und Konzepte der Behindertenarbeit im Wandel
1.1 Historische Betrachtungsweisen von und Umgang mit Behinderung
1.2 Behindertenarbeit und das Älterwerden ihrer Klientel
1.3 Heilerziehungspflege als Antwort auf erhöhten Pflegebedarf?
1.4 Schnittmenge und Parallelität mit/zur Altenpflege
2. Behinderten-Wohnstätten als Orte zum Sterben?
2.1 Sind Orte des Lebens auch Orte zum Sterben?
2.2 Das Krankenhaus als Ort ohne Wiederkehr
2.3 Anforderungen an einen Ort zum Sterben
3. Sterbeprozess und Todeskonzept bei Menschen mit geistiger Behinderung
3.1 Ist das Kübler-Ross-Modell für die Behindertenarbeit geeignet?
3.1.1 Die eigentliche Kritik an diesem Modell
3.1.2 Kritik am Übertrag des Modells auf Menschen mit geistiger Behinderung
3.2 Das reife Todeskonzept
3.3 Was wissen Menschen mit geistiger Behinderung über das Sterben?
3.3.1 Erhebung des Todeskonzepts im Rahmen eines Palliativprojekts
3.3.2 Fremdbild über das Todeskonzept von Menschen mit geistiger Behinderung
3.3.3 Erheben von Lebenssinn bei Menschen mit geistiger Behinderung
3.3.4 SMILE und Menschen mit geistiger Behinderung
4. Exkurs: Menschen mit geistiger Behinderung und Demenz
4.1 Demenzen: Formen – Verlauf – Symptome
4.1.1 Formen der Demenz
4.1.2 Ist die Alzheimer-Krankheit überhaupt eine Krankheit?
4.1.3 Die Medizin produziert Krankheiten
4.1.4 Demenz als Gespenst?
4.2 Der Verlauf einer Alzheimer-Demenz
4.2.1 Das Vorstadium
4.2.2 Die begleitungsbedürftige Phase
4.2.3 Die versorgungsbedürftige Phase
4.2.4 Die Phase der Pflegebedürftigkeit
4.2.5 Palliativbedarf bei Demenz
4.3 Das Problem der Diagnostik
4.4 Sind Förderkonzepte für Menschen mit geistiger Behinderung und Demenz geeignet?
4.4.1 Von der Inklusion zur Segregation?
4.4.2 Wohlbefinden – der gemeinsame Nenner
4.5 Der person-zentrierte Ansatz nach Tom Kitwood
4.5.1 Bedürfnisorientierung
4.5.2 Eine person-zentrierte Pflege
4.5.3 Schlüsselindikationen für den sozialen Umgang
4.5.4 Die maligne, bösartige Sozialpsychologie
4.5.5 Unterstützen des Person-Seins bei Menschen mit Demenz
4.5.6 Kommunikation mit Menschen mit geistiger Behinderung und Demenz
4.5.6.1 Zu Beginn: geduldiges Wiederholen
4.5.6.2 In der mittleren Phase: Validation
4.5.6.3 Im weit fortgeschrittenen Stadium: körpernaher Dialogaufbau
4.5.6.4 Körpernaher Dialogaufbau
4.6 Der Nationale Expertenstandard «Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz»
5. Palliativversorgung und Hospizarbeit – eine Idee setzt sich durch
5.1 Palliative Care und Hospizarbeit im Wandel der Zeit
5.2 Erweiterte Adressatengruppen
5.3 Projekte und Modelle der Palliativversorgung von Menschen mit Behinderung
5.4 Weiterbildung «Palliative Care» und Menschen mit geistiger Behinderung
5.5 Angehörige und Betroffene als gemeinsame Adressaten der Palliative Care
5.6 Seelsorge und Spiritualität
6. Palliativversorgung von Menschen mit geistiger Behinderung
6.1 Palliativbedarf von Menschen mit geistiger Behinderung
6.2 Ausgewählte Symptome und entsprechende Maßnahmen
6.2.1 Linderung bei Schmerzen
6.2.2 Das Total-Pain-Konzept
6.2.3 Schmerzmanagement bei Menschen mit geistiger Behinderung
6.2.3.1 Grundlagen einer kunstgerechten Schmerztherapie
6.2.3.2 Zielgruppenspezifische Schmerzerfassung
6.2.3.3 Schmerzerfassung bei bewusstseinseingeschränkten Menschen
6.2.3.4 Beurteilung von Schmerzen bei Demenz
6.2.3.5 ZOPA© für die Fremdbeobachtung
6.2.3.6 Schmerzerfassung über Fremdbeobachtung bei Menschen mit Mehrfachbehinderung
6.2.3.7 Das WHO-Stufenschema
6.2.3.8 Grundsätze einer kunstgerechten Schmerztherapie
6.2.3.9 Verfahrensregelung des Schmerzmanagements
6.2.3.10 Nichtmedikamentöse Maßnahmen zur Schmerzreduktion
6.2.4 Symptomlinderung bei Atemnot
6.2.4.1 Atemstimulierende Einreibung bei Atemnot
6.2.4.2 Vorsicht mit Sauerstoff und Infusionen
6.2.5 Symptomlinderung bei Übelkeit und Erbrechen
6.2.5.1 Nichtmedikamentöse Interventionen
6.2.5.2 Übelkeit durch Opioide
6.2.6 Ablehnen von Flüssigkeit und Nahrung
6.2.7 Schluckstörungen und Aspiration
6.2.8 Symptomlinderung bei Durst und Mundtrockenheit
6.2.8.1 Nichtmedikamentöse Interventionen
6.2.8.2 Mullkompresse bei Aspirationsgefahr
6.2.9 Symptomlinderung bei Angst und Unruhe
6.2.9.1 Nähe und Erreichbarkeit
6.2.9.2 Medikamentöse Interventionen
6.2.9.3 Angst und Unruhe bei Bewohnern mit geistiger Behinderung und Demenz
6.2.9.4 Beruhigung über Basale Stimulation®
6.2.10 Symptomlinderung bei Hautjucken (Pruritus)
6.2.10.1 Nichtmedikamentöse Interventionen
6.2.10.2 Medikamentöse Interventionen
6.2.11 Symptomlinderung bei Todesrasseln
6.2.11.1 Kein Einsatz von Absauggeräten
6.2.11.2 Nichtmedikamentöses Vorgehen
6.2.11.3 Medikamentöse Intervention
6.2.12 Epileptische Anfälle
6.2.13 Symptomlinderung bei Verwirrtheit und Delir
6.2.13.1 Begleitung der Angehörigen
6.2.13.2 Das präfinale Delir
6.2.14 Symptomlinderung bei Verstopfung (Obstipation)
6.3 Palliative Fallarbeit mittels Kollegialer Beratung
6.4 Basale Stimulation® in Palliativversorgung und Sterbebegleitung
6.4.1 Zielgruppen der Basalen Stimulation®
6.4.2 Mangel benennen und Ziele festlegen
6.4.3 Wahrnehmungsveränderungen bei Sterbenden
6.4.4 Ursachen von Wahrnehmungsstörungen
6.4.5 Konkrete Maßnahmen der Basalen Stimulation®
6.4.5.1 Optische Stimulation
6.4.5.2 Akustische Stimulation
6.4.5.3 Somatische Stimulation
6.4.5.4 Olfaktorische Stimulation
6.4.5.5 Taktil-haptische Stimulation
6.4.5.6 Orale Stimulation
6.4.5.7 Vibratorische Stimulation
6.4.5.8 Vestibuläre Stimulation
6.4.6 Bedürfniserfassung als Voraussetzung für Basale Stimulation®
6.4.7 Initialberührung
6.4.8 Der kommunikative Charakter von Berührung
6.4.9 Basale Stimulation® als integraler Bestandteil der Sterbebegleitung
6.4.10 Die beruhigende Ganzkörperwaschung
6.4.11 Spezielle Mundpflege mithilfe der Basalen Stimulation®
6.4.12 Sicherheit über Nestbau
7. Ethik in der palliativen Versorgung von Menschen mit geistiger Behinderung
7.1 Philosophische Ethik beeinflusst unsere Werte und Normen
7.2 Modelle der ethischen Fallarbeit
7.3 Zukunftsplanung als Möglichkeit einer Patientenverfügung?
7.4 Patienten-Anweisung für lebenserhaltende Maßnahmen (PALMA)
7.5 Eine palliative Haltung
8. Projekt «Alsbachtal» Palliativversorgung in einer Wohnstätte für Menschen mit geistiger Behinderung
8.1 Die Ausgangssituation
8.2 Vorabsprachen
8.3 Ist-Standerhebung
8.4 Schulungen und Begleitungen
8.5 Befragungen zum Todeskonzept
8.6 Fallbezogene praktische Anwendung
8.7 Verstetigung von Palliative Care
8.8 Palliativkonzept im Rahmen eines Gesamtkonzepts
9. Trauerarbeit und Abschiedskultur
9.1 Trauerarbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung
9.2 Gemeinsame Trauer hilft Mitarbeitern und Mitbewohnern
9.3 Versorgung und Aufbahrung des Verstorbenen
9.3.1 Das Ritual der Aufbahrung
9.3.2 Das «Leben» der Leiche
10. Netzwerkarbeit und Angehörigenintegration
10.1 Palliative Überleitung
10.2 Zusammenarbeit mit der Hospizinitiative
10.3 Unterstützung durch SAPV
10.4 Standard für die Zusammenarbeit mit den Bestattern
10.5 Angehörigenintegration
10.5.1 Informationsschriften für Angehörige
10.5.2 Sterbebegleitung durch Angehörige
10.5.3 Gedenktreffen für Angehörige
10.6 Einsatz von ehrenamtlichen Helfern
10.6.1 Einsatzplanung von Ehrenamtlichen
10.6.2 Nichteignung eines Ehrenamtlichen
10.7 Gesetzliche Betreuer in der Palliativversorgung
10.8 Das Hospiz- und Palliativgesetz (HPG)
11. Hilfen für Helfer
11.1 Auch Profis haben Ängste und Befürchtungen
11.2 Einarbeitung neuer Mitarbeiter in das Palliativkonzept
11.3 Emotionen dürfen sein
11.4 Rituale für Mitarbeiter
12. Palliative Care Mapping in Wohnstätten für Menschen mit Behinderung
12.1 Wie funktioniert die Methode des PCM?
12.2 Checkliste zur Ist-Standerhebung© (CIS)
12.3 Instrument zur Einschätzung einer würdevollen Sterbebegleitung© (IEES)
12.4 Reflexionsbogen zur rückschauenden Überprüfung eines Sterbebegleitungsprozesses in der Wohngruppe© (RÜS)
12.5 Ergänzende Instrumente für die Ist-Standerhebung
12.5.1 Bewohner-FrageBogen© (BFB)
12.5.2 Angehörigen-FrageBogen© (AFB)
12.6 Das PCM im Rahmen des Projektmanagements
13. Projektplanung und -durchführung
13.1 Leitung und Mitarbeiter überzeugen
13.2 Die Projektgruppe
13.3 Inhouse-Schulungen und externe Fortbildungen
13.3.1 Weitere hilfreiche Tipps
13.3.2 Bewertung der Inhouse-Schulung
13.3.3 Fallbesprechungen und Reflexionsgespräche
13.4 Leitbildarbeit
14. Aussichten und Visionen – Behindertenhilfe und Altenpflege gemeinsam
Anhänge
Anhang 1 – Gesprächsleitfaden zum Lebensende
Anhang 2 – Konzeption der Palliativversorgung in der Wohnstätte Alsbachtal
Anhang 3 – Checkliste zur Ist-Standerhebung© (CIS)
Anhang 4 – Instrument zur Erhebung der Einschätzung einer würdevollen Sterbebegleitung© (IEES)
Anhang 5 – Reflexionsbogen zur rückschauenden Überprüfung eines Sterbebegleitungsprozesses in der Wohngruppe© (RÜS)
Anhang 6 – Bewohner-FrageBogen© (BFB)
Anhang 7 – Angehörigen-FrageBogen© (AFB)
Literaturverzeichnis zum Text
Literaturliste «Basale Stimulation» im Hogrefe Verlag:
Literaturliste «Pflege von Menschen mit Behinderungen» im Hogrefe Verlag:
Deutschsprachiges Literaturverzeichnis zur Palliative Care
Deutschsprachiges Adressen- und Linkverzeichnis
Kontaktadressen und Hilfsorganisationen
Deutschland
Österreich
Schweiz
Internetadressen
Seminarangebote
Beratung und Patientenverfügung
Weiterführende Informationen
Autorenprofil
Sachwortverzeichnis
Medikamente und Substanzen
Widmung
«… und als es denn so weit war, dass es ans Handeln ging, da machten sich die ersten aus dem Staub. Weitere spotteten über das Unterfangen und andere winkten nur ab. So blieben denn beide allein zurück. Sie schauten sich an, hoben das Kinn, breiteten die Arme langsam aus, als wollten sie fliegen. Schon hob die Busuki mit dem bekannten Tanz an und, beide machten gleichzeitig einen Schritt vorwärts.»
Danke Alice
Vorwort
Aus der Begleitung verschiedener Wohnstätten von Menschen mit geistiger Behinderung erlebe ich, dass sich nur wenige Häuser konkret auf den Weg gemacht haben, das Lebensende ihrer Bewohner mit geistiger Behinderung palliativ zu begleiten. In entsprechenden Projektbegleitungen fällt dabei immer wieder auf, dass eine zu gestaltende Palliativversorgung «klassische» Konzepte der Behindertenarbeit infrage stellen. Hier gilt es nun Antworten zu finden, die rasch umsetzbar und handhabbar sind, denn Menschen mit geistiger Behinderung werden in Deutschland immer älter, pflegebedürftiger und versterben zunehmend in Wohnstätten für Menschen mit geistiger Behinderung, in Altenpflegeheimen oder im Krankenhaus.
Zurzeit besteht ein großer Schulungsbedarf für den Umgang mit Menschen mit geistiger Behinderung, die zusätzlich eine Demenz entwickelt haben. Hier gelangen klassische Förderkonzepte rasch an ihre Grenzen. Neue Ansätze müssen geschaffen werden, um dieser Klientel gerecht zu werden, oder man bedient sich aus den Erfahrungen im Umgang mit Menschen mit Demenz in der stationären Altenpflege.
Die Gestaltung des Lebensendes von Menschen mit geistiger Behinderung ist eine Herausforderung. Hier ringen Träger und Teams der Behindertenarbeit mit grundsätzlichen Fragestellungen:
Was weiß ein Mensch mit geistiger Behinderung vom Sterben?Sollten Mitarbeiter dieses schwierige Thema mit ihren Bewohnern überhaupt ansprechen?Wie verarbeiten Menschen mit geistiger Behinderung das Sterben anderer Personen, denn hiermit sind sie ja regelmäßig konfrontiert?Haben Menschen mit geistiger Behinderung Vorstellungen über ihr eigenes Sterben, und wie können wir diese erheben?Können Konzepte der Hospizarbeit und Palliativversorgung auch auf Menschen mit geistiger Behinderung übertragen werden?Wie lässt sich ein Palliativkonzept in einer konkreten Einrichtung der Behindertenarbeit erarbeiten, implementieren und verstetigen?Diese Fragen werden in dem vorliegenden Buch bearbeitet und beantwortet. Dabei stützt sich die hier vorliegende Publikation auf konkrete Projekte, die aufzeigen sollen: Ja, Palliativversorgung bei Menschen mit geistiger Behinderung ist notwendig und machbar!
Das Buch, dass Sie als Leser in den Händen halten, konnte nur geschrieben werden, weil mir viele Ideen, praktische Anwendungen und einzelne «Fälle» von verschiedenen Seiten der Behindertenarbeit zugetragen bzw. im Rahmen von Projektbegleitungen angewendet wurden. Insbesondere gilt hier mein Dank der Wohnstätte Alsbachtal gGmbH in Oberhausen (Rheinland). Der Träger (in Person des Geschäftsführers Herrn Wörmann), der Einrichtungsleiter (Herr Sayim), die Bewohner und die tollen Mitarbeiter haben den «Sprung» in das unbekannte Wasser der Palliativversorgung mutig und kreativ unterstützt und möglich gemacht. Ohne ihre über 2-jährige Unterstützung hätte die vorliegende Arbeit nicht erstellt werden können.
Andere Einrichtungen, die ich bezüglich der Erarbeitung eines Palliativkonzeptes im Vorfeld kontaktiert habe, haben ablehnend, feindlich (?) oder in der Weise reagiert, dass zurzeit andere Fragestellungen vorrangig seien. Hier sind die Themen «Demenz» und «Umgang mit Menschen mit geistiger Behinderung in der Rente» zurzeit dringlicher. Das Sterben in der Wohnstätte ist zurzeit «noch» ein marginales Thema, doch die demographische Entwicklung wird in naher Zukunft von den Trägern der Wohnstätten konkrete Lösungen und praktikable Ansätze der Sterbebegleitung und Palliativversorgung verlangen.
Mein Dank gilt auch den vielen Mitarbeitern aus Inhouse-Schulungen und Fortbildungen, die sich bereitwillig mit dem «Palliativvirus» infizieren ließen. Denn was bringt eine Idee oder ein Konzept, wenn sie nicht von konkreten Personen in konkreten Strukturen gelebt wird?
Dem Leser, der sich auf den Weg machen möchte, konkrete palliative Ansätze in der eigenen Einrichtung umzusetzen, wünsche ich mit diesem Buch, dass er hierin Substanz, Hilfestellung und Inspiration erfährt. Selbstverständlich sollen sich auch Leserinnen angesprochen fühlen. Der Lesbarkeit wegen, wähle ich aber die männliche Form, wohl wissend, dass in dem Arbeitsfeld mehrheitlich Frauen tätig sind.
Mülheim an der Ruhr, Februar 2013
Vorwort zur 2. Auflage
Es erfüllt den Autor eine große Freude, wenn sein Werk erneut verlegt werden soll. Hierzu ist es notwendig, die erste Ausgabe aus heutigem Blick zu sichten. Dieses bedeutet ganz praktisch zu schauen, was zwischenzeitlich an zusätzlichem Zugewinn in der Szene entstanden ist und inwieweit damalige Positionen vor dem Hintergrund des aktuellen Wissens noch haltbar sind.
Hier sind es vor allem zwei Entwicklungen, die erwähnt werden müssen. Zum einen das sogenannte Hospiz- und Palliativgesetz (kurz: HPG) und ein Nationaler Expertenstandard (DNQP) mit dem behäbigen Titel «Beziehungsgestaltung in Pflege von Menschen mit Demenz» (DNQP 2018).
Beide Ereignisse waren im Sommer 2013 (Erscheinungsjahr der ersten Auflage) nicht vorauszusehen und zeigen im Nachgang klar und deutlich auf: Es tut sich etwas!
Palliative Care und Hospizarbeit finden Niederschlag in der deutschen Gesetzeslandschaft und stehen hierüber allen gesetzlich Versicherten (zumindest theoretisch) als Leistungsanspruch zur Verfügung – selbstredend auch Menschen mit geistiger und Mehrfachbehinderung. Inwieweit dieses dann ganz praktisch vor Ort als reales Angebot zur Verfügung steht, muss die weitere Zukunft zeigen.
Für den Autor waren insbesondere die vorrangehenden Debatten im Deutschen Bundestag (Herbst 2015) besonders ermutigend (insbesondere wegen der viel diskutierten Politikverdrossenheit in der Bevölkerung), denn hier hat sich das Parlament von seiner menschlichen Seite (losgelöst von jeglichem Fraktionszwang) gezeigt, was nicht häufig zu erleben ist.
Der Nationaler Expertenstandard «Beziehungsgestaltung in Pflege von Menschen mit Demenz» widmet sich erstmalig einer extrem vulnerablen Personengruppe, nämlich den Menschen mit Demenz. Hier stehen also nicht einzelne Symptome und Defizite im Fokus eines Expertenstandards, sondern eine komplette Personengruppe, die extrem abhängig ist von einer verstehenden Haltung durch professionelle Begleiter.
Leider ist dieser Expertenstandard in einem Sprachstil abgefasst, der die eigentlichen Anwender und Adressaten ausgrenzt. Das ist schade und es provoziert Ärger, denn Wissenschaft und praktische Anwendung könnten eine gute Symbiose eingehen, wenn beide dieselbe Sprache sprechen.
Beide hier angesprochenen Entwicklungen finden sich nun in dieser zweiten Auflage wieder. Zudem ist die aufgeführte Literatur durch aktuelle Publikationen ergänzt worden. Auch hier zeigt sich deutlich im Feld: Es tut sich etwas! Das wiederum ist ermutigend.
Mülheim an der Ruhr, Oktober 2019
Einleitung
In der Behindertenarbeit sind viele Mitarbeiter beschäftigt, die eine pädagogische Ausbildung haben (z.B. Erzieher, Pädagogen, Sozialpädagogen). Zunehmend werden aber neben Heilerziehungspflegern auch Alten- und Krankenpflegemitarbeiter beschäftigt. Diese Tendenz folgt zwingend dem demographischen Wandel auf Seiten der Menschen mit geistiger Behinderung, die in Wohnstätten für Menschen mit geistiger Behinderung leben. Diese werden nämlich zunehmend älter und gerontologische, geriatrische und palliative Fragestellungen stehen mittlerweile überdeutlich im Raum.
Auffällig ist, dass nur wenige der Mitarbeiter im Rahmen ihrer Ausbildungen entsprechend auf das Themenfeld «Sterben, Sterbebegleitung und Palliativversorgung» vorbereitet wurden. Fehlt bei vielen pädagogischen Mitarbeitern schon ein Grundstock an pflegerischem Wissen – obwohl sie pflegerische Aufgaben übernehmen müssen – kann erst recht auf kein Grundlagenwissen in Palliative Care verwiesen werden. Dementsprechend wird Sterbebegleitung dann zu einer Herausforderung in den Wohngruppen, bei der improvisiert wird, oder sie wird dem Krankenhaus überantwortet.
Gleiches ergibt sich, wenn wir uns mit den behandelnden Hausärzten beschäftigen, denn sie sind mit der palliativmedizinischen Versorgung überfordert. Grundlagenwissen zur Palliativmedizin wird nämlich erst seit 2010 in Deutschland im Rahmen des Medizinstudiums vermittelt.
Auch in der Qualifikation zum Palliativmediziner (in Deutschland 40 Unterrichtsstunden) werden Menschen mit geistiger Behinderung mit ihren spezifischen Anforderungen insbesondere am Lebensende gar nicht erst thematisiert. Das bedeutet: Viele Hausärzte und auch Palliativmediziner haben keine Erfahrungen in der Palliativversorgung von Menschen mit geistiger Behinderung und stützen dadurch deren palliativmedizinische Unterversorgung.
Das vorliegende Buch hat das zentrale Anliegen, ...
… Mitarbeitern der Wohnstätten für Menschen mit geistiger Behinderung das Konzept der Palliativversorgung näher zu bringen.… den Mitarbeitern Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie als Team und in Zusammenarbeit mit weiteren Professionen eine individuelle Palliativversorgung für ihre Bewohner organisieren können.… den Palliativbedarf ihrer Bewohner zu erheben, die Wünsche und Bedürfnisse der Bewohner zu erfassen.… insbesondere pädagogischen Mitarbeitern die pflegerische Seite der Palliativversorgung näherzubringen, so dass auch sie einzelne Palliativmaßnahmen durchführen können.… grundsätzlich deutlich zu machen, dass das Palliativkonzept pädagogische und medizinisch-pflegerische Professionen wunderbar zusammenführen kann.… externe Anbieter von Palliativversorgung und Begleitung im Sterben einzubeziehen.… Angehörige der Bewohner aktiv in das Palliativkonzept zu integrieren.… als Mitarbeiter die eigenen Belastungen besser zu erkennen und konstruktiv damit umzugehen.Zum Grundverständnis einer Palliativversorgung zählt, dass sie sich an den Bedürfnissen der zu versorgenden Menschen orientiert. Die Betroffenen haben hierüber die Möglichkeit, die Regie für ihr eigenes Sterben zu erhalten.
Damit der Leser ungefähr einschätzen kann, auf welche Reise er sich beim Lesen des Buches begibt, sollen hier kurz die einzelnen Kapitel mit ihren Themenschwerpunkten aufgeführt werden.
Zu Beginn geht es in einem kurzen Abriss darum aufzuzeigen, wie sich die Behindertenarbeit in Deutschland entwickelt hat. Dies wird dann anhand der demographischen Entwicklung und der daraus erwachsenden gesellschaftlichen und möglicherweise auch palliativen Anforderungen problematisiert.
Dann wird die Wohnstätte für Menschen mit Behinderung als Ort des Sterbens problematisiert. Hier gilt es klassische Förder- und Versorgungskonzepte in der Behindertenarbeit auf eine mögliche Palliativversorgung hin zu untersuchen.
Was Menschen mit geistiger Behinderung bezogen auf ihr Sterben und ihren Tod wissen, behandelt das nächste Kapitel. Hier haben in den vergangenen Jahren erweiternde Erkenntnisse eine neue Sichtweise ermöglicht.
Im folgenden Exkurs wird der Zusammenhang zwischen geistiger Behinderung und einer sich zusätzlich entwickelnden Demenz thematisiert. Denn hierin liegt eine aktuelle Herausforderung in vielen Wohnstätten für Menschen mit geistiger Behinderung. Auch (oder insbesondere) diese Menschen müssen bei einer guten Palliativversorgung berücksichtigt werden. Da dieses Thema zurzeit viele Einrichtungen für Menschen mit geistiger Behinderung beschäftigt, wird es einen entsprechend breiten Raum einnehmen, so dass auch in den weiteren Kapiteln immer wieder Verweise auf den Menschen mit geistiger Behinderung und Demenz auftauchen.
Was Palliative Care überhaupt ist und woher dieser Ansatz stammt soll im Weiteren dargestellt werden. Es soll deutlich gemacht werden, dass Palliativversorgung und Hospizarbeit Konzepte sind, die überall dort gelebt werden können, wo Menschen ihrer bedürfen.
Einzelne Palliativmaßnahmen bei verschiedenen Symptomen sind das nächste Thema. Vor allem das Schmerzmanagement gilt es intensiv zu beleuchten. Damit individuelle Lösungen für einzelne palliative Bedarfe gefunden werden, wird dem Leser in diesem Kapitel zudem die Methode der Fallarbeit präsentiert. Sie zeigt auf, wie mit der gebündelten Kompetenz eines Teams ein passendes Palliativangebot erarbeitet werden kann.
Dass auch Ethik in der palliativen Versorgung von Menschen mit geistiger Behinderung eine wichtige Rolle spielt, wird in dem darauf folgenden Kapitel bearbeitet. Hier soll dem Leser aufgezeigt werden, dass Ethik im Alltag einer Wohnstätte ganz praktisch gelebt werden kann.
Da die hier aufgeführten Ansätze schon ganz basisnah und praktisch gelebt werden, soll Kapitel 8 über das Projekt Alsbachtal dem Leser die «Erdung» eines gelebten Palliativkonzepts verdeutlichen. In diesem Kapitel wird das 2-jährige Projekt vorgestellt, das in Oberhausen (Rheinland) durchgeführt wurde.
Palliativarbeit lebt von der Vernetzung mit weiteren externen Anbietern. Diese Möglichkeiten werden aufgeführt und in ihrem Potenzial bearbeitet.
Damit ein erarbeitetes Palliativkonzept dauerhaft gelebt werden kann, wird die Methode des Palliative Care Mapping für Wohnstätten für Menschen mit Behinderung vorgestellt. Es dient der Konzepterarbeitung, -implementierung und -verstetigung.
Möchten Sie sich auf den Weg machen und in Ihrer Einrichtung eine eigene Palliativversorgung «auf die Beine stellen», werden Sie in den abschließenden Kapiteln Tipps und Werkzeuge hierfür finden. Diese sind durch den Autor schon in verschiedenen Einrichtungen der Altenarbeit getestet und erweitert worden. Das Projekt Alsbachtal zeigt aber, dass sie auch in Wohnstätten für Menschen mit geistiger Behinderung angewendet werden können.
Im Text werden konkrete, reale «Fälle» präsentiert, damit der Leser erkennt, wie einzelne Ansätze der Palliativversorgung umgesetzt werden können. Außerdem werden dem anwendungsorientierten Leser Checklisten, Musterschreiben, Assessments, Schritt-für-Schritt-Anleitung und Übungen geboten, die in der Palliativversorgung bereits Anwendung finden. Literaturverweise an entsprechender Stelle ermöglichen es dem besonders interessierten Leser, sich noch weiter in das weite Feld der Palliativversorgung einzulesen.
Es wird auffallen, dass der Verfasser immer wieder von «Menschen mit geistiger Behinderung» spricht. Diese Formulierung bedarf der Erläuterung:
Den Menschen mit geistiger Behinderung gibt es nicht! Vielfältigkeit und Individualität machen selbstverständlich auch vor Menschen mit geistiger Behinderung nicht Halt.Die Formulierung soll verdeutlichen, dass «geistige Behinderung» nur ein einzelnes Merkmal ist, das aber nicht den gesamten Menschen als Person ausmacht. Daher wird konsequent der Begriff «Behinderte» vermieden,«Geistige Behinderung» ist ein unscharfer Begriff, der viele verschiedene Störungsbilder umfasst und somit eher heterogen als homogen zu verstehen ist.Mir als Autor ist es wichtig, das Verbindende und nicht das Trennende darzustellen, daher wird konsequent darauf verwiesen, dass «geistige Behinderung» nicht zwangsläufig das «Andere» ist, sondern viel Ähnliches und Gleiches beinhalten kann.Den hier abgefassten Inhalten wünsche ich, dass sie in entsprechenden Einrichtungen für Menschen mit geistiger Behinderung Anwendung finden, dass sich engagierte Mitarbeiter, mutige Träger und aufgeschlossene externe Mitstreiter zusammenfinden, um für Menschen mit geistiger Behinderung ein palliatives Klima zu schaffen, in dem diese dann ihren letzten Lebensweg umsorgt und ummantelt erleben dürfen.
Federleicht
Die Abbildungen zum Kapitelbeginn wurden inspiriert von folgender Geschichte:
Was mein Leben reicher macht
«Nachmittags an einer Münchner S-Bahn-Station. Meine Kollegin und ich stehen am Bahnsteig, haben einen erfolgreichen Termin hinter uns, lachen miteinander. Ein junger Mann freut sich an unserer Fröhlichkeit, lächelt mit, streicht um uns herum, beobachtet uns unverhohlen. Kurz darauf in de S-Bahn bemerke ich: Der junge Mann ist vermutlich geistig behindert. Mit unschuldiger Neugier schaut er uns durch dicke Brillengläser an, als wären wir seltene Schmetterlinge. Wir tun als beobachteten wir ihn nicht. Da löst sich eine Daunenfeder aus meiner Jacke und schwebt träge auf ihn zu. Ganz vorsichtig streckt er die Hand aus, fängt das flaumige Ding ein – und reicht es uns mit den freudigen Worten: ‹Ist das Ihr Fussel?›»
Inge Bell, München; Zeit-Kolumne
1. Sichtweisen und Konzepte der Behindertenarbeit im Wandel
Der Leser darf an dieser Stelle keinen kompletten historischen, soziologischen und kulturwissenschaftlichen Abriss der Behindertenarbeit erwarten. Das würde den Rahmen dieses Werkes sprengen. Nichtsdestotrotz sollen wichtige Einflussfaktoren aufgeführt werden, die auch heute noch bei der Betrachtung des Phänomens «geistige Behinderung» Widerhall finden.
Die Betrachtung von «Behinderung» war in den vergangenen Jahrhunderten einem steten Wandel unterworfen. Vor allem bei den geistigen Behinderungen erleben wir eine immer weniger diskriminierende Sichtweise. Riviere (zit. n. Bärsch, 1973: 7) hat, um den Begriff der «Behinderung» abzugrenzen und zu verdeutlichen, folgende weitere Unterkonzepte aufgeführt:
Schädigung (impairment) ist jede Abweichung von der Norm, die sich in einer fehlerhaften Funktion, Struktur, Organisation oder Entwicklung des Ganzen oder eines seiner Anlagen, Systeme, Organe, Glieder oder von Teilen hieraus auswirkt.
Behinderung (disability) ist jede Beeinträchtigung, die das geschädigte Individuum des gleichen Alters, Geschlechts und gleichem kulturellen Hintergrund vergleicht.
Benachteiligung (handicap) ist die ungünstige Situation, die ein bestimmter Mensch infolge der Schädigung oder Behinderung in den ihm adäquaten psychosozialen, körperlichen, beruflichen und gesellschaftlichen Aktivitäten erfährt.
(Bärsch, 1973: 7)
Diese in ihrem Wesen noch medizinisch-reduktionistisch anmutende Abgrenzung wird durch eine verstärkte Sicht auf sozial beeinflussende Faktoren von Paeslack erweitert:
Behinderung ist nicht in erster Linie ein Synonym für eine medizinische Diagnose, sondern ein umfassendes personales und soziales Geschehen. Behinderung stellt sich dar als ein auf mehreren Wirkungsebenen laufender Prozess. Diese Ebenen bezeichnen den unmittelbar aus dem klinischen Krankheitsgeschehen resultierenden Schaden (Impairment), die individuellen und funktionellen Einschränkungen mit der Folge von unterschiedlichen Fähigkeitsstörungen (Disability) und die soziale Beeinträchtigung (Handicap) und die sich daraus ergebenden vielfältigen persönlichen, familiären und gesellschaftlichen Folgen.
(Paeslack, 1998, in: Kruse, 2006: 126)
Bezogen auf die psychische Struktur von Menschen mit geistiger Behinderung geht Senckel (2006) von folgenden Grundvoraussetzungen aus:
Alle Aussagen über geistig behinderte Menschen gründen in der Überzeugung, dass ihre psychische Struktur nicht prinzipiell von derjenigen der so genannten normal Begabten abweicht. Vielmehr gelten allgemein psychologische Erkenntnisse auch tatsächlich «allgemein» […]. Vielmehr lässt sich jedes psychische Merkmal geistig behinderter Menschen unter bestimmten Voraussetzungen oder zu irgendeinem Zeitpunkt der Entwicklung auch bei den so genannten Durchschnittsmenschen nachweisen.
(Ebd.: 17)
Deutlich wird bei diesen Betrachtungsweisen, dass das Trennende und das Verbindende immer auch gesellschaftlich konstruiert sind. Zum einen erweitert sich zunehmend der Horizont der Erkenntnis über das Phänomen «geistige Behinderung» und zum anderen entwickeln sich die gesellschaftlichen Ableitungen aus diesen Erkenntnissen. Dies ist sehr schön ablesbar an der Geschichte der Institutionalisierung von Menschen mit geistiger Behinderung. Wurden sie noch vor wenigen Jahrzehnten in Anstalten hinter der «gesellschaftlichen Kulisse» verwahrt, so finden zunehmend gesellschaftliche Emanzipationsanstrengungen statt, die das «Anders-Sein» als einen gesamtgesellschaftlichen Anspruch an konkrete soziale Bedingungen sehen.
Nichtsdestotrotz gibt es aber auch noch «stille» gesellschaftliche Entwicklungen dahingehend, dass zu fragen bleibt, ob wir zurzeit nicht etwas erleben, das es in dieser Form und diesem Umfang in 40 bis 50 Jahren nicht mehr geben wird. Denn durch die Möglichkeiten der Eugenik und der Pränataldiagnostik wird es in den kommenden Jahren immer weniger Menschen geben, die mit einer geistigen Behinderung zur Welt kommen.
1.1 Historische Betrachtungsweisen von und Umgang mit Behinderung
Betrachtungsweisen von Krankheit und Behinderung wandeln sich mit den Gesellschaften. Dem Individuum geht die Gesellschaft mit ihren Werten und Normen «genetisch voraus» (Cloerkes, 2001: 85). Das bedeutet, dass sich auch für die heutige Betrachtungsweise von Behinderung noch immer fünf verschiedene «historisch bedingte Ansichten und Überzeugungen» (Cloerkes, 1985: 309f.) finden lassen:
hebräisch: Das kranke Individuum ist selbst verantwortlich für seinen Zustand. Krankheit und physische Defekte sind eine Strafe Gottes für begangene Sünden.griechisch: Krankheit und physische Behinderung bedeuten soziale Inferiorität [untergeordnete Stellung bzw. Unterlegenheit, S.K.].christlich: Krankheit und Leiden dienen der Läuterung und sind ein Weg zur Gnade Gottes.calvinistisch: Das Fehlen materiellen Erfolges, auch bedingt durch Krankheit oder Behinderung, ist sichtbares Zeichen für den Entzug göttlicher Gnade.wissenschaftlich: Der Kranke oder Behinderte kann nichts für seinen Zustand und wird daher auch nicht zur Rechenschaft gezogen. Diese moderne Sichtweise kann über die «Pathologisierung» der Betreffenden zu neuen «wissenschaftlichen» Vorurteilen führen.Mögen wir uns heute für aufgeklärt und liberal halten, können wir doch Spuren der oben genannten historischen Ansichten immer noch im Volksglauben («Wechselbalg» – ein durch den Teufel ausgewechseltes bzw. untergeschobenes Kind) und in den Alltagsansichten («Der wurde im Suff gezeugt») wiederfinden. Ein Extremfall dieser noch heute anzutreffenden Sichtweisen wird von Cloerkes (2001: 86) dahingehend aufgeführt, dass 1976 in Aschaffenburg eine Frau mit epileptischen Anfällen von zwei Priestern im Zuge eines Exorzismus ums Leben kam. Bei ihr wurden im Vollzug dieser mittelalterlichen Praxis insgesamt sechs «Teufel ausgetrieben».
Leider müssen sich auch heute noch Eltern von Kindern mit geistiger Behinderung fragen lassen, warum sie das Kind «nicht haben wegmachen» lassen. In Zeiten von Eugenik und Pränataldiagnostik dient die Option dieser Methoden dazu, die Schuldfrage dahingehend aufwerfen zu können, dass die «Verantwortung» für das Vorliegen einer geistigen Behinderung auf die Eltern zurückgeworfen wird.
Hier liegt klar auf der Hand, dass noch immer eine Schuldzusprechung vorgenommen wird. Dazu Cloerkes (2001):
Eine wichtige Rolle im kulturhistorisch geprägten Verhältnis zu Behinderten hat immer die Frage nach der Zurechnung von Schuld für den unerwünschten Zustand gespielt. Das liegt an der Neigung von Menschen, für alles im Leben eine Erklärung, einen Grund zu finden.
(Ebd.: 87)
Gemäß der kulturhistorischen Betrachtungsweise von Krankheit und Behinderung war dann auch ihre institutionelle Entsprechung, denn Normen und Werte einer Gesellschaft bezüglich des Phänomens «Behinderung» spiegeln sich in konkreten sozialen Strukturen für Menschen mit Behinderung wider. Auch hier ist in den vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten ein steter Wandel im Umgang mit Menschen mit geistiger Behinderung zu konstatieren.
Noch im 16. Jahrhundert bezeichnete Martin Luther ein geistig behindertes Kind als «Klumpen Fleisch ohne Seele» (Haffter, 1968: 59). Die Tötung eines solchen Kindes war somit nichts Verwerfliches. Erst ab dem 19. Jahrhundert wurden Menschen mit geistiger Behinderung als Objekte gesehen, an denen sich die christliche Nächstenliebe versuchen sollte. «Hier ging es jedoch in allererster Linie darum, dass im Rahmen kirchlicher Armenhilfe Menschen mit geistiger Behinderung als Objekt der Mission entdeckt wurden» (Ding-Greiner/Kruse, 2010: 213). Dass Menschen mit Behinderung rein nach dem Defizitmodell betrachtet wurden, zeigt auch die Terminologie, mit der sie bezeichnet wurden, nämlich als «Krüppel» oder auch «Idioten» (VEEMB, 1997: 9). Zunehmend entstanden Anstalten, in denen Menschen mit geistiger Behinderung «verwahrt» wurden. «Über die Belegung dieser Anstalten mit Patienten der verschiedenen Geisteskrankheiten liegen nur wenig aussagekräftige Angaben vor» (Häßler/Häßler, 2005: 53). Hier überwogen vor allem «Schizophrene, Depressive, Tobsüchtige und Demente», die so genannten «Schwachsinnigen und Idioten» (ebd.).
Auch wenn sich in der Weimarer Republik an der Terminologie («Geisteskranke, Krüppel, Idioten») nichts änderte, entstand hier allerdings zum ersten Mal ein Rechtsanspruch auf Unterstützung durch staatliche Pflichtleistungen (Ding-Greiner/Kruse, 2011: 214). Erbracht wurden diese Leistungen – nun staatlich finanziert – von den gleichen Einrichtungen, die dies mit ihrem missionierenden Eifer vorher schon getan hatten. Die Einstellung gegenüber Menschen mit geistiger Behinderung änderte sich dadurch nicht, es ergab sich aber nun ein «Markt» und es entstanden «wohlfahrtsindustrielle Komplexe» (Sachße, 1995: 133, zit. n. Ding-Greiner/Kruse, 2010: 214).
In der Zeit des Nationalsozialismus wurde offen und unverhohlen der Schutz der so genannten «Volksgesundheit» dadurch angestrebt, dass die systematische Vernichtung von so genanntem «unwerten Leben» geplant, organisiert und vollzogen wurde. Neben Zwangssterilisierungen an ca. 400000 Menschen mit geistiger Behinderung (zwischen 1934 und 1945) hat die Aktion T4 dazu geführt, dass knapp 200000 Menschen mit geistiger Behinderung bürokratisch geplant, rational durchgeführt und teilweise im Geiste der Wissenschaft ermordet wurden. Die Anstalten, in denen Menschen mit geistiger Behinderung untergebracht waren, halfen dabei fleißig mit, indem sie den vorgegebenen Meldebogen dahingehend auszufüllen hatten, ob die bezeichnete Person mit geistiger Behinderung eher ein «vegetatives Dasein» führte oder zu «mechanischen Arbeiten» fähig war. Ersteres führte in den sicheren Tod. Als erste öffentliche Proteste gegen die Aktion T4 laut wurden, wurde das «Programm» verdeckt weitergeführt.
Die Nachkriegszeit hatte kein sonderlich großes Interesse daran, die im Nationalsozialismus begangenen Gräueltaten lückenlos aufzuklären. Beteiligte der «pseudowissenschaftlichen» Experimente an geistig behinderten Menschen gelangten schnell wieder in entsprechende Positionen und Professuren und wurden dahingehend gesellschaftlich «reingewaschen». Noch weit bis Ende der 50er-Jahre des 20. Jahrhunderts war die Behindertenarbeit mit Gesetzen belastet, die in den 30er-Jahren des 20. Jahrhunderts verabschiedet worden waren (z.B. das «Reichsschulpflichtgesetz» von 1938). Erst sehr viel später – quasi mit der Psychiatriereform ab Mitte der 70er-Jahre des 20. Jahrhunderts – entstanden immer mehr emanzipatorische Anstrengungen für und mit Menschen mit geistiger Behinderung.
Ansätze, die durch Schlagworte gekennzeichnet sind, wie Integration, Inklusion und Empowerment, versuchen zunehmend die gesellschaftliche Behinderung von Menschen mit Handicaps zu minimieren. Trotz dieser innovativen Ansätze kann vielerorts aber immer noch eine Randständigkeit bzw. ein «Mittendrin-Draußen-Sein» konstatiert werden.
Ganz nebenbei lässt sich diese Randständigkeit auch in der Palliative Care erkennen, denn kaum ein Standardwerk zur Palliativversorgung im deutschsprachigen Raum befasst sich auch mit den palliativen Bedarfen von Menschen mit geistiger Behinderung. Rühmliche Ausnahme ist hier die Arbeit von Kränzle, Schmid und Seeger (2010).
1.2 Behindertenarbeit und das Älterwerden ihrer Klientel
In Deutschland beschäftigen sich die Wohnstätten und Wohneinrichtungen für Menschen mit geistiger Behinderung zunehmend mit gerontologischen Fragestellungen. Das liegt daran, dass Menschen mit geistiger Behinderung in Deutschland erstmalig so alt werden, dass sie den Rentenstatus erreichen, alterstypische Krankheiten ausbilden und auch an ihr Lebensende kommen. Hier stellen sich dann Fragen wie:
Wie beschäftigen wir alte Menschen mit geistiger Behinderung, wenn sie in Rente gehen?Wie erkennen wir alterstypische Krankheiten, wenn sie auftreten, der Betroffene sie aber aufgrund der geistigen Behinderung nicht verbal mitteilen kann?Wie können wir belastende Symptome erkennen und behandeln?Wie gehen wir mit Menschen mit geistiger Behinderung um, die zusätzlich eine Demenz entwickeln?Wie gestalten wir das Lebensende für diese Menschen?All diese Fragen sind schon zu einem früheren Zeitpunkt aufgeworfen worden, jedoch eher theoretisch und visionär, obwohl die demographische Entwicklung ja absehbar war. Heute stehen diese Fragen als konkrete Personen und Anforderungen an bestehende Versorgungsstrukturen deutlich im Raum. Die Einrichtungen der Behindertenhilfe müssen aktuell reagieren.
Schon 2004 wurde von 20000 bis 30000 älteren Menschen mit geistiger Behinderung, die älter als 65 Jahre waren, ausgegangen (Pro Alter, Heft 2, 2004). Mittlerweile wird die Zahl gravierend gestiegen sein. Genaue Zahlen gibt es für Deutschland nicht, da die Melderegister eine Klassifizierung nach Behinderung nicht vornehmen. Schauen wir bezogen auf das Alter nur auf die Bewohner in Wohnstätten, kann folgendes konstatiert werden:
Die Altersgruppen bis 40 Jahre haben deutlich abgenommen, während die über 40 Jahre anteilmäßig zugenommen haben. Das Durchschnittsalter lag im Jahr 2000 bei 38,8 Jahren, 2006 lag es bei 41,9 Jahren.
(Ding-Greiner/Kruse, 2010: 16)
Was sich hier deutlich abzeichnet, ist eine Alterung der Bewohnerstruktur in den Wohnstätten. Auch in ausgelagerten Außenwohngruppen ist diese Tendenz deutlich zu bemerken.
Aus eben diesem Alterungsprozess entsteht ein steigender Bedarf an Palliativversorgung für diese Klientel. Dabei sind Entwicklungen zu erkennen, die mit denen der nichtbehinderten Bevölkerung parallel laufen. Auf der anderen Seite gibt es Tendenzen, die eine «Verfrühung» von altersspezifischen Erkrankungen aufzuzeigen scheinen. Vor allem bei Menschen mit Down-Syndrom scheint dies der Fall zu sein. Hierbei fällt vor allem der frühe «Einstieg» in die Alzheimer-Demenz auf, der einen zusätzlichen Palliativbedarf mit sich bringt.
Bezogen auf konkrete Krankheitsbilder zeigen Ding-Greiner und Kruse (2010: 22–25) folgende Tendenzen für das Auftreten von Alterserkrankungen bei Menschen mit geistiger Behinderung auf (Tab. 1-1).
Tabelle 1-1: Tendenzen für das Auftreten von Alterserkrankungen bei Menschen mit geistiger Behinderung (Quelle: n. Ding-Greiner/Kruse, 2010: 22–25)
Setzen wir die auftretenden Alters- und Verschleißerkrankungen jetzt auch noch in Relation zu einer möglichen Demenz, kann die Situation mit Gusset-Bährer (2012) wie folgt zusammengefasst werden:
Im Vergleich zu älteren Menschen mit geistiger Behinderung ohne Demenzerkrankung weisen ältere Demenzkranke mit geistiger Behinderung deutlich mehr Erkrankungen auf. Bei Demenzkranken in einem späten Stadium werden zudem deutlich mehr Begleiterkrankungen festgestellt als bei Demenzkranken in einem mittleren Stadium. Dies ist unabhängig vom Grad der geistigen Behinderung.
(ebd.: 199)
Fazit
Aus all diesen Prozessen wird deutlich, dass auch bei Menschen mit geistiger Behinderung mit zunehmendem Alter gerontologische, geriatrische, pflegerische und palliative Fragestellungen immer wichtiger werden. Betreuungskonzepte müssen sich dieser veränderten Klientel anpassen, indem mehr Pflege und Palliative Care in das Angebot aufgenommen werden müssen.
1.3 Heilerziehungspflege als Antwort auf erhöhten Pflegebedarf?
Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden erste Anstrengungen unternommen, ein Berufsbild zu schaffen, das den erzieherischen und pflegerischen Aufgaben nachkommen kann. So nahm in Essen 1927 eine «Caritative Fachschule für Abnormenfürsorge» ihre Arbeit auf (Thesing, 1998: 32). Diese Kurse dauerten damals ein halbes Jahr. Die Berufsbezeichnung «Heilerziehungspfleger» wurde 1958 in der Anstalt Stetten im Remstal geprägt (ebd.). Im weiteren Verlauf dieser Berufsentwicklung wurde neben dem Heilerziehungspfleger auch der Heilerziehungshelfer entwickelt. Schon in 1971 wurden entsprechende Ausbildungs- und Prüfungsordnungen entworfen und verabschiedet. Mittlerweile werden in der BRD an mehr als 200 Fachschulen Heilerziehungspfleger und Heilerziehungshelfer ausgebildet.
Auch wenn hier, im Gegensatz zu den pädagogischen Mitarbeitern, ein hoher Stundenteil in der Ausbildung der Pflege gewidmet ist, wird die aktuelle Ausbildung dem eigentlichen geriatrischen und palliativen Bedarf in der Praxis nicht gerecht. Noch viel zu sehr wird hier einem kurativen und fördernden Pflegeansatz das Wort geredet. So finden sich im Konzept der Heilerziehungspflegeausbildung in Nordrhein-Westfalen gemäß dem Ministerium aus dem Jahr 2000 für den Bereich der Pflege folgende Bereiche:
Hilfestellung bei der Körperpflegepflegerische Prävention und Prophylaxepflegerische Betreuung und Förderung.In diesem Kontext versteht sich Heilerziehungspflege als ganzheitliche Lebensbegleitung von Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung. Vor diesem Hintergrund wird es aber schwierig, einen zunehmenden Palliativbedarf wahrzunehmen und entsprechend zu beantworten. Förderkonzeption und Palliative Care scheinen hier nicht so recht zusammenzupassen. Daher klingt es schon fast wie die Quadratur des Kreises, wenn Aschoff fordert: «Mit der Pflege sollte auch im Alter noch Förderung verbunden sein» (Aschoff, 2010: 107). Die Praxis merkt, dass Heilerziehungspflege dem sich verändernden Bedarf in den Wohnstätten allein nicht gerecht werden kann. Daher greift sie auf weitere Berufsfelder zurück:
Bei der überwiegenden Mehrheit der Fachkräfte handelt es sich jedoch um Heilerziehungspfleger, Heilpädagogen oder Pädagogen, d.h. um pädagogisch ausgebildete Fachkräfte. Da in den Einrichtungen der Behindertenhilfe der Anteil älterer geistig behinderter Menschen deutlich gestiegen ist und die pädagogisch ausgebildeten Mitarbeiter häufig lückenhafte Kenntnisse bezüglich der Pflege älterer Menschen aufweisen, werden zunehmend auch Altenpfleger und Krankenpfleger in das Team integriert.
(Ding-Greiner/Kruse, 2010: 255f.)
1.4 Schnittmenge und Parallelität mit/zur Altenpflege
Betrachtet man die Entwicklung der Betreuung und Pflege von Menschen mit geistiger Behinderung, kommt man nicht umhin, eine gewisse Parallelität mit dem Berufsfeld der Altenpflege zu sehen, vor allem, wenn es um die Betrachtung von Bewohnern mit Demenz geht. Auch die Pflege, Betreuung und Versorgung alter Menschen haben in Deutschland eine wechselvolle Geschichte. Ihre institutionelle Entsprechung wandelte sich ebenfalls mit einem veränderten Blick auf den alten Menschen. Der institutionelle Wandel fand hier wie folgt statt:
von der Verwahranstalt überdas Altenkrankenheim zum Wohnheim, um nun imServicezentrum den alten Menschen als Kunden zu sehen.Spannend ist hier vor allem die Parallelität in der Diskussion um das Thema «Demenz». Denn hat die Altenpflege den Menschen mit Demenz in den 90er-Jahren des 20. Jahrhunderts «entdeckt», und wurden zu diesem Zeitpunkt das Für und Wider einer segregierten Betreuung (wild und leidenschaftlich) diskutiert, erleben wir ähnliche Tendenzen nun in der Behindertenarbeit.
Eine zweite Parallelentwicklung erleben wir auch auf dem Feld der Palliative Care, denn diesen Ansatz hat die Altenpflege vor ca. 25 Jahren für ihr Themenfeld entdeckt. Aber weder im mittlerweile bundeseinheitlichen Curriculum für die Altenpflegeausbildung noch in den stationären Einrichtungen kann man konstatieren, dass hier Palliative Care wirklich «am Waschlappen» angekommen sei. Inwieweit die generalistische Ausbildung dieses Manko ausgleichen kann, bleibt abzuwarten. Zu sehr werden hier immer noch Ideale der 70er- und 80er-Jahre des 20. Jahrhunderts bedient, wenn es darum geht, den alten Menschen zu rehabilitieren, zu aktivieren, zu mobilisieren und zu motivieren. Selbst wenn der Überbau schon entsprechende Konzepte wissenschaftlich begleitet, bedeutet das nicht, dass dieser Ansatz schon an jedem Bewohnerbett angekommen ist.
2. Behinderten-Wohnstätten als Orte zum Sterben?
Der Begriff «Wohnstätte» umfasst eine Vielzahl an Wohnformen, die sich im Laufe der Geschichte der Behindertenarbeit herausgebildet haben. Für unsere Fragestellung sollen vor allem Wohngruppen angesprochen werden. Hierunter ist Folgendes zu verstehen:
Die Bezeichnung Wohngruppe wird für verschiedene Wohnformen verwandt. Gemeinsam sind für so bezeichnete Wohnformen folgende Kriterien:
Es handelt sich um eine kleine Einheit, die von einem Dritten (Träger) organisiert ist. Die Zusammensetzung wird nicht von den Bewohnern, sondern entscheidend vom Träger bestimmt. Es leben Personen zusammen, die durch Verantwortung und Pflichten zur Selbstversorgung überfordert wären und deshalb nicht selbstständig leben können; sie wirken jedoch nach ihren individuellen Fähigkeiten und Kräften bei der Selbstversorgung und dem Leben der Gruppe mit. Es ist eine je nach Bedarf der Bewohner gestaffelte Betreuung rund um die Uhr möglich: dafür hat der Träger entsprechende Vorkehrungen getroffen.(Bundesarbeitsgemeinschaft der Überörtlichen Träger der Sozialhilfe, 1987: 2)
Wohnstätten für Menschen mit Behinderung sind – wie der Name schon sagt – Orte zum Wohnen. Hier werden die Bewohner im Sinne des Normalitätsprinzips betreut, immer häufiger auch gepflegt und in ihren Alltagskompetenzen gefördert. Das Ziel ist, dem Betroffenen so viel Selbstständigkeit zu belassen, wie es ihm möglich ist und durch die Einrichtung vertreten werden kann.
Da viele der Bewohner in jungen Jahren eingezogen waren, ist es nicht selten der Fall, dass sie hier dann jahrzehntelang leben. Eine Besonderheit entsteht zudem noch: Mitarbeiter und Bewohner werden zusammen alt.
Anekdote
In einer Wohnstätte in Mülheim an der Ruhr durfte der Autor vor einigen Monaten miterleben, wie ein Bewohner und ein Mitarbeiter zusammen eine Feier organisierten und dann auch durchführten. Beide feierten ihr Ausscheiden aus dem Berufsleben und den Gang in die Rente. Zusammen hatten sie fast 40 Jahre miteinander verlebt.
Anhand dieser Anekdote wird auch deutlich, dass die Wohnstätten sich zunehmend mit neuen Fragestellungen beschäftigen müssen, denn sie haben es immer häufiger mit Bewohnern zu tun, die eben nicht mehr in eine Werkstatt arbeiten gehen. Hier müssen sich nun die Mitarbeiter, meist (Sozial-)Pädagogen und Erzieher, damit beschäftigen, wie man «Rentner» beschäftigt und weiterhin in den Wohnstättenalltag integriert.
Auf der anderen Seite werden neben diesen eher gerontologischen Fragestellungen zunehmend auch pflegerelevante Fragen aufgeworfen, denn mit dem zunehmenden Alter entstehen zunehmend typische Alterserkrankungen und Verschleißerscheinungen, wie sie auch in der Allgemeinbevölkerung auftreten.
In letzter Konsequenz merken aber auch die Mitarbeiter, dass immer häufiger das Sterben und die Sterbebegleitung Themen sind, mit denen sie sich auseinandersetzen müssen.
Das Sterben von Bewohnern auf der Wohngruppe ist in manchen Einrichtungen noch ein seltenes Ereignis, die Mitarbeiter sind häufig nicht darauf vorbereitet. Bewohner und Mitarbeiter haben aus dem Bedürfnis heraus, angemessene Formen für den Umgang mit Tod und Sterben zu finden, gemeinsam Rituale entwickelt, die das Sterben eines Mitbewohners begleiten und den Bewohnern Halt geben sollen. Die Voraussetzung für das Gelingen solcher Initiativen liegt stets im persönlichen Bezug, den der Mitarbeiter zu Sterben und Tod hat.
(Ding-Greiner/Kruse, 2010: 54)
Deutlich wird aus dieser Position aber auch, dass Mitarbeiter der Wohnstätten eher auf private Verarbeitungsmechanismen zurückgreifen müssen, als dass ihnen ihre Ausbildung einen entsprechenden Fundus vermittelt hat. Auch ist zu bemerken, dass nur wenige Wohnstätten für Menschen mit geistiger Behinderung in ihrem Leitbild das Sterben konzeptionell und strukturell verinnerlicht haben.
2.1 Sind Orte des Lebens auch Orte zum Sterben?
In einer Inhouse-Schulung von Mitarbeitern mehrerer Wohnstätten für Menschen mit geistiger Behinderung im Rheinland sagte mir letztens eine Mitarbeiterin: «Wir versuchen so lange es eben geht, den Bewohner hier bei uns zu versorgen. Wenn aber der Pflegebedarf zu groß wird, können wir das hier nicht mehr leisten. Wir sind ja keine Pflegeeinrichtung.» Dieses Statement macht ein grundlegendes Problem der aktuellen Situation in vielen Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderung deutlich. Sie sind nicht auf Pflege und Versorgung am Lebensende eingerichtet, da «Pflege» schlicht und einfach nicht ihr «Hauptgeschäft» ist.
In Deutschland wird der Unterschied zwischen Wohnstätte und Pflegeeinrichtung dadurch zementiert, dass hier zwei unterschiedliche Finanzierungssysteme existieren, die sich in vollstationären Einrichtungen ausschließen. Aus der Perspektive des betroffenen Bewohners bedeutet diese Rahmenbedingung, dass er möglicherweise aus der vollstationären Eingliederungshilfe (Sozialgesetzbuch XII) in eine Pflegeeinrichtung (Sozialgesetzbuch XI) umziehen muss, wenn sein Pflegebedarf zu groß wird.
Gemäß den Finanzierungsvorgaben und der pädagogischen Grundkonzeption arbeiten in den Einrichtungen der Eingliederungshilfe mehrheitlich Mitarbeiter, die im pädagogischen Bereich ausgebildet sind. Hier sind es vor allem Heilerziehungspfleger, Sozialpädagogen und Erzieher. Vereinzelt finden sich hier allerdings auch Kranken- und Altenpfleger.
Aus den oben beschriebenen Finanzierungs- und Konzeptvorgaben und den altersbedingten Veränderungen der Bewohner, steuern Einrichtungen der Eingliederungshilfe also auf ein Dilemma zu: Sie begreifen sich als ein Zuhause für den Bewohner, das er aber in dem Augenblick verlassen muss, wenn sein Pflegebedarf zu groß wird.
Zynisch könnte man jetzt sagen, dass auch auf diesem Feld Menschen mit geistiger Behinderung der Vergleichsbevölkerung gleichgestellt sind, denn auch hier liegt das gleiche Phänomen vor: Da, wo wir gerne sterben möchten, nämlich zuhause, werden die meisten von uns eben nicht sterben. Denn ca. 70% der Bevölkerung werden in einer Institution (z.B. Krankenhaus, Altenpflegeheim oder Hospiz) versterben, obwohl ca. 90% zuhause versterben möchten.