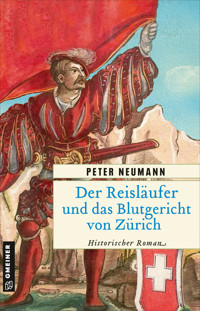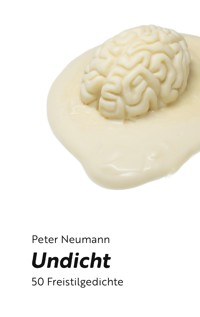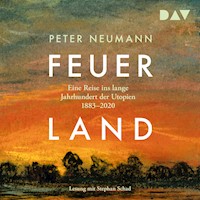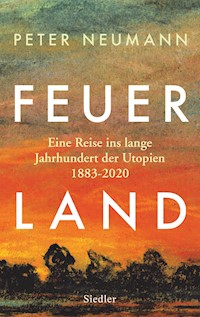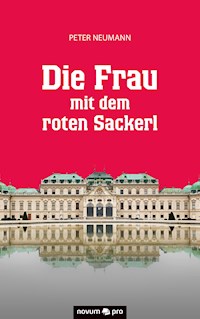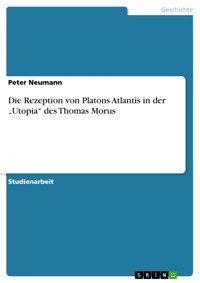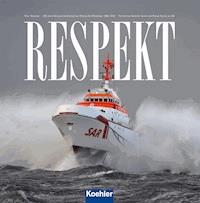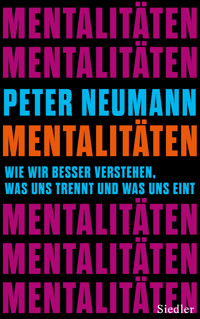
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siedler Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Warum uns Mentalitäten, nicht Identitäten, den heutigen Zustand unserer Gesellschaft erklären - ein Buch über die großen Konflikte unserer Zeit
"Einsichtsreich und aufklärend" (Wolfram Eilenberger über "Mentalitäten")
Die aktuellen Konflikte, bei denen Befürworter von Aufrüstung und Pazifisten aufeinanderstoßen oder Ostdeutsche und Westdeutsche – sie werden oft von tief verwurzelten Einstellungen und Überzeugungen, kurz: Mentalitäten, angetrieben.
In diesem sehr persönlichen Essay spürt Peter Neumann ihnen nach. Geboren in der ostdeutschen Provinz, hat er die DDR nicht mehr bewusst erlebt, und doch merkt er, da ist etwas, das nicht vergeht. Wie wirksam sind Prägungen wie diese? Welche Rolle spielen sie in den Kulturkämpfen, etwa um den neuen Bellizismus oder im Konflikt zwischen Stadt und Land?
Oft, so zeigt Peter Neumann, geht es dabei nicht um Argumente, sondern um Erfahrungen. Wer so streitet, verteidigt nicht bloß eine Haltung – er verteidigt sich selbst. Wenn wir die Macht von Mentalitäten begreifen, können wir besser verstehen, was uns trennt und was uns eint.
»In Zeiten aufgeheizter Konflikte zeigt uns Peter Neumann luzide, leichtfüßig und lehrreich, dass viele unserer Weltdeutungen mit Erfahrungen und Mentalitätsprägungen zu tun haben, denen wir kaum entkommen können.« (Steffen Mau)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 138
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Die aktuellen Konflikte, bei denen Befürworter von Aufrüstung und Pazifisten aufeinanderstoßen oder Ostdeutsche und Westdeutsche – sie werden oft von tief verwurzelten Einstellungen und Überzeugungen, kurz: Mentalitäten, angetrieben.
In diesem sehr persönlichen Essay spürt Peter Neumann ihnen nach. Geboren in der ostdeutschen Provinz, hat er die DDR nicht mehr bewusst erlebt, und doch merkt er, da ist etwas, das nicht vergeht. Wie wirksam sind Prägungen wie diese? Welche Rolle spielen sie in den Kulturkämpfen, etwa um den neuen Bellizismus oder im Konflikt zwischen Stadt und Land?
Oft, so zeigt Peter Neumann, geht es dabei nicht um Argumente, sondern um Erfahrungen. Wer so streitet, verteidigt nicht bloß eine Haltung – er verteidigt sich selbst. Wenn wir die Macht von Mentalitäten begreifen, können wir besser verstehen, was uns trennt und was uns eint.
Peter Neumann, geboren 1987, ist promovierter Philosoph. Er lehrte an den Universitäten Jena und Oldenburg und ist seit November 2021 Redakteur im Feuilleton der Wochenzeitung DIEZEIT. 2018 erschien bei Siedler »Jena 1800. Die Republik der freien Geister«, das von Publikum und Kritik gefeiert wurde. 2022 folgte »Feuerland. Eine Reise ins lange Jahrhundert der Utopien 1883–2020« (2022). Peter Neumann lebt in Berlin.
Besuchen Sie uns auf www.siedler-verlag.de
PETER NEUMANN
MENTALITÄTEN
Wie wir besser verstehen,
was uns trennt und was uns eint
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Copyright © 2025 by Siedler Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR.)
Lektorat: Bernd Klöckener
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt
Satz: KCFG – Medienagentur
ISBN 978-3-641-33280-8V001
www.siedler-verlag.de
Inhalt
Einleitung
I. Prägung
Wo unsere Überzeugungen herkommen
II. Streit
Wie unsere Emotionen getriggert werden
III. Umbruch
Wann unsere Gewohnheiten kippen können
Schluss
Anmerkungen
Einleitung
Es muss bei einem meiner ersten Berlin-Besuche als Teenager gewesen sein: Mein älterer Bruder und ich sind unterwegs, wir ziehen um die Häuser, wollen gerade die Stufen in den U-Bahnhof Alexanderplatz hinuntersteigen, als ich sie bemerke, erst die Silhouetten, dann die Körper. Schwarze Stiefel, weiße Schnürsenkel. Kein Zurück. Also weiter, Herzschlag in den Ohren, Augen starr nach vorn. Hoffen, dass es vorbeigeht, dass sie uns nicht sehen oder uns einfach ignorieren. So wie im Stadtbus nach der Schule, wenn sich zwei, drei von den Jungs mit rasiertem Schädel in meine Nähe setzten. Dann hieß es: Nicht bewegen. Nicht atmen. Beten.
In den 1990er Jahren im Osten wusste man nie genau, wann es kippt. Wann aus Alltag plötzlich Gefahr wird. Rechte Gewalt war für mich damals Teil der Normalität. Sie hat mich geprägt wie viele andere auch. Ich gehöre zur Generation der sogenannten Nachwendekinder. Wir haben die DDR selbst nicht mehr erlebt, doch haben der Bruch, die Umwälzung, all das, was die Wende im Osten mit sich brachte, tiefere Spuren hinterlassen, als wir hätten ahnen können. Unsere Eltern kämpften mit Arbeitslosigkeit, Existenzängsten, Frustration. Sie, meist in den 1950er oder frühen 1960er Jahren geboren, waren Teil einer Lost Generation. Auf der Höhe ihres beruflichen wie privaten Lebens wurden sie aus der Bahn geworfen und mussten von vorn beginnen. Die Welt, die sich für sie öffnete, war nicht der goldene Westen, sondern ein Raum voller Unwägbarkeiten.
Wir hingegen wuchsen auf in einem Feld wuchernder Möglichkeiten. Ich denke an endlose Nachmittage in stillgelegten Kombinaten und leeren Fabrikhallen, an eine postapokalyptische Landschaft, die nur darauf wartete, von uns erobert zu werden. Es galten keine Regeln. Niemand hielt uns auf, niemand zeigte uns den Weg. Wir waren auf uns allein gestellt und entdeckten die Freiheit des Unbeobachtetseins, des Ungestörten. Wir konnten das Leben nach eigenen Maßstäben definieren. Es war eine Art von Freiheit, die weniger aus großen Versprechen als aus dem Fehlen von Vorbildern und Halt kam. Es gab keine Geschichten vom gelingenden Leben, von Erfolg; bedauerlich, ja, aber auch ein Grund, das Ruder selbst in die Hand zu nehmen. Kein Wunder also, dass man ging, wenn man jung war. Dass man sein Glück anderswo suchte.
Auch ich zähle zu jenen, die auszogen, die ihrer Heimat den Rücken kehrten, und doch lässt mich der Osten nicht los. Mit Staunen, fast Erschrecken spüre ich heute: Da ist etwas, das nicht vergeht, etwas, das bleibt. Und nicht nur ich mache diese Erfahrung. Zum ersten Mal seit dem Umbruch von 1989 wird deutlich, dass es Prägungen in den Denk- und Verhaltensweisen von Ost- und Westdeutschen gibt, die sich nicht abstreifen lassen oder Schritt für Schritt auflösen werden. Die auch durch noch so viele Gespräche, im Vertrauen auf das bessere Argument, nicht verschwinden. Als Erich Honecker Anfang 1989 erklärte, die Mauer werde auch in fünfzig oder hundert Jahren noch stehen, »so lange, wie die Bedingungen nicht geändert werden, die zu ihrer Errichtung geführt haben«, hielt man das für die Realitätsverweigerung eines alternden Apparatschiks. Kein Jahr später war der »antifaschistische Schutzwall« Geschichte. Und doch könnte Honecker auf ironische Weise Recht behalten.
Was lange als vorübergehende ostdeutsche Befindlichkeit galt, die im westdeutschen Konsens aufgehen werde, ist fester Bestandteil der mentalen Topografie geworden. Die Wahlerfolge der populistischen Parteien sind keine Ausrutscher, kein bloßes Aufbäumen gegen den Rest: Was einst als Protest begann, ist realitätsprägend geworden. Im Osten, so heißt es oft, sitze der Frust tief. Zu viele Brüche, zu wenig Anerkennung, erst das Ende der DDR, dann die großen Verluste danach. Bei den letzten Bundestagswahlen holte die AfD im Osten fast alle Wahlkreise, teils mit über 40 Prozent. In Görlitz erzielte Tino Chrupalla 48,9 Prozent der Erststimmen, mehr als Friedrich Merz im Sauerland. In Teilen Ostdeutschlands haben die Rechtsextremen eine kulturelle Hegemonie erreicht, wie sie sonst nur die CSU in Bayern für sich beanspruchen kann. Dennoch wäre es verkürzt, daraus ein pauschales Urteil über die politische Haltung der Ostdeutschen abzuleiten. Sicher ist nur: Da ist etwas.
Mit jeder Debatte um Ossis und Wessis, um den Soli und seine Abschaffung wird klarer, dass die alte Erzählung von der noch zu vollendenden deutschen Einheit ihre Kraft verloren hat. Und schon geht das Gezeter und Gezerre wieder los: Ist der Osten selber schuld an seiner Misere, weil er nicht genug ausgemistet hat – oder hat ihm der Westen das alles eingebrockt?
Der deutsch-deutsche Ärger ist also vorprogrammiert. Aber der Osten ist nicht bloß eine »westdeutsche Erfindung«, wie der Leipziger Literaturwissenschaftler Dirk Oschmann in seinem gleichnamigen Bestseller behauptet. Er ist anders. Wie man es auch dreht und wendet: Die Unterschiede sind da, und sie verfestigen sich. Die Diagnose des Soziologen Steffen Mau trifft den Punkt: »Die Umbrüche in der Sozialstruktur und das mentale Gepäck sind mehr als entfernte Schatten der Vergangenheit. Sie bestimmen das Erleben, Fühlen und Handeln vieler Ostdeutscher bis heute und entscheiden darüber, wie sie die Gegenwart meistern oder der Zukunft entgegensehen.« Und diese Prägungen werden nicht einfach mit der Zeit verschwinden, vielmehr »verknöchern« sie, wie Mau sagt, ähnlich wie Frakturen nach einem schweren Bruch. Die Ungleichheit zwischen Osten und Westen hängt nicht einfach an nur der wirtschaftlichen Verfassung, dem politischen System, den sozialen Strukturen – es geht um Mentalitäten.
In diesem Essay möchte ich ihnen nachgehen. Ich will verstehen, woher sie kommen, wie sie wirken, warum sie so große Macht über uns haben und ob wir ihnen hilflos ausgeliefert sind. Dabei beschränke ich mich nicht auf Ost und West. Mentalitäten zeigen sich, wenn der russische Staatschef und Ex-KGB-Agent Wladimir Putin den Zusammenbruch der Sowjetunion zur »größten geopolitischen Katastrophe« erklärt und damit ein Geschichtsbild vertritt, das sich vom westlichen Modell deutlich unterscheidet; wenn Jürgen Habermas, geprägt von den Nachkriegserfahrungen seiner Generation, einen »anhaltenden rhetorischen Rückfall in eine bellizistische Mentalität« beklagt und dafür auch die kommunikative Entgrenzung in den sozialen Medien verantwortlich macht; oder wenn Tech-Milliardäre glauben, sie könnten sich in geheimen Luxus-Bunkern in Neuseeland verschanzen und sich durch den Einsatz unbeschränkter Mittel und technologischer Innovationen über jegliche Zumutungen der Realität hinwegsetzen. Aber auch im ganz normalen Alltag machen sich Mentalitäten bemerkbar – zum Beispiel wenn Menschen vom Land mit Bewohnern verkehrsberuhigter Innenstädte oder Anwohnern stark frequentierter Ausfallstraßen über das Aus des Verbrennungsmotors streiten, oder wenn in der Nachbarschaft die Einrichtung einer neuen Flüchtlingsunterkunft zur Debatte steht. Häufig wachsen sie sich gar zu Kulturkämpfen aus. Bei all diesen Konflikten, so meine These, wirken Einstellungen und Überzeugungen, die sich über längere Zeiträume hinweg gebildet haben und mit dem Begriff der Identität allein nur unzureichend zu fassen sind. Wer diese Spannungen wirklich begreifen will, braucht ein anderes Instrumentarium. Der braucht das feinere Besteck der Mentalitäten.
Ausgehend von meiner Erfahrung in der ostdeutschen Provinz möchte ich vier dieser Konfliktfelder näher betrachten: die Auseinandersetzung zwischen Stadt und Land, das Selbstbild der Ostdeutschen, den neuen Bellizismus sowie die Debatte um die Zukunft des Globalen Westens. Ich werde diese Themen nicht der Reihe nach abhandeln, sondern mich von ihrer inneren Logik leiten lassen: In der Frage nach dem Osten spiegelt sich zugleich der Gegensatz zwischen Zentrum und Peripherie, Metropole und ländlichem Raum, gefühlter Elitendominanz und dem Wunsch nach Anerkennung. Wer nach dem Zerfall des Ostblocks über Krieg und Frieden spricht, stößt zwangsläufig auf die großen Versprechen des Globalen Westens – Freiheit, Demokratie, Menschenrechte –, die heute von links wie von rechts unter Druck geraten sind. Und ich möchte »von unten« vorgehen, weil Mentalitäten zwar kollektive Phänomene sind, sich aber immer im individuellen Erleben manifestieren. Ich bin überzeugt, dass das Konzept der Mentalitäten dazu beitragen kann, die aktuellen Kulturkämpfe besser zu verstehen, und zugleich durch eine solche Betrachtung an Kontur gewinnt.
Zunächst möchte ich wissen, was Mentalitäten so wirkmächtig macht: Wie prägen sie unser Denken? Auf welche Weise formen sie unsere Überzeugungen und Urteile? Dann gehe ich der Frage nach, ob diese tief liegenden, oft unbewussten Strukturen Streit und Konflikte provozieren, und wie sie sich auf unsere Art zu argumentieren, zuzuhören und aufeinander zu reagieren niederschlagen. Und schließlich will ich ihre Wandelbarkeit und Widerstandsfähigkeit untersuchen: Helfen sie uns, mit den Zumutungen einer ungewissen Gegenwart und Zukunft umzugehen? Oder können sie gegen uns verwendet werden, wenn es uns nicht gelingt, einen angemessenen Umgang mit ihnen zu finden?
I. Prägung
Wo unsere Überzeugungen herkommen
Ich komme aus Ostdeutschland, ja, aber ich bin auch Europäer, versteht sich. Aufgewachsen in einer nicht allzu großen Stadt in Mecklenburg, die zuletzt bundesweit für Schlagzeilen sorgte wegen eines rechtsextremen Bürgerbündnisses. Ich fühle mich am Meer heimischer als in den Bergen. Bin liberal, kein Träumer. Ich habe gesehen, welche Spuren eine Diktatur hinterlässt. Ich misstraue großen Ideen, auch meinen eigenen.
Vielleicht bin ich eher ein Kind des 20. Jahrhunderts, an dessen Rändern ich geboren wurde, als des 21., in das ich hineingewachsen bin. Konfessionslos, aber nicht blind für das, was Kant einmal »Vernunftreligion« genannt hat. Ohne einen Glauben an Gott, an das Gute, an ein wie auch immer geordnetes größeres Ganzes kommen wir, so der preußische Aufklärer, nicht aus. Prägungen wie diese – aus Familie, Schule, Studium, Beruf – haben sich mir eingeschrieben. Sie gehören zu mir, zu meiner Geschichte. Sind nicht wegzudenken. Und ich wüsste nicht, welche davon ich herausgreifen und zur Essenz meiner Identität erklären sollte.
Der Historiker Ulrich Raulff hat dieses Geflecht von Einflüssen aus unterschiedlichen Lebensbereichen und -phasen einmal mit der Kunsttechnik der Frottage verglichen: Wer mit einem Grafitstift über ein Blatt Papier reibt, macht die darunterliegenden, verborgenen Muster sichtbar. Eine untergründig wirksame Struktur. Genauso geben die tagtäglichen Auseinandersetzungen solche Prägungen zu erkennen, etwas, das schon da war, aber erst durch die Reibung mit der Gegenwart hervortritt. Woher kommen sie? Und warum führen sie so häufig zu Konflikten?
Neben meiner Herkunft aus dem Osten hat mich wohl am meisten das Aufwachsen in der Provinz geprägt. Wer in ländlichen Gegenden Mecklenburgs groß wird, lernt früh, dass Stolz ein seltenes Gut ist. Daran können auch die jüngsten Wirtschaftszahlen nichts ändern, wenngleich das Wachstum in diesem Bundesland zuletzt stärker war als in jedem anderen. Die Zeiten, in denen die Arbeitslosigkeit in Teilen Vorpommerns bei über 20 Prozent lag und das Land als Hochburg der Neonazis galt, sind zwar vorbei. Doch jedes Mal, wenn ich zu Besuch bin, fühlt es sich an, als würde ich in eine andere Zeit versetzt. Die Uhren gehen hier langsamer, eine Art stoischer Gleichmut macht sich breit. Und ich meine nicht nur die norddeutsche Maulfaulheit. Es ist eher ein Gefühl der Schicksalsergebenheit, die Vorstellung eines ewigen Kommens und Gehens. Ein Schutzmechanismus, damit die Krisen der Welt nicht zu tief in die Lebenswelt eindringen. Was bleibt, ist die Natur – dunkle Seen, raue Kiefernwälder, die weißen Klippen der Ostsee.
Doch gerade in der Provinz habe ich eine wichtige Erfahrung gemacht: Mentalitäten wirken nicht nur trennend, indem sie Menschen ein- und ausschließen. Oft stiften gerade sie eine ansonsten eher unwahrscheinliche Verbindung. Schlagartig deutlich wurde mir das bei einem Besuch in Olevano Romano.
Die kleine Stadt etwa 60 Kilometer südöstlich von Rom, ein Schwalbennest auf steilem Berg, war einst Projektionsfläche für die Maler der Romantik. Vor mehr als zweihundert Jahren entdeckten sie den Ort für sich. An Rom – der allzu bekannten Majestät des Kolosseums, der Villa d’Este in Tivoli, am Petersdom – hatte man sich sattgesehen. Hier, in der Campagna, erwarteten sie eine bukolische Idylle, die sich wie ein Versprechen in den Hügeln ausbreitet. Ziegen, Hirten, knorrige Eichenwälder. Ganz ungefährlich war der Aufenthalt auf dem Lande nicht: Man konnte von Briganten ausgeraubt oder von Weinbauern erschlagen werden, wenn man von deren Trauben naschte.
Aber Olevano war längst nicht mehr das, was die Maler einst gesucht hatten. In den 1960er Jahren hatte die Industrialisierung das römische Hinterland erfasst. Was Italien über Jahrzehnte versäumt hatte, sollte nun plötzlich im Eiltempo nachgeholt werden. Ein Tunnel wurde durch den Berg getrieben, Wohnblocks aus Beton entstanden, ein brutalistischer Busbahnhof, die Autostazione Zeppieri, wurde gebaut. Auf der vielleicht berühmtesten Postkarte des Ortes leuchtet er nachts heller als der Mond. Das war der wahre Stolz des Dorfes und markierte zugleich den Anfang seines Niedergangs.
Olevano blutete aus, Jahr für Jahr ein wenig mehr. Wer jung war und es sich leisten konnte, zog nach Rom. Neue Gewohnheiten hielten Einzug, der Zusammenhalt bröckelte. Als ich durch die Straßen streifte, hatte ich das Gefühl, das halbe Centro Storico stünde leer oder zum Verkauf. Das Muster kannte ich aus dem Osten nur allzu gut: Stadtkerne, in denen kaum noch Geschäfte ihre Türen öffnen, verrammelte Häuser, eine zunehmend alternde Bevölkerung, die sich an die Ikonen der Vergangenheit klammerte. Auch ich war in einer zum Teil malerischen Landschaft aufgewachsen, aber die Zukunft schien immer schon woanders zu liegen.
Olevano Romano war mir vertraut, als hätte ich schon einmal dort gelebt. Etwas klang in mir an, wenn ich auf den Bus wartete, der mich nach Rom bringen sollte. Das irritierte mich, aber es machte mich auch neugierig, diesen Verbindungen auf den Grund zu gehen.
Mentalitäten üben eine eigentümliche Faszination aus. Für sie gilt, was der lateinische Kirchenvater Augustinus von der Zeit behauptet hat: So lange uns niemand danach fragt, glauben wir zu wissen, was gemeint ist. Sobald wir aber unsere Aufmerksamkeit darauf richten und sagen sollen, was einen Neapolitaner von einem gebürtigen Römer, einen Bayern von einem Mecklenburger unterscheidet und was sie verbindet, wissen wir uns nicht zu helfen. Wir sind verlegen. Heinrich Böll hat es einmal so formuliert: »Nichts hat der Kölner Karneval mit der Basler Fastnacht gemein, und sind doch beide rheinisch.«
Mentalitäten sind etwas anderes als Identitäten, auch wenn sie nicht ganz unabhängig voneinander existieren können. Während Identitäten meist mit dem Prozess des (Sich-)Identifizierens einhergehen, mit einem bewussten Bekenntnis oder der (Fremd-)Zuschreibung zu einer Gruppe mit ihren Zeichen und Symbolen, entfalten sich Mentalitäten im Verborgenen. Es sind, technisch gesagt, »Komplexe aus psychischen Dispositionen, emotionalen Neigungen und geistig-seelischen Haltungen«, die sich erst »im Verhalten und Kommunizieren« zu erkennen geben. Im Vergleich zum sichtbaren Bekenntnis der Identität wirken sie flüchtiger, fließender und sind doch fundamentaler. Sie sind unserem Denken und Handeln vorgeschaltet, wir bringen sie, ohne uns dessen bewusst zu sein, in Konflikte ein, und oft bleibt unklar, woher sie eigentlich stammen.
Mentalitäten formen unsere Einstellungen zum Leben. Sie haben ihren Ort in der Umwelt, in der wir aufwachsen, im banalen Alltag, den wir führen, der profanen Lebenswelt, die uns umgibt. Vom Regionalen bis ins Lokale sich verschiebende Gemütslagen, die uns ein besonderes Gespür abverlangen. Wer darüber verfügt, gleicht dem »ambulanten Wetterbeobachter«, als den sich Goethe – ausgerüstet mit Thermometer und Barometer – auf seiner Italienischen Reise verstand.