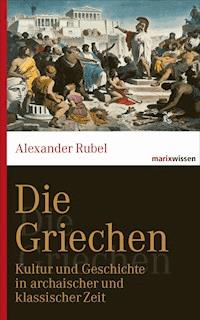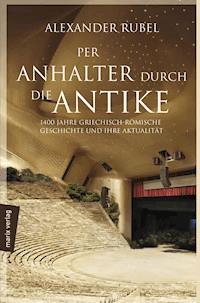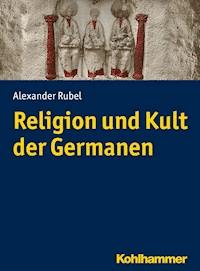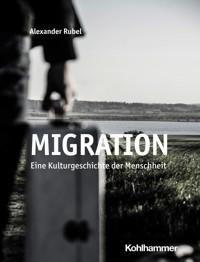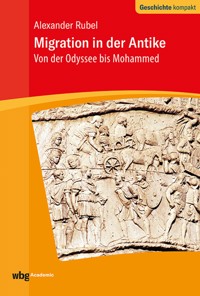
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wissenschaftliche Buchgesellschaft (WBG)
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Kaum ein Thema beherrscht die öffentliche Diskussion so sehr wie das Reizthema »Migration«. Dabei gehört Migration seit jeher zur »conditio humana«, und auch die Antike ist von zahllosen Wanderungsbewegungen geprägt. Eine Gesamtdarstellung, welche die griechisch-römische Welt als Migrationsraum beschreibt, fehlt aber bislang. Von den sogenannten »Seevölkern« Mitte des 12. Jahrhunderts. v. Chr. bis zur islamischen Expansion zeigt der Band die ganze Vielfalt antiker Migrationsbewegungen und behandelt alle dafür relevanten Kulturen: die griechische Welt und das Römische Reich, Wanderungsbewegungen der Goten und Germanen (»Völkerwanderung«) bis hin zum Aufbruch arabischer Stämme zu Beginn des Islam.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
GESCHICHTE KOMPAKT
Alexander Rubel ist Inhaber einer Forschungsprofessur am Archäologischen Institut der Rumänischen Akademie in Jassy (Rumänien), dem er seit 2011 als Direktor vorsteht. Neben Arbeiten zu Archäologie und Alter Geschichte publiziert er regelmäßig zu breiteren kulturgeschichtlichen Themen. Seine Forschungsschwerpunkte sind das klassische Griechenland, antike Religionsgeschichte, Romanisierung in den Provinzen des Römischen Reiches und die Rezeption der Antike in Mittelalter und Moderne.
Herausgegeben von
Kai Brodersen, Martin Kintzinger und Uwe Puschner
Assiduus generis humani discursus estBeständig ist beim Menschengeschlecht nur das Umherwandern(Seneca)
wbg Academic ist ein Imprint der Verlag Herder GmbH
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2024
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Verlag Herder
Umschlagmotiv: Trajanssäule, Rom, 2. Jh. – © akg-images / Album / Prisma
Satz: Lichtsatz Michael Glaese, Hemsbach
E-Book-Konvertierung: Newgen Publishing Europe
ISBN Print: 978-3-534-61013-6
ISBN E-Book (E-Pub): 978-3-534-61007-5
ISBN E-Book (PDF): 978-3-534-61006-8
Inhaltsverzeichnis
Geschichte kompakt
Einleitung
I. Die „Welt des Odysseus“: Die „Seevölker“ und das Ende der Bronzezeit
1. Bronzezeit und Mobilität
2. Die Seevölker. Migranten oder Piraten?
3. David und Goliath
4. Dunkle Jahrhunderte
II. Die griechische „Kolonisation“
1. Phönizier erschließen das Mittelmeer
2. Die Griechen an den Küsten des Mittelmeeres und des Schwarzen Meeres
3. Motive für Auswanderung
4. Organisation und Logistik der Koloniegründungen
5. Typischer Ablauf von Koloniegründungen
6. Ausbreitung griechischer Städte
III. Griechische Stadtstaaten und Einwanderung
1. Bürger, Metöken und Sklaven
2. Lohnarbeit und Arbeitsmigration
3. „Nichtgriechen“ in Athen
4. Bürgerkriege und Vertreibungen
IV. Neue Kommunikationsräume: Das Alexanderreich und die Zeit des Hellenismus
1. Alexander erobert eine neue Welt
2. Städtegründungen Alexanders und die Rückkehr von Verbannten
3. Wanderungen und Ansiedlungspolitik in den hellenistischen Nachfolgestaaten
4. Eine Karriere als Einwanderer in Ägypten. Zenon von Kaunos
5. Nichtgriechen in den hellenistischen Staaten
V. Keltische Wanderungen
1. Die Helvetier und Caesar
2. Keltische Wanderungen in Europa
3. Kelten in Italien
4. Kelten in Anatolien
VI. Migration im römischen Reich
1. Rom. Vom Stadtstaat zum Vielvölkerreich
2. Pax Romana: Rechtsraum und Migrationsraum „Imperium Romanum“
3. Millionenstadt als Schmelztiegel: Rom in der Kaiserzeit
4. Zwangsmigration im Imperium Romanum: Exil, Verbannung, Umsiedlungen
5. Sklaven und Freigelassene. Das sozialgeschichtliche Erfolgsrezept des römischen Reiches.
6. Arbeitsmigration in Rom und im Reich
7. Militär und Migration
8. Migration im Imperium Romanum. Allgemeine Charakteristika
VII. Spätantike und „Völkerwanderung“
1. Grundzüge der Epoche: Neue Parameter und Migrationsstrukturen im römischen Reich
2. Die Goten als Beispiel für spätantike Wanderungen
3. Die „Völkerwanderung“ im Kontext antiker Migrationsgeschichte
VIII. Die Islamische Expansion
1. Das Ende der Antike
2. Erfolgsgeschichte der arabischen Expansion
3. Expansion und Migration
4. Aufbruch ins Mittelalter
IX. Anstatt einer Zusammenfassung: Ein Streifzug durch 1200 Jahre Migrationsgeschichte der Stadt Tomis
Danksagung
Quellen und Literatur
Abbildungsnachweis
Geschichte kompakt
Das Interesse an Geschichte wächst in der Gesellschaft unserer Zeit. Historische Themen in Literatur, Ausstellungen und Filmen finden breiten Zuspruch. Immer mehr junge Menschen entschließen sich zu einem Studium der Geschichte, und auch für Erfahrene bietet die Begegnung mit der Geschichte stets vielfältige, neue Anreize. Die Fülle dessen, was wir über die Vergangenheit wissen, wächst allerdings ebenfalls: Neue Entdeckungen kommen hinzu, veränderte Fragestellungen führen zu neuen Interpretationen bereits bekannter Sachverhalte. Geschichte wird heute nicht mehr nur als Ereignisfolge verstanden, Herrschaft und Politik stehen nicht mehr allein im Mittelpunkt, und die Konzentration auf eine Nationalgeschichte ist zugunsten offenerer, vergleichender Perspektiven überwunden.
In der Geschichte, wie auch sonst, dürfen Ursachen nicht postuliert werden, man muss sie suchen.
(Marc Bloch)
Interessierte, Lehrende und Lernende fragen deshalb nach verlässlicher Information, die komplexe und komplizierte Inhalte konzentriert, übersichtlich konzipiert und gut lesbar darstellt. Die Bände der Reihe „Geschichte kompakt“ bieten solche Information. Sie stellen Ereignisse und Zusammenhänge der historischen Epochen der Antike, des Mittelalters, der Neuzeit und der Globalgeschichte verständlich und auf dem Kenntnisstand der heutigen Forschung vor. Hauptthemen des universitären Studiums wie der schulischen Oberstufen und zentrale Themenfelder der Wissenschaft zur deutschen und europäischen Geschichte werden in Einzelbänden erschlossen. Beigefügte Erläuterungen, Register sowie Literatur- und Quellenangaben zum Weiterlesen ergänzen den Text. Die Lektüre eines Bandes erlaubt, sich mit dem behandelten Gegenstand umfassend vertraut zu machen. „Geschichte kompakt“ ist daher ebenso für eine erste Begegnung mit dem Thema wie für eine Prüfungsvorbereitung geeignet, als Arbeitsgrundlage für Lehrende und Studierende ebenso wie als anregende Lektüre für historisch Interessierte.
Die Autorinnen und Autoren sind in Forschung und Lehre erfahrene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Jeder Band ist, trotz der allen gemeinsamen Absicht, ein abgeschlossenes, eigenständiges Werk. Die Reihe „Geschichte kompakt“ soll durch ihre Einzelbände insgesamt den heutigen Wissensstand zur deutschen und europäischen Geschichte repräsentieren. Sie ist in der thematischen Akzentuierung wie in der Anzahl der Bände nicht festgelegt und wird regelmäßig um weitere Themen der aktuellen historischen Arbeit erweitert.
Kai Brodersen
Martin Kintzinger
Uwe Puschner
Einleitung
Überblick
In dieser Einleitung werden Grundbegriffe aus der Migrationsforschung vorgestellt, um diese dann auf die antike Migrationsgeschichte anwenden zu können. Dabei ist wichtig zu betonen, dass unsere modernen Vorstellungen von Migration anhand nationalstaatlicher Realitäten des 19. Jahrhunderts gebildet wurden. Deswegen hat man vormodernen Epochen lange Zeit gar kein Migrationspotential zuschreiben wollen. Dieses Buch tritt den Gegenbeweis an.
Odysseus und Migration
Odysseus war ein internationaler Langzeitmigrant. Zumindest erfüllte er die aktuellen Kriterien der Vereinten Nationen für diesen Status geradezu in idealtypischer Weise. Gemäß der UNO-Richtlinien ist ein Migrant zunächst einmal jemand, der seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort dauerhaft verlässt. Wenn er darüber hinaus Landesgrenzen überschreitet, wird der einfache Migrant zum internationalen Migranten. Jemand, der sein Heimatland länger als ein Jahr verlässt, wird nach Definition der Vereinten Nationen zum Dauer- oder Langzeitmigranten (long-term-migrant).
Stichwort
UNO-Definitionen von Kernbegriffen zum Themenfeld Migration
Die IOM, die „International Organization of Migration“ der UNO, verweist in mehreren Publikationen auf gängige Definitionen für Migration und Migranten: Ein internationaler Migrant ist nach UNO-Definition: „Jede Person, die sich außerhalb des Staates aufhält, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, bzw. im Falle von Staatenlosen in dem Staat, in dem sie geboren wurde oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat.“ Ein Langzeitmigrant ist demnach „eine Person, die für einen Zeitraum von mindestens einem Jahr in ein anderes Land als das ihres gewöhnlichen Wohnsitzes umzieht, so dass das Zielland tatsächlich zu ihrem neuen gewöhnlichen Wohnsitz wird“.
(https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf).
Odysseus erfüllt all diese modernen Kriterien aufs Vorbildlichste. Bereits sein einjähriger Aufenthalt bei der Zauberin Kirke lässt ihn das letztgenannte Kriterium erfüllen, die sieben Jahre bei der Nymphe Kalypso machen ihn sogar zum „very-long-term migrant“, ganz zu schweigen von seinem zehnjährigen Kriegsdienst vor den Mauern Trojas. Die abendländische Kultur- und Literaturgeschichte beginnt also mit einem lupenreinen Migrationsepos.
Quelle
Homer, Odyssee VII. Gesang, 255–264 (Übersetzung: W. Schadewaldt):
Die Götter brachten mich zur Insel Ogygia, wo Kalypso wohnt, die flechtenschöne, die furchtbare Göttin. Sie nahm mich auf und tat mir sorgsam Liebes an und ernährte mich und sagte, dass sie mich unsterblich und alterslos machen wollte alle Tage. Doch konnte sie niemals den Mut in meiner Brust bereden. Dort blieb ich sieben Jahre unablässig, und immer benetzte ich die Kleider mit Tränen, die unsterblichen, die mir Kalypso gegeben hatte. Doch als mir nun das achte umlaufende Jahr kam, da trieb sie mich und befahl mir heimzukehren, auf eine Botschaft des Zeus hin.
Will man Migration in der Antike genauer beschreiben, so eignen sich allerdings die Kriterien der Vereinten Nationen nicht wirklich, da sie vom modernen Nationalstaat als Referenzrahmen ausgehen. Auch hat ein moderner Migrant vor seiner Wanderung gefälligst einen festen gewöhnlichen Aufenthaltsort vorzuweisen. Nomaden wie auch antike Seefahrer passen hier nicht ins Konzept. Für vormoderne Migranten war allerdings in erster Linie das Überschreiten von Kultur- und Sprachgrenzen entscheidendes Kriterium für ihren „internationalen“ Status, da staatliche Grenzen, wenn es sie gab, nicht mit den Grenzen heutiger Nationalstaaten verglichen werden können.
Moderne Konzepte und antike Migration
Viel nützlicher für die Beschreibung antiker Migrationsphänomene ist der Ansatz des amerikanischen Migrationsforschers Patrick Manning (geb. 1941). Migration ist demnach zunächst einmal ganz einfach nur die Bewegung von Individuen oder Gruppen von einem Ort an den anderen. Entscheidender Faktor ist dabei, dass Grenzen (boundaries) im weitesten Sinne, nicht unbedingt Staatsgrenzen, überschritten werden. Manning betont dabei, dass diese Grenzen in erster Linie sprachlich, kulturell und sozial gezogen sind, es kann sich im Einzelfall (bei Beispielen aus der Moderne oder der Gegenwart) auch um Staatsgrenzen handeln.
Nicht Landegrenzen, sondern Kultur- und Sprachgrenzen
Diese Kultur- und Sprachgrenzen überschreitende Bewegung, die verschiedene Adaptionsleistungen von Migranten wie auch von den Aufnahmegesellschaften verlangt, unterscheidet einfache Mobilität von Migration. Mit diesem Konzept einer „cross-community migration“ lassen sich die meisten Fälle historischer, aber auch moderner Wanderungen erfassen und mit dem Kriterium sprachlich-kultureller Grenzüberschreitung auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner bringen. In diesem Buch wird nur von dieser soziale, kulturelle und sprachliche Grenzen überschreitenden Migration die Rede sein, zu der bisweilen auch Formen der modernen „Binnenmigration“ zu rechnen sind, die in den Statistiken der UNO übrigens nicht aufgenommen sind. Damit bezeichnet man im Kontext moderner Staatlichkeit Wanderungen, bei denen keine Staatsgrenzen überschritten werden, etwa Arbeitsmigration innerhalb Deutschlands (Schwaben in Berlin), aber auch über tausende von Kilometern hinweg (etwa in Indien oder Russland). Dabei werden allerdings kulturelle und sprachliche Grenzen überwunden, die bisweilen größer sind als etwa bei einer „internationalen“ Wanderung zwischen Belgien und Frankreich. Wer etwa als „Binnenmigrant“ vom indischen Punjab in den Bundesstaat Tamil Nadu (Madras) übersiedelt, findet sich in einer kulturell wie auch kulinarisch völlig anderen Welt wieder. (Ähnliches gilt für den Schwaben in Berlin.) Das Panjabi (ein indoiranischer Sprachzweig des Indogermanischen) gehört allerdings – anders als Schwäbisch und Berlinerisch – nicht einmal entfernt der gleichen Sprachfamilie an wie das in Madras gesprochene Tamil (eine dravidische Sprache).
Moderne Migrationskonzepte und die Antike
Das moderne Konzept ist daher unter den Gegebenheiten der Antike nicht anwendbar, da so etwa sämtliche Wanderungen innerhalb des römischen Reiches, eines viele Völkerschaften umfassenden Rechtsraums, als derartige „Binnenwanderungen“ gelten müssten. Die eingangs erwähnte enge UNO-Definition verweist mit ihrer Beschränkung auf nationalstaatliche Konzepte indirekt bereits auf einen wichtigen Sachverhalt: Migration wird in der allgemeinen Wahrnehmung wie auch in Teilen der sozialwissenschaftlichen Migrationsforschung als ein Problem der Gegenwart (sogar als „das Problem der Gegenwart“ Tagesspiegel 30.7.2019) oder allenfalls der Neuzeit betrachtet. Beide Grundannahmen sind falsch. Weder ist dauerhafter Ortswechsel über große Distanzen oder kulturelle Grenzen hinweg auf jüngere Epochen beschränkt, noch handelt es sich bei Migration grundsätzlich um ein Problem. Denn Wanderungen gehören von Anbeginn zum menschlichen Wesen dazu und kennzeichnen unsere Art, kennzeichnen den homo sapiens, der sich nur durch Migration über den Erdkreis ausbreiten konnte. Unsere eigene jüdischchristliche Mythologie beginnt sogar mit einer Migrationsgeschichte: Der Vertreibung aus dem Paradies (ein Fall von Zwangsmigration). Darüber hinaus sind gerade in vormodernen (und damit schriftlosen) Zeiten die Verbreitung und der Austausch von Wissen und Kulturtechniken (etwa Ackerbau in der Jungsteinzeit) nur durch gewaltige Mobilität und Migration möglich gewesen.
Beschränkungen moderner Migrationsforschung
Bis vor kurzem hat man allerdings vormodernen Epochen überhaupt jedwedes Migrationspotential absprechen wollen. Diese Phasen der Menschheitsgeschichte seien allenfalls, so der einflussreiche Kulturgeograph und Soziologe Wilbur Zelinsky (1921–2013), von Mobilität (etwa in Form von Nomadismus) geprägt gewesen. Erst seit den 1980er Jahren hat die historische Migrationsforschung Fahrt aufgenommen und wichtige Ergebnisse vorlegen können (in Deutschland vor allem durch die einschlägigen Arbeiten von Klaus J. Bade, geb. 1944, und Dirk Hoerder, geb. 1943). Jedoch beschränkt sich die „klassische“ Migrationsgeschichte weitgehend auf die Epochen, für die reichlich empirisch auswertbare Quellen sprudeln, also auf die Segmente der Neuzeit. Deswegen setzen die meisten Migrationsgeschichten selten vor dem 18. Jahrhundert mit ihren Untersuchungen an, oder beziehen allenfalls noch die frühe Neuzeit seit dem 16. Jahrhundert mit ein (Eroberung der „Neuen Welt“). Erst langsam beginnt sich in der Migrationsforschung die Tendenz durchzusetzen, dass Migration über die ganze Menschheitsgeschichte hinweg ein in hohem Maße wiederkehrendes, zeitübergreifendes und weltweites Phänomen war und ist, und sich dies auch anhand des – in der Tat schwieriger zu erfassenden – Quellenmaterials aufzeigen lässt.
Antike und prähistorische Migration
In den letzten beiden Dekaden geriet daher auch die griechisch-römische Antike in den Sog der Migrationsforschung, und einzelne Studien nahmen – vor allem mit Hilfe der Epigraphik, der Inschriftenkunde – das antike Wanderungsgeschehen in den Blick. Zuletzt wurden – dank der neuen Forschungsrichtung „Archäogenetik“ – auch Wanderungsbewegungen früher Populationen seit der Jungsteinzeit untersucht, deren Verlauf sich durch die seit kaum mehr als einem Jahrzehnt mögliche Sequenzierung sehr alter DNS (aDNA) – allerdings nur sehr grob und schematisch – nachvollzogen werden kann. Damit weitet sich das lange gültige, recht schablonenhafte Bild einer auf die Folgen von Industrialisierung, Mobilitätsrevolution (Eisenbahn) und Kapitalismus (Arbeitsmigration) beschränkten neuzeitlichen Migrationsgeschichte derzeit zunehmend aus.
Begriffe und Konzepte
Die große Leistung der soziologischen Migrationsforschung und der Migrationsgeschichtsschreibung der Neuzeit bestand aber darin, das Instrumentarium zur Verfügung zu stellen und die Konzepte und Begrifflichkeiten zu prägen, mit denen wir Migrationsphänomene auch für länger zurückliegende Epochen beschreiben. Jedoch sind diese Begriffe bisweilen im Korsett der modernen Staats- und Gesellschaftsbegriffe gefangen (etwa die geläufigen Begriffe „Auswanderung“ und „Einwanderung“, die gegebene Ausgangs- und Zielgesellschaften als fest geformte Entitäten festlegen). Seit den Pionierarbeiten der Migrationsforschung durch die Chicagoer Schule (Soziologie der Einwanderung) und der Gebrüder Kulischer (Migrationsgeschichte) in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts herrscht weitgehend Einigkeit über die grundlegenden Motive für und die unterschiedlichen Formen von Wanderung (diesen synonymen Begriff verwendete man im Deutschen bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts anstatt von „Migration“). Die wichtigsten Motive und Ausprägungen von Wanderungsverhalten bei Menschen werden im Folgenden mit wenigen Sätzen erklärt.
Stichwort
Die beiden aus Russland stammenden Brüder Alexander und Jewgenij (später Eugene) Kulischer durchlebten ein typisches Flüchtlingsschicksal im 20. Jahrhundert: Nach der Oktoberrevolution führte die Brüder eine Odyssee durch Europa, 1920 zunächst nach Deutschland. Dort publizierten sie gemeinsam eine Arbeit, die erstmals Migration als historisch bedeutsame Kraft erkannte (Kriegs- und Wanderzüge. Weltgeschichte als Völkerbewegung, Berlin-Leipzig 1932). Nach der Machtübernahme der Nazis führte ihr Weg sie weiter nach Frankreich, wo Alexander (1890–1942) von Pétains Vichy-Gendarmen 1942 verhaftet wurde und im Konzentrationslager Drancy ums Leben kam. Seinem Bruder Eugene (Jewgenij, 1881–1956) gelang die Flucht in die USA, wo er ein noch heute richtungsweisendes Buch über die gewaltsamen Verwerfungen und Bevölkerungsverschiebungen zwischen 1917 und 1947 publizierte, gewissermaßen das Neue Testament der Migrationsforschung im 20. Jahrhundert (Europe on the Move: War and Population Changes, 1917–1947, New York 1948).
Motive für Wanderungen
Bei den vielfältigen Motiven für Wanderung hat die empirische Migrationsforschung auf die mit einem temporären oder dauerhaften Ortswechsel verbundenen Erwerbs- oder Ansiedlungsmöglichkeiten verwiesen, ebenso auf die erwarteten besseren Bildungs- und Heiratschancen. Grundsätzlich unterscheidet man bei den Gründen für Wanderung zwischen Graden der Freiwilligkeit. So rangieren zwischen der Intention, ohne essentielle Not andernorts seine Lebensumstände verbessern zu wollen (betterment migration) auf der einen Seite und massiven äußeren Zwängen auf der anderen (forced migration), unterschiedlichste Grade und Formen von sogenannten „Push“- und „Pull-Faktoren“. Naturkatastrophen, aber auch Kriege und Gewaltandrohung (man denke an die systematischen Vertreibungen im 20. Jahrhundert) können als starke Push-Faktoren wirken. Mögliche Ziele von Wanderung empfehlen sich durch „Pull-Faktoren“, die ihre Attraktivität ausweisen (etwa leichter Zugang, Angebot von Privilegien, Chancenpotential usw.).
Diese sehr schematische Vereinfachung auf ein „Push- und Pull-Modell“ greift natürlich viel zu kurz. Bei aus ökonomischen Gründen erfolgenden Wanderungen (betterment migration) bleibt auch das oft angeführte Kriterium der Freiwilligkeit fraglich, da oftmals bedrückende wirtschaftliche Umstände die angebliche Freiwilligkeit konditionieren. Für differenziertere Ausführungen zu den Begrifflichkeiten und Konzepten sei auf die Literatur zur neuzeitlichen Migrationsforschung verwiesen (s. u. und Literaturverzeichnis). Gleichwohl bleibt festzuhalten, dass auch in unserer von Flucht und Vertreibung gekennzeichnete Gegenwart die überwiegende Mehrheit der „internationalen“ Migranten laut UNO-Statistik (ca. 90%, Daten von 2022) aus ökonomischen Gründen wandert und nicht Opfer von Gewaltmigration ist. Dass dennoch 10% der internationalen Migranten das Schicksal von Flucht und Vertreibung in unserem fortschrittlichen Zeitalter erdulden müssen, ist jedoch höchst alarmierend.
„Echte“ Migration in der Antike?
Die allmähliche Ausweitung der Erkenntnisse aus der empirischen Migrationsforschung auf weiter zurückliegende Epochen hat gezeigt, dass es keine Argumente dafür gibt, die allgemeine Gültigkeit der benannten Beweggründe für Migrationsentscheidungen nicht auch für vormoderne Epochen zu akzeptieren. Allenfalls quantitative Aspekte haben sich verändert. Das Zusammenwachsen der Welt (Stichwort „Globalisierung“), die Verbindung entfernter Räume durch Verkehrsmittel und Telekommunikation haben Formen von „Transnationalität“ entstehen lassen, also das dauerhafte Aufrechterhalten von Beziehungen zum Ausgangsort, was zuvor kaum möglich war. Eisenbahn, später Billigfluglinien, Fernsehen und Internet haben neue Ermöglichungsräume für Migration geschaffen und diese erleichtert, die grundlegenden Parameter und Motive für Wanderung indes nicht revolutioniert. Hierfür lässt sich ein treffendes Beispiel aus der römischen Antike anführen, in welchem bereits die entscheidenden Kategorien auftauchen, die auch heute von der Soziologie diskutiert werden. Der auf die Insel Korsika verbannte Philosoph Seneca (1–65 n. Chr.) schreibt tröstend an seine Mutter, dass sein Verbanntenschicksal ganz alltäglich sei, da so viele Menschen ihre ursprüngliche Heimat verließen, dabei verweist er auf die Anziehungskraft Roms („Pull-Faktoren“ in der Terminologie der Soziologen):
Quelle
Seneca, Brief an Helvia, 5, 6, 1:
Aber blicke doch einmal auf diese Volksmenge, für die kaum die Häuser der unermesslichen Stadt [Rom] ausreichen. Aus ihren Landstädten und aus den Kolonien, ja aus dem ganzen Erdkreis sind sie zusammengeströmt. Die einen hat ihr Ehrgeiz hergeführt, die anderen eine offizielle Verpflichtung oder die Teilnahme an einer diplomatischen Mission, wieder andere dann die Genusssucht, die den Ort sucht, an welchem man die Lasterhaftigkeit besonders gut ausleben kann, andere hat die Leidenschaft zur höheren Bildung hergeführt, andere die Schauspiele, manche wiederum zog es aus Freundschaft her, manche hat die Geschäftstüchtigkeit, die hier ein reiches Betätigungsfeld findet, bewogen, ihr Talent hier zu zeigen.
(Ü: M. Rosenbach)
Seneca nennt hier einige typische pull-Faktoren für die Einwanderung in Rom, die auch ebenso für viele moderne Einwanderungsländer und Großstädte gelten könnten. Das gute Geschäftsklima in Rom, das Unternehmer aller Art und Kaufleute anlockt, aber auch Bildungschancen in der Hauptstadt, machen diese als Ziel von Migration attraktiv. Auch weniger noble Motive, wie die Suche nach Genuss und Luxus spricht Seneca an. Die Sklaven (es waren Millionen), die unfreiwillig nach Rom kamen, erwähnt er allerdings nicht, von ihnen wird weiter unten die Rede sein (Kap. VII. 5).
Das Erbe des 19. Jahrhunderts
Dass man lange nicht anerkennen wollte, dass Migration kein exklusives Phänomen der industrialisierten Moderne ist, sondern Teil der menschlichen Natur, und sich zu allen Zeiten manifestierte (in ihrem Ausmaß abhängig von Infrastruktur und technischen Möglichkeiten), liegt in erster Linie am komplexen Erbe der europäischen Geistesgeschichte des 19. Jahrhunderts. In den neuen Nationalstaaten, in denen „Völker“ ihren festen Platz gefunden hatten, und auf welche die gesamte Geschichte nach Ansicht der Zeitgenossen zielgerichtet zugelaufen war, durfte Wanderung nicht stattfinden. Volkstum und Geographie waren unveränderliche und zusammengehörige Einheiten („Blut und Boden“). Im Rahmen der Wiederentdeckung der Weltgeschichte (jetzt „Globalgeschichte“) seit den 1990er Jahren hat sich einiges an diesem überkommenen Blick auf Migration verändert. Dennoch tradieren Schule und Institutionen trotz aller Differenzierungen eine nationalstaatlich grundierte Meistererzählung der modernen Geschichte, in welcher Migration als „Problem“ oder Teil europäischer und weltweiter Leidensgeschichte verstanden wird. Schließlich hat die Disziplin „Geschichtswissenschaft“ ihre Ursprünge genau in dieser Zeit des „Nationbuilding“ im 19. Jahrhundert. Migration erscheint so als oft gewaltsame Störung der normalen und idealen Sesshaftigkeit der europäischen Populationen, die ethnisch und sprachlich gegliedert sind.
Menschen unterwegs, heute und früher
Migration scheint in unserer aktuellen Wahrnehmung das aktuelle Thema zu sein, somit kann vielleicht auch dieses Buch einiges Interesse beanspruchen. Verantwortlich für diesen Sachverhalt sind vor allem die Medien, die weitgehend ohne historischen Tiefenblick unsere Gegenwart als „Zeitalter der Migration“ ausweisen (so auch der Titel eines in vielen Auflagen erschienen englischsprachigen Standardwerks). Ein Blick auf die Statistik zeigt aber, dass überraschenderweise „nur“ etwa 3½% der Weltbevölkerung als (internationale) Migranten gegenwärtig unterwegs sind (UNO, 2022, das sind immerhin rund 280 Millionen Menschen). Was lässt sich aber diesbezüglich zu früheren Epochen sagen? Nur für die Zeit ab dem 19. Jahrhundert lassen sich einigermaßen verlässliche, empirisch überprüfte Daten gewinnen, die einen interessanten Befund liefern. Erstaunlicherweise waren in der zweiten Hälfte des vorletzten Jahrhunderts, dem Zeitalter der transatlantischen Auswanderung aus Europa und nach Datenlage dem eigentlichen „Zeitalter der Migration“, rund 14% der Weltbevölkerung internationale Migranten nach UNO-Standard; also viermal so viele wie heute. Die größten Städte Europas waren zu dieser Zeit von bis zu 50% Einwanderern bevölkert (der Fall Wiens).
Eine Welt ohne Pässe und Grenzkontrolle
Für weiter zurückliegende Epochen lassen sich keine quantifizierbaren Daten gewinnen, jedoch ist der weit verbreitete Schluss, vormoderne Gesellschaften seinen besonders statisch gewesen, nicht zulässig. Oft wird nämlich übersehen, dass erst seit dem 20. Jahrhundert Migrationskontrolle und -steuerung möglich geworden sind. Grenzkontrollen und Passregime, Visa, Fremdenpolizei und Aufenthaltstitel sind rezente Erfindungen, die erst mit den Bürokratien und Organen der Staaten der Zeitgeschichte (ob totalitär oder demokratisch) durchgesetzt werden konnten. Zuvor herrschte – auch in der Antike – ein Grad von Freizügigkeit, der heute kaum vorstellbar erscheint. So schreibt der österreichische Schriftsteller Stefan Zweig (1881–1942) in seinen 1942 erschienen Lebenserinnerungen:
Quelle
Stefan Zweig, Die Welt von Gestern, München 2017, 42:
Vor 1914 hatte die Erde allen Menschen gehört. Jeder ging, wohin er wollte und blieb, solange er wollte. Es gab keine Erlaubnisse, keine Verstattungen, und ich ergötze mich immer wieder neu an dem Staunen junger Menschen, sobald ich ihnen erzähle, dass ich vor 1914 nach Indien und Amerika reiste, ohne einen Pass zu besitzen oder überhaupt je gesehen zu haben. Man stieg ein und stieg aus, ohne zu fragen und gefragt zu werden, man hatte nicht ein einziges von den hundert Papieren auszufüllen, die heute abgefordert werden. Es gab keine Permits, keine Visen, keine Belästigungen; dieselben Grenzen, die heute von Zollbeamten, Polizei, Gendarmerieposten dank des pathologischen Misstrauens aller gegen alle in einen Drahtverhau verwandelt sind, bedeuteten nichts als symbolische Linien, die man ebenso sorglos überschritt wie den Meridian in Greenwich.
Dieses Buch liefert reichlich Belegmaterial dafür, dass Migration auch in vormodernen Epochen eine alltägliche Erscheinung war und gerade die antiken Gesellschaften in entscheidendem Maße geprägt hat, obwohl Wanderung für diese Zeit nicht genauer quantifizierbar ist. Beschwerlichkeit von Reisen und noch begrenzte Beherrschung der Umwelt durch Technik haben sicherlich für Einschränkungen gesorgt, welche die grundlegenden Motive für Migration und ihre unterschiedlichen Formen allerdings nicht qualitativ beeinträchtigt haben. Es gilt immer zu bedenken, dass im Verlauf der Geschichte vor allem Migration und durch sie vermittelter Kulturkontakt für Neurungen, die Verbreitung von Wissen und Kultursynthesen verantwortlich war.
Typen von Wanderung
Die empirische Migrationsforschung hat anhand der Befunde, die vor allem anhand der europäischen Massenauswanderung nach Nord- und Südamerika im 19. Jahrhundert gewonnen wurden, bestimmte typische Formen von Migration definiert. Darunter rangiert die Arbeitsmigration (saisonal oder dauerhaft) im Kontext der Industrialisierung seit der Mitte des 19. Jahrhunderts an erster Stelle. Diese wiederum kann Kettenmigration hervorrufen, wenn bestimmte Regionen von Rückkehrern oder durch Berichte als besonders attraktiv ausgewiesen werden und auf diese Weise noch mehr Auswanderer aus der gleichen Herkunftsregion anziehen. Auf diese Weise entstehen Migrationsnetzwerke, die eine bestimmte Ausgangsregion mit dem Zielort langfristig verbinden können. Dies betrifft etwa Viertel italienischer Arbeiter in Pittsburgh um 1900 genauso wie bestimmte Quartiere im antiken Rom, über die der Dichter Juvenal (ca. 60 – ca. 130 n. Chr.) berichtet und in denen sich Menschen aus dem östlichen Reichsteil, dem heutigen Syrien, angesiedelt hatten. Auf der Wanderung können Migranten anstatt direkt in die avisierte Zielregion zu gelangen auch für längere Zeit (etwa um Mittel zur Weiterreise zu erwerben) oder dauerhaft, weil sich dort ungeahnte Möglichkeiten boten, an einer Zwischenstation leben (Etappenmigration). Heiratsmigration über Kulturgrenzen hinweg lässt sich nach den Untersuchungen einer Forschergruppe um Philipp Stockhammer nun sogar seit der Bronzezeit nachweisen (stabile Heiratsnetzwerke über mehrere hundert Kilometer zwischen dem Lechtal und entfernteren Regionen in Böhmen). Solche Heiratswanderungen waren in den Fürstenhäuser des Mittalters und der Neuzeit an der Tagesordnung und werden für die Gegenwart in transnationalen Migrantennetzwerken erforscht.
Neben der individuellen Ebene können auch Wanderungen von Gruppen historisch beschrieben werden, die sich in einer sehr groben Einteilung etwa zwischen den Polen Kolonisation und Eroberung auf der einen Seite (z. B. die sog. „Völkerwanderung“, Islamische Expansion, Kreuzfahrerstaaten) oder Akkulturation und Integration auf der anderen Seite (etwa polnische Arbeitsmigranten im Ruhrgebiet um 1900) bewegen können.
Handlungsspielräume, „Agency“
Dabei hat die Migrationsforschung vor allem betonen können, dass die Entscheidungsspielräume bei potentiellen Migranten, individuell und gruppenspezifisch (Familienebene, Dorfgemeinschaft) wesentlich größer waren und sind, als man lange im Kontext von festgefügten „Strukturen“ glaubte. Die Vorstellung von Migranten als „Verschubmasse“ in einem von äußeren Zwängen geprägten, teils gesteuerten kapitalistischen Weltsystem entspricht nicht der Realität. Immer verfügten Migranten über „Agency“, über Handlungsspielräume, die bei Migrationsentscheidungen, selbst in akuten Notsituationen, genutzt wurden.
Nomaden