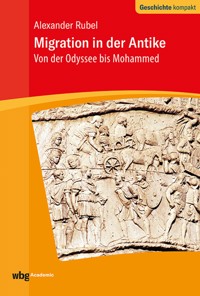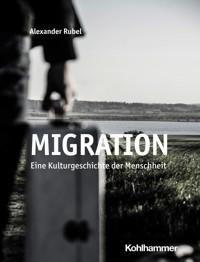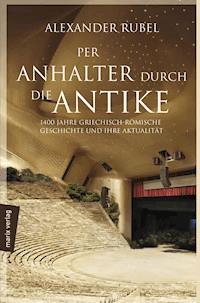
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: marixverlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das, was wir heute geläufig als "Antike" bezeichnen, ist mehr als eine zeitlich ferne Epoche. Die Antike ist seit der Renaissance Vorbild und Kristallisationspunkt der Moderne, der Aufklärung und der gesamten Wissenschaft. Auf ihren geistigen Hinterlassenschaften errichteten Denker, Philosophen und Staatsmänner die Grundpfeiler des heutigen Europas und unserer westlichen Welt. Alexander Rubel liefert einen kenntnisreichen Überblick über die sozial- und geistesgeschichtlichen Realitäten der Antike und macht darüber hinaus die Bedeutung dieser Gründungsepoche des Abendlandes für unsere Gegenwart deutlich. Dem Leser eröffnet sich die schillernde Welt einer der spannendsten und prägendsten Epochen, mit ihren strahlenden Triumphen und dunklen Abgründen. Dieses Buch macht in verständlicher Form und mit erhellenden Beispielen deutlich, dass unsere moderne Welt 2.0 ihre "fremd gewordenen Fundamente" (Manfred Fuhrmann) nicht verleugnen kann. Die Beschäftigung mit der positiven Kraft der Antike ist für unsere Gesellschaft ein Gewinn.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 444
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ALEXANDER RUBEL
PER ANHALTERDURCH DIE ANTIKE
1400 JAHREGRIECHISCH-RÖMISCHE GESCHICHTEUND IHRE AKTUALITÄT
INHALT
Einleitung
Teil I: Historische Grundlagen
1. Griechenland
1.1. Archaische Zeit: Die Geburt des Stadtstaats, Adelskultur und Tyrannis
1.2. Klassische Zeit: Bürgerpolis und Demokratie
2. Rom
2.1. Die römische Republik. Grundlagen des Staates
2.2. Die römische Frühzeit
3. Griechenland. Alexander und der Hellenismus
3.1. Der Aufstieg Makedoniens und Alexander
3.2. Hellenistische Königreiche
4. Rom und der Aufstieg zur Weltherrschaft
4.1. Der Aufstieg Roms: Von den Punischen Kriegen bis zur römischen Revolution
4.2. Herrin der Welt
4.3. Der Untergang der Republik
4.4. Ein neues Zeitalter
4.5. Die römische Kaiserzeit
5. Zusammenführung: Die Spätantike
5.1. Zeichen einer neuen Epoche
5.2. Griechen, Römer und Barbaren
Teil II: Themenkapitel
1. Die antike Gesellschaft
2. Adlige Lebenswelten in Griechenland und Rom
3. Die antike Wirtschaft
4. Religion
5. Szenen aus dem Alltagsleben in der Antike: Sport, Spiele und Feste
6. Die Kultur der antiken Gesellschaft
6.1. Grundsätzliches
6.2. Philosophie
6.3. Die Literatur der Antike
6.4. Architektur und Kunst
Schlussbetrachtung: Die Antike und wir
Danksagung
Kurzbibliographie
Zeittafel
Personenregister
Abbildungsnachweis
Karten
»Diejenigen,welche wir ›die Menschen der Antike‹ nennen,sind in Wahrheit in allem zeitgenössisch.«
(Blaise Pascal)
EINLEITUNG
▪Epochenbestimmung: Was ist eigentlich »die Antike«?
Unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg, der die europäischen Staaten an einen der Menschheit bislang ungekannten Abgrund geführt hatte, erschien bei Teubner ein kleines Bändchen unter dem Titel »Die antike Kultur«, dessen Vorwort nicht nur als zeithistorisches Dokument, sondern auch in seiner positiven, von Hoffnung getragenen kulturgeschichtlichen Aussage beeindruckend ist (Die antike Kultur, in ihren Hauptzügen dargestellt von Franz Poland, Ernst Reisinger, Richard Wagner, Leipzig 1922, alle folgenden Zitate S. III). Darin wird zu einer Zeit, als Deutschland, vom Versailler Friedensvertrag gedemütigt und geschwächt, orientierungslos in eine unsichere Zukunft schaute, die Antike und ihre Kultur als gemeinsames Erbe eines durch Krieg und Feindschaft in die Irre geleiteten Europas und vor allem als ein Orientierungspunkt für das am Boden liegende Deutschland beschrieben: »Im Dunkel einer schweren Zeit zu leben, ungewiß, was der nächste Tag uns bringen wird, – das ist jetzt das Los unseres Volkes. Was uns Trost und Hoffnung spenden könnte, müssen wir in uns suchen, in Gütern, die uns kein Feind rauben kann, wenn wir nicht selber sie preisgeben.«
Zu diesen verinnerlichten Gütern gehört nach Ansicht der Autoren vor allem die Antike, die jedoch kein rein deutsches Kulturerbe sei, sondern in einer hoffnungsvollen Perspektive ganz Europa umfasse, denn:
»Die Kultur der meisten modernen Völker geht aus von der Kultur der Antike, die von den Griechen geschaffen und von den Römern über die Provinzen ihres Weltreichs verbreitet worden ist. […] Zu dieser abendländischen Kulturgemeinschaft aber gehören auch die Völker, die uns zur Zeit noch feindselig gegenüberstehen: auch sie müssen und werden sich über kurz oder lang darauf besinnen, daß sie noch vor wenigen Jahren im friedlichen Wettbewerb mit uns an der Weiterbildung dieser Kultur und an der gemeinsamen Erforschung des Altertums gearbeitet haben.«
Der fromme Wunsch der drei Gymnasialdirektoren und Kriegsteilnehmer sollte sich nicht erfüllen, in den Abgrund, in den Europa 1914/18 schaute, stürzte die ganze Welt 1939/45 hinein. Die Berufung »der meisten modernen Völker« auf die Kultur der Antike blieb und bleibt allerdings eine unbestrittene und unbestreitbare Tatsache, auf der auch dieses kleine Büchlein rund hundert Jahre später aufbaut. Dass es sich dabei um eine Tatsachenfeststellung handelt, muss vielleicht an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich betont werden. Die gegenwärtige Krise Europas lässt ja bei einigen Beobachtern Zweifel aufkommen, ob Europa überhaupt existiere, zumindest ob politisch-kulturelle Integration möglich oder gar erwünschtes Produkt einer historischen Entwicklung sein kann. Die Beantwortung dieser sehr gegenwärtigen Fragen hängt sicher vom Standpunkt des Betrachters ab, wobei britische von kontinentalen Sichtweisen differieren mögen.
Aus der Perspektive des Historikers stellt sich der Sachverhalt jedoch sehr klar dar und entspricht den Einsichten der oben zitierten Altertumswissenschaftler, die vor hundert Jahren eben nicht in einer langen europäischen Friedenszeit lebten, sondern zwischen dem Abfassen ihrer wissenschaftlichen Werke noch ein paar Franzosen erschießen mussten. Aufgrund ihrer Kenntnisse und ihrer Bildung war ihnen aber dennoch deutlich bewusst, dass es eine verbindende kulturelle Grundlage Europas gibt, an der auch und besonders das durch die Infrastruktur des Römischen Reichs erst großflächig verbreitete Christentum erheblichen Anteil hatte. Dass sich die europäischen Staaten nicht nur faktisch (etwa im Bereich des Rechts), sondern besonders auch im Wortsinne »ideologisch« auf das antike Kulturerbe als gemeinsames Gut berufen, benötigt eigentlich keiner Rechtfertigung, jedoch aufgrund des verbreiteten Mangels an Kenntnissen vor dem Hintergrund einer veränderten europäischen Bildungstradition zunehmend einer Erklärung.
Für die strukturelle Einheit der europäischen Kultur auf antiker Grundlage sprechen einerseits offensichtliche Fakten (etwa die Verbreitung romanischer Sprachen und des Christentums, das römische Recht als juristische Grundlage aller europäischer Staaten, gemeinsame Traditionen im Bereich Literatur und Kunst), andererseits aber auch die bewussten »Renaissancen« der europäischen Kulturgeschichte, in denen die Antike als Vorbild und Leitkultur immer wieder revitalisiert wurde. Dass der gemeinsame antike Humus der europäischen Kultur bis vor Kurzem eine gelebte Realität war, eine Basis der Verständigung und selbstverständliches Fundament zivilisierter Kommunikation, zeigt das Beispiel der spektakulären Entführung des Generalmajors Kreipe auf Kreta durch eine Kommandoeinheit der britischen Armee im Jahr 1944, angeführt vom klassisch gebildeten Schriftsteller Patrick Leigh Fermor (nachzulesen in P. Leigh Fermor, Die Entführung des Generals, Zürich 2015).
Mit dem entführten General im Schlepptau kraxelten die Engländer drei Wochen durch die Berge Kretas, auf der Flucht vor deutschen Suchtrupps. Als die kleine Gruppe den schneebedeckten Berg Ida, den mythischen Geburtsort des Zeus, am Horizont erblickte, rezitierte der gefangene General Horaz (Ode an Thaliarchus, carmina 1, 9): »Vides ut alta stet nive candidum Soracte« (Du siehst, im Schneeglanz flimmert Soraktes Haupt [Berg unweit Roms A. R.]). Daraufhin rezitierte sein gelehrter Hüter Fermor die Strophe zu Ende: »nec iam sustineant onus/ silvae laborantes geluque/ flumina constiterint acuto« (Und horch! der Wald ächzt, unter der schweren Last/ Erseufzen dumpf die Wipfel; Kälte/ Fesselt die Wasser mit scharfem Hauche [die Übersetzung ist übrigens von Mörike]). In diesem Moment begriffen die beiden Männer, dass sie vor dem Krieg »aus den gleichen Quellen getrunken hatten«, wie Fermor später bemerkte, und das Verhältnis der beiden Feinde wurde nach diesem Erlebnis für die restliche Flucht von der Insel auf eine neue Grundlage gestellt. Der gegnerische Major wurde so für den deutschen General zu einem sozial Gleichrangigen aus einem anderen europäischen Land, mit dem man gerade einen Krieg – eine ephemere Angelegenheit – ausfechten musste.
Der vom griechischen Historiker Herodot (ca. 490–424 v. Chr.), dem Erfinder der Geschichtsschreibung, in Abgrenzung zu Asien und dem Perserreich geprägte Begriff »Europa« hatte in der Antike allerdings keine politisch-kulturelle Bedeutung. Griechen und Römer waren sich nicht bewusst, dass sie am geistigen Aufbau des Abendlandes mitarbeiteten. So wie Nationalstaaten bekanntermaßen »imaginäre Gemeinschaften« sind (Benedict Anderson), ist natürlich auch der politisch aufgeladene, moderne Europabegriff ebenso wie die von Fermor und seinem General gefühlte kulturelle Verbundenheit das Produkt eines komplexen, aber mit Realien befütterten Rezeptionsprozesses. Erst der geistige Prozess der Rezeption hat die Realität bekräftigt, wenn nicht gar geschaffen, könnte man verkürzt sagen. Dass ein Rumäne aus Bukarest einen Italiener problemlos verstehen kann, wenn dieser langsam und nicht über Existenzphilosophie spricht (und nicht aus Sizilien kommt), ist nun mal ein dem Römischen Reich und seiner Integrationsleistung geschuldetes Faktum und schafft eine Gemeinsamkeit, die kein deutsch-chinesisches »Joint Venture Business« jemals erreichen kann.
Selbst für diejenigen, die aufgrund der veränderten Bildungslandschaft diese Bezüge nur unbewusst im Alltag erleben, wenn sie etwa auf dem Behördenweg zu ihrem neuen Pass eine »Odyssee« durchleben und vom Fotografen bis zum zuständigen Kommunalbeamten »von Pontius zu Pilatus« geschickt werden, bleibt die Antike eine moderne Realität. Diese Tatsachenfeststellung hat nichts mit Propaganda für ein vereinigtes Europa zu tun, auch nichts mit einem naiven historischen Determinismus, der in der Integration der Europäischen Union das Walten des Hegel’schen Weltgeistes erkennen will. Beschreibt man die europäische Kultur als antikes Erbe (übrigens hat daran Osteuropa über die byzantinische Schiene fast genauso großen Anteil, man denke an Moskau als »das dritte Rom«), so ist das keineswegs Ausfluss konservativer Heilsvisionen, sondern einfach nur das Resultat eines simplen Faktenchecks. Aber wie lässt sich »die Antike« eigentlich genauer definitorisch bestimmen, und was bedeutet das antike Erbe in der heutigen Welt 2.0? Den ersten Teil der Frage will diese kurze Einleitung, den zweiten Teil das Buch in seiner Gesamtheit versuchen zu beantworten.
Der Begriff »Antike« fasst in seiner allgemeinen Verwendung die griechisch-römische Mittelmeerkultur des Zeitraums von ungefähr 800 v. Chr. bis ca. 600 n. Chr. zusammen (grob gesagt von der archaischen Epoche der griechischen Kultur bis zum Ende der Herrschaft des oströmischen Kaisers Justinian I. oder gar bis zum Beginn des sogenannten Arabersturms nach dem Auszug Mohammeds von Mekka nach Medina 622 n. Chr.), rund 1400 Jahre Geschichte also. Als Epochenbegriff setzt sich der Begriff »Antike« (von lat. antiquus, alt, altehrwürdig) erst zu Beginn des 20. Jh.s wirklich nachhaltig durch, was die Frage aufwirft, ob wirklich alles, was dieser durch Rezeptionsprozesse gewonnene Ausschnitt aus der Geschichte des Altertums umfasst, auch tatsächlich der Sache nach zusammengehört. Darüber hinaus ist der Begriff eng verbunden mit dem wertenden Begriff des »Klassischen«, wie etwa in der verbreiteten Begriffsbildung »klassische Antike«. Dieses Konzept entstammt einer europäischen Bildungstradition, die die Kunst und Kultur des Altertums im Vergleich zu den Produkten der jeweiligen Gegenwart prinzipiell als höherwertig betrachtete und die Antike übersteigernd idealisierte. Außerdem werden die Epochengrenzen und die räumliche Dimension der antiken Welt von Zeit zu Zeit diskutiert bzw. unterschiedlich ausgelegt.
So wird bisweilen die Zeit der minoischen- und mykenischen Palastkulturen Kretas und Griechenlands (etwa 2000–1100 v. Chr.) mit zur griechischen Geschichte und somit zur Antike gerechnet, ebenso wie die für die abendländische Kulturgeschichte ebenfalls bedeutsame bronzezeitliche Hochkultur der Ägypter am Nil. Der Altertumswissenschaftler Eduard Meyer plädierte Ende des 19. Jh.s mit guten Argumenten für eine Ausweitung des Altertumsbegriffs auch auf die vorderasiatischen Hochkulturen des Alten Orients. In der Tat ist der über die Levante vermittelte Einfluss orientalischer Vorbilder auf die frühe, archaische griechische Kultur kaum zu überschätzen, wie auch von Ägypten aus kulturelle Einflüsse in den südöstlichen Mittelmeerraum hineinwirkten. Interessanterweise hat man das semitische Karthago, nicht nur eine Wirtschaftsmacht, sondern eine bedeutende Hochkultur in hellenistischer Zeit mit weitreichenden Verbindungen, wie überhaupt die Phönizier generell nie in den Kanon der »Antike« aufnehmen wollen.
In diesem kleinen Büchlein wird nicht nur aus Platzgründen, sondern in erster Linie aufgrund sachlicher Argumente der »engere« Antikenbegriff verwendet, der »nur« die griechisch-römische Kultur vom archaischen Griechenland bis zur Spätantike umfasst. In Abweichung vom »klassischen« Ideal werden allerdings auch die Erben der antiken Welt unter dem problematischen und irreführenden Stichwort »Barbaren« kurz zur Sprache kommen, denn auch die frühmittelalterlichen Nachfolger der Römer haben einen entscheidenden Anteil an der modernen Gestalt Europas. Aus diesen Vorbemerkungen wird bereits ersichtlich, dass die griechisch-römische Antike und ihre Kultur in diesem Band, ohne indes auf der »klassischen« Vorbildlichkeit dieser Epoche zu bestehen, entwicklungsgeschichtlich als konstitutiv für das moderne Europa angesehen werden.
Die griechisch-römische Kultur der Mittelmeerwelt gehört aus zwei Gründen tatsächlich im Sinne einer Epochen- und Kultureinheit ganz eng zusammen. Einerseits entstanden sowohl die griechischen Staaten wie auch das antike Rom aus republikanisch verfassten Stadtstaaten mit unterschiedlichen, aber dennoch vergleichbaren politischen Regeln und Institutionen der Bürgerbeteiligung. In Teilen erhielten sich diese Strukturen bis in die Zeit Ciceros und Caesars. Andererseits entsprachen sich auch die Formen der gesellschaftlichen Ordnung in hohem Maße. Sie beruhten auf akzeptierter, gesellschaftlicher Ungleichheit, wobei die Führung durch Vertreter einer durch Reichtum und Tradition privilegierten Oberschicht erfolgte. Das galt weitgehend ebenfalls für die als Ausnahmeerscheinung zu betrachtende berühmte Demokratie der Athener, deren Führungsfiguren zunächst nur dem Adel, später auch der Gruppe reicher bürgerlicher Emporkömmlinge entstammten.
Auch die Wirtschaft funktionierte bei Griechen und Römern nach vergleichbaren Grundprinzipien, wobei die zu großen Teilen auf Sklavenhaltung beruhende Landwirtschaft die Grundlage bildete, in der der Getreideanbau bei weitem dominierte. Desgleichen waren die künstlerischen Ausdrucksformen und städtebaulichen Konzepte der Griechen und Römer weitgehend vergleichbar. Besonders aber die Verbreitung und überaus kreative Nutzung der Schriftlichkeit in vielen öffentlichen und privaten Belangen war ein Kennzeichen der mediterranen Kultur der Antike. Das Griechische und das Lateinische beherrschten als Erinnerungs- und Archivmedium (etwa in den vielen bis heute erhaltenen, öffentlich ausgestellten Inschriften), aber auch und besonders als Literatursprache die gesamte Mittelmeerwelt, und dies sogar bis ins Mittelalter und die frühe Neuzeit. Der östliche Teil Europas, Kleinasien und die Levante wurden dabei vom Griechischen, der westliche und nördliche Teil Europas vom Lateinischen beeinflusst. So wurden die Schriften des Neuen Testaments von Mitgliedern einer jüdischen Sekte mit reichlich Sendungsbewusstsein auf Griechisch verfasst, wodurch auch das Neue Testament ein integraler Bestandteil der mediterranen Kultur der Antike ist.
Die Wirkung der kulturellen und zivilisatorischen Leistungen – die neben den literarisch-geistigen Errungenschaften auch Ingenieurwesen, Straßenbau und Wasserversorgung umfasste – auf die benachbarten Völker war enorm, sodass sie diese Vorbilder teils als mittelbare Folge militärischen Zwangs, oft aber auch bereitwillig in der Nachfolge des Alexanderzugs sowie bei der Ausbreitung des römischen Weltreichs übernahmen und sich zu eigen machten. Die Römer selbst waren eigentlich die ersten Adressaten dieses komplexen Rezeptionsprozesses der antiken Kultur, indem sie die griechische Kultur (v. a. in Form literarischer Vorbilder) in einem eigenwilligen Anpassungsprozess zu ihrer eigenen machten. Sie waren sich dabei ihrer Abhängigkeit von griechischen Vorbildern immer bewusst, verstanden sich aber selbstbewusst – aufgrund ihrer militärischen Überlegenheit und auch aufgrund der ganz selbstverständlich und unkompliziert erfolgenden Aneignung der griechischen Leitbilder – mit den Griechen zusammen als gemeinsame Träger einer im weiteren Sinne gemeinsamen Zivilisation. Bereits diese hier nur kurz gestreiften Sachverhalte legen nahe, die Antike als eine zusammengehörige Kulturepoche zu begreifen.
Andererseits ist die griechisch-römische Antike auch durch mehrstufige Rezeptionsprozesse seit der Renaissance in unserer Wahrnehmung zu einer unverbrüchlichen Einheit geformt worden. Die immer wieder von Neuem geführte Auseinandersetzung mit der lange als vorbildhaft empfundenen antiken Überlieferung, in deren Tradition auch jeder neue Beitrag zum Thema, also auch dieses Buch, steht, war maßgeblich für die Ausbildung der »klassischen« bzw. »klassizistischen« Epochen und »Renaissancen« in der abendländischen Kultur verantwortlich und bestimmt bis in die Gegenwart unser in antiken Kategorien gespiegeltes Selbstbild. Auguste Rodin, Aristide Maillol oder Wilhelm Lehmbruck orientierten sich bei der Schöpfung ihrer plastischen Bildwerke der Moderne eben nicht an persischen Königsreliefs oder der Kunst der Khmer, sondern an der Formsprache antiker Skulpturen. Für die Berechtigung der Epocheneinteilung der griechisch-römischen Welt des Altertums als »Antike« sprechen somit sachliche Gründe, also die vielen Gemeinsamkeiten der griechisch-römischen Zivilisation, wie auch Gewohnheitsgründe und aus der Rezeptionsgeschichte gewonnene Kategorien. Implizit rechtfertigt dies zugleich auch eine »Geschichte der Antike« für den modernen Gebrauch.
Wie aber – in Zeus’ oder Jupiters Namen! – sollen rund 1400 Jahre Geschichte auf wenigen Seiten sinnvoll und übergreifend zusammengefasst werden? Das ist in der traditionellen Weise und mittels chronologisch erzählender Form schlichtweg unmöglich und kann bzw. soll hier gar nicht unternommen werden. Dafür gibt es dickere Nachschlagewerke, Hand- und Studienbücher, die umfassende Informationen chronologisch und nach Sachgebieten gegliedert bieten (siehe Literaturhinweise am Ende der Einleitung). Das Buch folgt daher einem anderen Ansatz und versucht ereignisgeschichtliche Reihungen zugunsten einer »szenischen« Präsentation zu minimieren, die allerdings naturgemäß viele einzelne historische Ereignisse auslassen muss, um die Grundlinien der Entwicklung aufzuzeigen. Zur prinzipiellen Orientierung dient die Zeittafel am Ende des Buchs. In der Darstellung selbst wird jedoch eher sprunghaft verfahren und im häufigen Wechsel zwischen den beiden Hauptakteuren, Griechen und Römern, versucht, typische Wesenselemente der antiken Gesellschaften und kulturgeschichtliche Besonderheiten anhand von Quellen herauszustellen, um so den Charakter dieser Epoche fassen zu können.
Dabei wird ein erster Teil in chronologischer Form die historischen Zusammenhänge, allen voran die politischen Entwicklungen in Griechenland und Rom verfolgen, woran sich eine bündige Betrachtung der Spätantike bis zum Ende der Völkerwanderung anschließt. Der zweite Teil wendet sich dann kultur- und sozialgeschichtlichen Sachverhalten zu, die gemeinsam für die griechische und die römische Antike betrachtet werden. Abschließend wird in einer Schlussbetrachtung die Bedeutung der Rezeptionsgeschichte hervorgehoben und ein Ausblick gewagt, was die Antike für die moderne Welt noch heute bedeuten kann.
Insgesamt ist das Büchlein damit ein Dokument der notwendigen Auslassungen und Verkürzungen. Dem Autor ist dabei bewusst, dass auf diese Weise gebotene Differenzierungen – etwa die für Fachleute ohnehin ausgemachten Unterschiede zwischen der griechischen Geschichte und Gesellschaft sowie der römischen Kulturgeschichte – zugunsten einer zusammenhängenden Betrachtungsweise der Antike unter den Tisch fallen bzw. wesentlich gröber skizziert werden müssen, als das bei einem ausführlicheren Handbuchkonzept möglich wäre. Diese Vorgehensweise bringt es auch mit sich, dass existierende Forschungskontroversen über bestimmte Fragen, die bisweilen Regalmeter in Bibliotheken belegen und erbitterte Feindschaften zwischen Gelehrten begründet haben, einfach stillschweigend übergangen werden. Gleichzeitig bietet dieser Ansatz die Möglichkeit, einmal der Frage nachzugehen, was wirklich wesentlich an der antiken Geschichte ist, und wie man die Epoche in ihrer Wesensart in einem Gesamtzugriff fassen kann.
Dieses Buch versteht sich als Türöffner für Neugierige, als Einladung für diejenigen, die ausgehend von ihnen nur vage erinnerten Bildungsbruchstücken einmal einen kurzen Blick auf die Antike riskieren möchten. Auch Studierende geisteswissenschaftlicher Fächer, die erkannt haben, dass die Gegenstände ihrer Fächer ohne antike Kulturgeschichte nur schwer verständlich sind, gehören zu den Adressaten dieses Buches, ebenso wie der im angelsächsischen Sprachraum treffend als »general reader« bekannte allgemein interessierte Leser. Auch der Bereich der Schule könnte von dem Buch profitieren, wenn etwa Geschichtslehrer ihr Wissen im Überblick auffrischen wollen, oder wenn Schüler, für die ein geraffter Überblick der Antike nützlich sein könnte, dieses zur Hand nehmen. Im besten Falle weckt diese Buch Appetit auf mehr und veranlasst den Leser, sich ein wenig intensiver mit den Ursprüngen der europäischen Geschichte und den kulturellen Grundlagen der westlichen Welt auseinanderzusetzen.
Die Antike ist nichts weniger als das Fundament der gerade in jüngster Zeit viel beschworenen »abendländischen Kulturgemeinschaft«, wie bereits die drei Autoren des zu Beginn erwähnten Buches nach der Erfahrung der »Urkatastrophe« des 20. Jh.s nicht ohne Pathos feststellten. Aufgrund seines einführenden Charakters sind natürlich alle Quellen in deutscher Übersetzung wiedergegeben. Literaturnachweise aus der modernen Forschungsliteratur erfolgen in gleicher Weise nur, wenn direkt auf ein Werk verwiesen oder daraus zitiert wird. Die Auswahl der Hinweise zur vertiefenden Lektüre – für jedes Kapitel gesondert am Ende zusammengestellt und kurz kommentiert – beschränkt sich auf wenige, aus Sicht des Autors gut lesbare deutschsprachige (oder ins Deutsche übersetzte) Darstellungen und Fachbücher, deren Auswahl durchaus auch persönlichen Präferenzen geschuldet ist.
▪Geographische und klimatische Voraussetzungen der antiken Zivilisation: Das Mittelmeer
In Norwegen hätte sich die antike Zivilisation nicht entwickeln können. Der Einfluss von Klima- und Umweltbedingungen auf die Entwicklung menschlicher Gemeinschaften vor dem Zeitalter technischer Innovationen, Maschinenkraft und Elektrizität seit dem 19. Jh. wird oft unterschätzt. Jenseits von simplem geopolitischem Determinismus, der in Überschätzung natürlicher Raumgrundlagen die historischen Entwicklungen von Gesellschaften und Staaten in einen sehr direkten Bezug zu den geographischen Gegebenheiten setzt, bleibt festzuhalten, dass der Mittelmeerraum günstige Voraussetzungen für den Aufstieg der antiken Zivilisation bot.
Ein Schlüssel zum Verständnis der antiken Welt ist das Mittelmeer. Das geographisch gesehen als großes Becken aufzufassende Mittelmeer bedeckt eine Fläche von rund 2,5 Millionen km2 und ist maßgeblich verantwortlich für das trocken-milde Klima des Mittelmeerraums, das die Voraussetzung für ökonomisches Wachstum sowie die Freisetzung von Ressourcen in der Antike war und den Menschen des Mittelmeergebiets die Möglichkeit eröffnete, sich anderen Dingen als allein dem Überlebenskampf zu widmen. Bereits der griechische Philosoph Poseidonios (135–51 v. Chr.), der den Aufstieg Roms zur Weltmacht als Zeitzeuge miterlebte, erkannte die klimatische Mittellage Italiens als eine wichtige Voraussetzung für die römische Berufung zur Weltherrschaft und wollte, wie andere antike Autoren auch, die Entwicklung der verschiedenen Völker in erster Linie klimatischen Einflüssen zuschreiben.
Das mediterrane Klima kennt keine kalten und damit lebens- und produktionsfeindlichen Winter. Im Sommer bestimmt das Azorenhoch das klimatische Geschehen. Es breitet sich praktisch über den ganzen Mittelmeerraum aus und lässt das Wüstenklima nach Norden wandern. Wenig Wind und viel Sonne sind die unmittelbare Folge. Im Winter verlagert sich das Hoch meist nach Süden und lässt den Mittelmeerraum im Einflussbereich der über dem Atlantik gesättigten Westwinde zurück. Kalte Polarluft strömt nur selten und unter ganz bestimmten Bedingungen ins Mittelmeergebiet ein. Diese Konstellation sorgt für milde, regenreiche Winter und heiße, trockene Sommer. Die im ganzen Raum verbreiteten Terra-Rossa-Böden eignen sich aufgrund ihrer Speicherfähigkeit für Wasser gut zur landwirtschaftlichen Produktion. Kalkhaltigere Braunerden, vor allem im nördlichen Bereich des Mittelmeergebiets zu finden, eignen sich hingegen für Weinanbau. Fast im gesamten Mittelmeerraum, zumindest in den tieferen Lagen unter 500 m, gedeihen die anspruchsvollen, in der Antike ökonomisch sehr wichtigen Olivenbäume, die nur zwischen dem 30. und 45. Grad nördlicher bzw. südlicher Breite überleben können.
Die Landschaften des Mittelmeergebiets sind aber weit davon entfernt, als »Garten Eden« gelten zu können, da weite Landstriche, besonders in Griechenland, aber auch die italischen Apenninen, von karstigen Gebirgszügen dominiert werden. Diese konnten nur teilweise landwirtschaftlich genutzt werden, weshalb in diesen bergigen Regionen die halbnomadische Viehwirtschaft verbreitet war. Diese Reliefanordnung bringt es mit sich, dass die sehr fruchtbaren Regionen des Gebiets weitgehend mit den Küstenstreifen und ihrem meist überschaubaren Hinterland identisch waren. Einige Gegenden in Italien, vor allem aber Sizilien, verfügten nach Auskunft der Quellen (etwa Varro, Über die Landwirtschaft, 1, 44, 1–2; Cicero, Reden gegen Verres, 2, 3, 112) über ausgesprochen gute Bodenbedingungen für den Getreideanbau und im Falle Siziliens auch über großflächige Anbaugebiete im Binnenland.
Im Vergleich zur frühen Neuzeit oder zu den bekannten Ernteerträgen aus Entwicklungsländern ohne moderne Techniknutzung, wo etwa der vierfache Ertrag des Saatguts eingebracht werden kann, konnten dort recht hohe 8- bis 15-fache Erträge realisiert werden. Bestimmte Gegenden in Italien (etwa bei Sybaris im Golf von Tarent), Syrien und Nordafrika hätten sogar auf besten Böden bis zu 100-fache Erträge gebracht. Aufgrund dieser natürlichen Bevorzugung der Küstenregionen (oder umgekehrt wegen der Benachteiligung des bergigen Binnenlandes) waren die bedeutenden Siedlungen der griechisch-römischen Antike und ihre Bewohner im Wortsinne aufs Meer ausgerichtet, das somit Mittel- und Bezugspunkt der antiken Lebensorganisation wurde.
Obwohl das Meer von seinen antiken Anrainern als feindliches Element betrachtet wurde und vielerlei Gefahren mit ihm verbunden waren, war seine Nutzung als Fischgrund und vor allem durch die Schifffahrt essentiell für die griechisch-römische Antike. Bei allen Gefahren, die die Seefahrt mit sich brachte, war und ist das Mittelmeer im Vergleich zu den Weltmeeren doch ein recht ruhiges Gewässer, in dem praktisch keine Wirbelstürme, wie die Hurrikane des Atlantiks oder die Taifune in Südostasien, auftreten. Zudem ist das Mittelmeerbecken ringsherum weitgehend von windbrechenden Gebirgszügen umgeben, sodass bei anhaltenden Winden aus einer Richtung niemals ein solcher Wellengang entsteht, wie er etwa auf dem Atlantik mit seiner hohen Wellenbildung zu beobachten ist, der die Schifffahrt auf dem Mittelmeer dauerhaft und ernsthaft gefährden würde. Dennoch vermieden es die Griechen und Römer im Winter zur See zu fahren und bevorzugten auch im Sommer nach Möglichkeit die Küstennavigation.
Obwohl die Römer es mare nostrum (unser Meer) nannten, ist das Mittelmeer eigentlich ein griechisches Meer. Die Römer haben sich – abgesehen von der Fischerei – erst spät und aus militärischer Notwendigkeit im Kontext der Punischen Kriege (nach 264 v. Chr.) dem salzigen Nass zugewendet. Die Griechen waren jedoch – man denke an die Geschichten von Odysseus, dem »Seeräubersohn aus Ithaka« (P. Huchel) – von Anbeginn an ein eingeschworenes Seefahrervolk.
Dass das Mittelmeer mehr verband als trennte, zeigt der intensive Austausch zwischen Ost und West, die Kultureinflüsse aus dem Vorderen Orient und vor allem die kreative Übernahme der phönizischen Schrift, die zusammen mit anderen Faktoren den erstaunlichen Aufstieg der griechischen Stadtstaaten und ihre mit dem Schlagwort »Kolonisation« bezeichnete Ausbreitung im ganzen Mittelmeerraum und an den Küsten des Schwarzen Meeres bedingte; ein sensationeller Aufstieg einer Kultur, den man zu Zeiten der bedingungslosen Griechenverehrung im 19. Jh. »das griechische Wunder« genannt hat.
▪Quellen unseres Wissens über die Antike
Die griechisch-römische Antike war eine Schriftkultur. Daran ändern auch zutreffende Beobachtungen hinsichtlich der größeren Bedeutung des gesprochenen Worts im Vergleich zu unseren modernen Gesellschaften nichts. Man schrieb Nachrichten auf Wachstäfelchen, benutzte Borke von Bäumen zum Einritzen von Notizen oder schrieb auf Lederstücken. »Bücher« schrieb man von Hand auf Papyrus, ein aus Pflanzenfasern der Papyrusstaude gewonnenes Geflecht, das man zu Schriftrollen verband. Da die Rollen selten mehr als 10 m umfasst haben dürften, erstreckten sich umfangreichere »Bücher« über mehrere Rollen, »volumen/volumina« (Gerolltes), wie auch heute noch die Bandeinteilung von Werken auf Englisch und in den romanischen Sprachen heißt. Die Literatur der Antike umfasste im Wesentlichen bereits die Genres literarischen Schrifttums, die wir auch heute pflegen: Geschichtsschreibung, Philosophie, Drama, Epik, Lyrik, Rhetorik, wissenschaftliche Fachliteratur und sogar den Roman. Wichtige Beschlüsse, Gesetze, Ehrungen, Epitaphe oder Weihungen an Götter wurden in Stein gemeißelt und waren zur dauerhaften öffentlichen Präsentation bestimmt.
Von all diesem umfangreichen Schrifttum hat sich allerdings nur ein klitzekleiner Bruchteil erhalten. Notizen aus dem Alltagsleben haben sich bspw. nur in ganz geringen Spuren dort erhalten, wo die klimatischen Bedingungen dafür günstig sind. Im feuchten Boden von Vindolanda am Hadrianswall in Nordengland fand man Schreibtäfelchen mit Briefen und Kurznachrichten, etwa eine Einladung der Ehefrau des Lagerkommandanten an andere Soldatenfrauen zu einer Soirée. Der Brief eines aus dem heißen Orient stammenden Soldaten enthält die Bitte an seinen Vater, ihm einen warmen Mantel in die kalte Einöde des englischen Nordens zu schicken. Die meisten Alltagszeugnisse, Hafenlisten, Abrechnungen von Gutsverwaltern, Bilanzen und Briefe stammen aus dem griechischen und römischen Ägypten und den angrenzenden Gebieten, deren trockenes Wüstenklima die Papyri konserviert haben. In einer Höhle am Westufer des Toten Meers hat sich beispielsweise das Familienarchiv einer Jüdin namens Babatha aus der römischen Provinz Arabia erhalten, die ihre Steuerbescheide, ihre Besitzurkunden, einen Ehevertrag und andere wichtige Dokumente in den unruhigen Zeiten des von Simon Bar Kochba geführten jüdischen Aufstands gegen das Römische Reich (132–135 n. Chr.) in Sicherheit brachte. Derartige Zeugnisse sind deshalb für die Historiker so interessant, weil sie nicht für sie oder andere Leser abgefasst, sondern ohne die Intention einer Veröffentlichung nur der Sache wegen aufgeschrieben wurden.
Bei den meisten Zeugnissen aus der Antike, die uns erhalten geblieben sind, handelt es sich indes um solche, die sich an eine Öffentlichkeit richten und deswegen auch entsprechend ihrer Intention interpretiert werden müssen. Grabinschriften, Weihungen, Gesetzestexte, Volksbeschlüsse usw. bestimmten – auf Stein gemeißelt oder manchmal auf Bronzetafeln graviert – den öffentlichen Raum und haben aufgrund des haltbaren Materials bisweilen die Zeiten überdauert. Der Hauptbestand unserer schriftlichen Quellen wird allerdings von erzählenden Quellen aus der literarischen Produktion antiker Schriftsteller gespeist.
Diese Schriften haben sich aber nicht – oder nur in den seltensten Fällen – in direkter Linie aus der Antike erhalten. Gelehrte und Literaten unterhielten Bibliotheken und ließen ihre Schreiber Kopien von Handschriften anfertigen, in deren Besitz sie gelangten. Darüber hinaus entstanden in den Kulturhauptstädten der Antike – etwa in Athen, Alexandria, Pergamon, Rom und Konstantinopel – Bibliotheken mit beachtlichen Sammlungen, die an Philosophenschulen angeschlossen waren oder von Mäzenen bzw. Herrschern gefördert wurden. Die berühmteste war die seit dem 3. Jh. v. Chr. vom Herrscherhaus der Ptolemäer finanzierte Bibliothek von Alexandria, die eine wahrhaftige Institution des antiken Buchwesens mit dem größten Buchbestand war, dessen tatsächlicher Umfang jedoch unbekannt ist. Sie beinhaltete möglicherweise um die 500 000 Schriftrollen.
Auf den Buchmärkten von Athen und Rhodos wurden Schriftrollen angekauft und gehandelt. Die Kapitäne der in den Hafen einlaufenden Schiffe mussten zudem den Bibliothekaren ihre Bücher für kurze Zeit zum Kopieren überlassen und erhielten wohl nicht selten nur die Kopien zurück, während die Originale in die Bestände aufgenommen wurden. Dass trotz des wenig haltbaren Materials (Papyrus ist weit weniger haltbar als modernes, säurefreies Papier) und der mühsamen Kopierarbeit von Hand dennoch viele Texte aus der Antike überliefert sind, verdanken wir den mittelalterlichen Schreibstuben in den Klöstern des Westens, besonders aber den byzantinischen Gelehrten. Die Überlieferung der antiken Schriften ist nämlich das Resultat eines mittelalterlichen Rezeptions- und Selektionsprozesses. Nur diejenigen antiken Autoren, die dem christlichen Mittelalter als vorbildlich erschienen oder zu Lehrzwecken nötig waren, wurden kopiert und – das war entscheidend – auf Pergament in den Codices der Spätantike und des Mittelalters, ein von Holzdeckeln umschlossener Block aus gefalteten oder zusammengehefteten Pergamentblättern, überliefert. Denn Pergament, das in besonders hochwertiger Qualität wohl zuerst im antiken Pergamon hergestellte Beschreibmaterial (daher der »Markenname«), das aus nicht gegerbten, aber speziell bearbeiteten Tierhäuten besteht (besonders Ziegenhäuten), hält bei ordentlicher Pflege bis in alle Ewigkeit, wie über 1000 Jahre alte mittelalterliche Handschriften in unseren Bibliotheken und Museen belegen.
Auf diese Weise erhielten sich griechische und lateinische Texte, die zu Codices gebunden wurden, bis in die Zeiten des modernen Buchdrucks, der die günstige Vervielfältigung dieser wertvollen Handschriften ermöglichte. Optimistische Schätzungen, die von ca. 3000 überlieferten Autorennamen aus der Antike abstrahieren, gehen davon aus, dass unter 10 % des antiken Schrifttums erhalten geblieben sei. Jedoch ist anzunehmen, dass wesentlich mehr Autoren eine wesentlich größere Anzahl an Werken in den ca. 1000 Jahren von ca. 500 v. Chr. bis 500 n. Chr. verfasst haben. Pessimistischere – und wahrscheinlichere – Szenarien legen deshalb nahe, dass weniger als 1 % des nichtchristlichen antiken Schrifttums bis in die Moderne überlebt hat. Dies ist auch der Grund, weshalb unsere umfangreicheren Kenntnisse über antike Staaten und Gesellschaften auf wenige, herausragende Zentren der antiken Welt beschränkt sind. Athen, Sparta und Rom dominieren dabei in einem ungebührlichen Maß. Große Zentren wie Alexandria, Antiochia, Syrakus oder Milet rangieren weit dahinter, was Erwähnungen und Erläuterungen in den Quellen betrifft.
Ein Beispiel mag diese durch den Quellenmangel verursachte Verengung unseres Blicks illustrieren: Im heutigen Rumänien, ca. 20 km hinter der antiken Küstenlinie des Schwarzen Meeres, liegt die größte befestigte Siedlung dieses Landstrichs – 24 ha sind ummauert –, die spätrömische Stadt Ibida. In einer Nebenbemerkung des Historikers Prokop finden wir die – von einem spätbyzantinischen Schriftsteller abgesehen – einzige Nennung dieser bedeutenden Stadt, auf deren Gebiet sich große Mengen von Keramikresten aus der Spätantike finden, die eine große Bevölkerung und die Versorgung von Truppen in dieser Stadt nahelegen. Hätte Prokop die Siedlung nicht in die Liste der Städte aufgenommen, deren Befestigungen auf Geheiß von Kaiser Justinian I. im 6. Jh. n. Chr. instand gesetzt wurden, und außerdem ungefähr lokalisiert, wüssten wir nicht einmal den Namen dieser bedeutenden Stadt.
Die historischen Quellen sind deshalb grundlegend für unser Verständnis der antiken Welt. Zwar haben archäologische Forschungen im letzten halben Jahrhundert unser Wissen enorm erweitert und geholfen, neues Licht in die materielle Alltagskultur der Antike zu bringen, dennoch erlauben nur die Schriftquellen die Verbindung von komplexen Sachverhalten zu Sinnzusammenhängen und damit zu einem historischen Narrativ. Wie wichtig das ist, mag man an den Problemen der Prähistoriker erkennen, die eine Vielzahl »kultischer« Gegenstände aus der Erde bergen, jedoch keine Ahnung haben, welchem Zweck diese dienten und welcher Sinngehalt den Dingen und den mit ihnen verbundenen Handlungen zukommt. Dieser Mangel an Wissen wird mit oft auf anthropologischem Vergleich fußender Theoriebildung kompensiert.
Die vor diesem Hintergrund so wichtigen, im engeren Sinne historischen Schriften – literarische Werke haben natürlich auch ihre historische Bedeutung und können bis zu einem gewissen Grad als historische Quellen benutzt werden – unterscheiden sich aber in erheblichem Maße von denen, die wir heute als solche betrachten. Geschichtsschreibung ist in der Antike eine literarische Gattung, der ein anderer Wahrheitsbegriff und eine völlig andere Quellenkritik zugrunde liegt. Deswegen müssen die antiken Quellen aus der Feder verdienter und anerkannt »glaubwürdiger« Historiker wie Herodot, Thukydides, Sallust und Tacitus einer rigorosen Quellenkritik, wie sie im 19. Jh. entwickelt wurde, unterzogen werden, wobei die jeweiligen Tendenzen und Intentionen berücksichtigt werden müssen.
Der Althistoriker Moses Finley hat einmal die Situation seiner Zunftgenossen, die eine ganz andere ist als etwa die der Neuzeithistoriker, die in Archiven reiche Ernte halten und über Bevölkerungsevidenzen, Grundbuchdaten und Kirchenbücher verfügen, treffend mit einem Vergleich beschrieben: Man stelle sich vor, ein Historiker, der den Russlandfeldzug Napoleons erforschen und beschreiben will, habe nur Tolstois »Krieg und Frieden« sowie in der russischen Erde gefundene Uniformreste und ein paar Lafetten zur Verfügung. Nur so kann man etwa ermessen, wie moderne Fachleute mithilfe des Thukydides und einiger archäologischer Zeugnisse aus Athen und anderen Städten den Peloponnesischen Krieg rekonstruieren müssen.
Lektürehinweise:
Unter den vielen Gesamtdarstellungen zur Antike ragt unter den umfangreicheren Dahlheim (2002) hervor. Schüller (2004) verbindet Übersichtlichkeit mit sprachlicher Klarheit. Für ein studentisches Publikum haben Gehrke und Schneider (2006) ein Handbuch verfasst. Geographische Sachverhalte finden sich nach Schlagworten in Sonnabend (1999). Zum Buch- und Bibliothekswesen der Antike siehe Jochum (2007) und Blank (1992). Zur Überlieferungsgeschichte der antiken Texte Pöhlmann (1994).
TEIL IHISTORISCHE GRUNDLAGEN
1.
GIECHENLAND
1.1. Archaische Zeit: Die Geburt des Stadtstaats, Adelskultur und Tyrannis
▪Einstieg ins Thema: Was uns Scherben mitteilen können.
Abb. 1 zeigt eine Tonscherbe, auf der griechische Buchstaben eingeritzt sind. Diese kleine Scherbe ist gewissermaßen die Nussschale, in die ich das gesamte antike Griechenland hineinpacken möchte. Das ist vielleicht etwas vermessen, aber man wird sehen, dass viele Aspekte der griechischen Lebenswelt sich anhand dieses kleinen Stücks Ton anschaulich machen lassen.
Abb. 1: Óstrakon mit der Aufschrift »Aristeides Lysimacho«
Zunächst einmal handelt es sich bei der Scherbe um ein sogenanntes Óstrakon, eine beim athenischen Scherbengericht, dem Ostrakismós, verwendetes Stimmtäfelchen. Das Scherbengericht war eine bemerkenswerte Institution, mit der die Athener unliebsame Politiker für zehn Jahre ohne weitere Angabe von Gründen in die Verbannung schicken konnten (nur noch die Stadt Syrakus auf Sizilien verfügte über ein ähnliches Verfahren, bei dem aber Olivenbaumblätter verwendet wurden). Diese Erfindung entsprang der Furcht der Athener, eine unter den maßgeblichen Führungspersönlichkeiten könnte sich zum Alleinherrscher, zum Tyrannen aufschwingen. In der Praxis diente diese Institution aber im 5. Jh. v. Chr. dazu, grundlegende Entweder-oder-Entscheidungen zu vereinfachen, indem man den Meinungsführer einer politischen Richtung oder Handlungsoption ins ehrenhafte Exil verbannte: also aus den Augen, aus dem Sinn. Der erste Ostrakismós ist für 487, der letzte für 417 v. Chr. überliefert. Später wurde die Institution stillschweigend aufgegeben, aber nicht abgeschafft.
Diese Óstraka, von denen man in Athen über 11 000 gefunden hat, tragen immer einen Namen eines Politikers, denn jeder Athener durfte einen ganz beliebigen Namen (es gab keine »Shortlist« von Verbannungskandidaten) auf eine Stimmscherbe ritzen. Das geschah maximal einmal pro Jahr und auch nur, wenn die Mehrheit der Volksversammlung, Ekklesía genannt, die Versammlung der männlichen, erwachsenen Bürger, für die Abhaltung eines Scherbengerichts votierte. Dann mussten mindestens 6000 Stimmen auf einen einzigen Mann fallen, damit dieser ins Exil geschickt werden konnte. Unser Óstrakon nennt Aristeides, Sohn des Lysimachos. Und tatsächlich musste Aristeides, den man »den Gerechten« nannte, im Jahr 483 v. Chr. ins Exil gehen. Er lag seinerzeit im Streit mit einem anderen Meinungsführer, Themistokles. Inhaltlich ging es in der Auseinandersetzung darum, wie man gegen die Bedrohung durch das Perserreich vorgehen sollte. Als die Perser dann 480 v. Chr. mit Heeresmacht nach Griechenland kamen, wurde Aristeides, wie alle im Exil weilenden Führungskräfte, im Rahmen eines »Burgfriedens« zurückbeordert und kämpfte als gewählter General, Stratege genannt (es gab in klassischer Zeit neun Strategen, die jährlich gewählt wurden), loyal an der Seite des Themistokles, der den athenischen Oberbefehl innehatte.
Was sagt uns aber diese 2500 Jahre alte Tonscherbe über die griechische Antike, außer der immerhin faszinierenden Tatsache, dass es sich um ein reales, physisches Überbleibsel einer spannenden politischen Richtungsentscheidung handelt? Grundsätzlich zeigt uns die Scherbe und die mit ihr verbundene Prozedur, dass bei den Griechen, zumindest den Athenern, eine ganz besondere politische Debattenkultur existierte, die bisweilen klare Richtungsentscheidungen erforderlich machte. Darüber hinaus zeigt die Institution des Scherbengerichts eine auffällige Erfindungsgabe für komplizierte Verfahrensweisen. Auf die Idee, in dieser Weise, einmal pro Jahr, aber nur auf Verlangen der Mehrheit abzustimmen und dann mit einem hohen Quorum als Regulativ gegen Politiker-Bashing, muss man erst einmal kommen!
Ein anderer Aspekt, der sich anhand der Óstraka aufzeigen lässt, ist die herausragende Bedeutung des Materials, das uns in diesem Fall in Form von kreativem Recycling begegnet: Die Keramik. Für die Antike meistens Alltagsgeschirr, sind viele erhaltene griechische und römische »Vasen« heute wertvolle Museumsstücke, und für bemalte Keramik aus Korinth oder Athen werden bei Sotheby’s Spitzenpreise erzielt. Keramik und ihre Nutzung war ein wichtiger Teil des Alltagslebens in der Antike. Ein ganzer Wirtschaftszweig ernährte sich von der Produktion dieser fragilen Ware, etwa die Meister und Händler im Töpferviertel Athens, dem Kerameikos.
Gebrannter Ton überdauert die Zeiten wie kaum ein anderes Material und ist deshalb für die Archäologen von eminenter Bedeutung. Da Gefäße aus Ton (die Archäologen sprechen von Vasen – von italienisch vaso; mit dem gebräuchlichen deutschen Wort für ein Behältnis für Schnittblumen hat der Begriff jedoch nichts zu tun) leicht zu Bruch gehen und im Gegensatz zu wertvollen Metallprodukten nur in Ausnahmefällen – wie beim Scherbengericht – wiederverwendet werden können, bilden die Millionen Tonscherben aus der Antike, die die Zeiten überdauert haben, eine der wichtigsten Quellen für die Archäologie. Das betrifft einerseits kunst- und kulturgeschichtliche Sachverhalte, denn viele der griechischen Vasen sind mit wunderbaren Motiven aus der Mythologie und auch aus dem Alltagsleben bemalt. Andererseits aber bilden die Überreste der griechischen (wie überhaupt antiker) Keramik die Grundlage eines chronologischen Gerüstes, das auf der Analyse der relativen Abfolge von Stil- und Formentwicklungen sowie Herstellungsweisen basiert.
Dieser von ästhetischen Fragen völlig unabhängige Aspekt antiker Keramik wird angesichts der kunstgeschichtlichen Bedeutung wertvoller Vasen oft etwas vernachlässigt. Die Experten, die ihr Leben damit zubringen, etwa korinthische Keramik systematisch in ein chronologisches Gerüst einzuordnen und auf ihre relative und absolute Chronologie hin abzugleichen – in vielen Fällen können Vasen sogar definitiv bestimmten Malern zugeordnet werden –, gehören nicht immer zu den Stars der Branche (und manche von ihnen haben auch vergessen, dass es außer Tonscherben noch andere Dinge auf der Welt gibt). Ohne sie wären viele chronologische Einordnungen und absolut chronologische Anpassungen von archäologischen Funden aber kaum möglich. In jedem Fall ist uns die (Alltags-)Keramik wichtiger, als sie den Griechen oder Römern war. Sie haben sie achtlos nach Gebrauch weggeworfen. Wir freuen uns heute über jeden Neufund von noch so kleinen Scherben in den Müllhalden antiker Siedlungen, erst recht, wenn Namen wie Aristeides, Themistokles oder Perikles darauf eingeritzt sind.
Für einen weiteren Aspekt, der sich aus unserem Scherbengerichtsbeispiel ergibt, müssen wir Abb. 2 und den griechischen Autor Plutarch bemühen, der rund 500 Jahre nach diesen Ereignissen seine Informationen darüber aufschrieb: Plutarch berichtet uns in seiner Biographie des Aristeides (Kap. 7), dass ein Bauer an diesem Ostrakismós des Jahres 483 v. Chr. teilnahm und seinen Nachbarn in der Volksversammlung bat, ihm doch behilflich zu sein, den Namen Aristeides auf eine Scherbe zu ritzen. Auf die Frage des hilfsbereiten Nachbarn, was er denn gegen diesen Aristeides habe und ob er ihn überhaupt kenne, gab der Bauer zu verstehen, dass ihn an diesem ihm unbekannten Politiker lediglich ärgere, dass er sich »der Gerechte« nennen lasse. Der Angesprochene, der, wie gebeten, den gewünschten Namen auf die Scherbe ritzte, war natürlich niemand anderes als Aristeides »der Gerechte« selbst.
Ganz erstaunlich ist aber das Óstrakon in Abb. 2, auf dem der Name Aristeides mit unsicherer, zittriger Hand, der zur Identifizierung eines Bürgers nötige Vatersname darunter dann zunächst falsch geschrieben und im Anschluss durchgestrichen wurde. Die gleiche unsichere Hand hat auch den Namen des »Demos«, des dörflichen Verwaltungsbezirks von Athen, in welchem Aristeides zu Hause und in dem sein Name in die Bürgerliste eingetragen worden war – nämlich den des Demos »Alopeke« –, fehlerhaft eingeritzt und durchgestrichen. Darunter findet sich jedoch mit anderer, kräftiger, gut lesbarer Handschrift neu geschrieben der zunächst verhunzte und dann durchgeschriebene Vatersname »Lysimachos« (im Genitiv, im Sinn von »Sohn des Lysimachos«). Hier hat ganz klar ein hilfsbereiter Mitbürger mit besseren Schreibfertigkeiten ausgeholfen; vielleicht wirklich Aristeides, der Gerechte, selbst?
Abb. 2: Óstrakon mit Einritzungen von unterschiedlicher Hand
Auch wenn wir skeptisch bleiben und trotz dieses Óstrakons nicht annehmen wollen, dass die viel zu schöne Anekdote Plutarchs den Tatsachen entspricht (Funde von seriell, mit gleicher Hand beschriebenen Óstraka mit einem einzigen Namen, die wohl von den Gegnern vor der Versammlung verteilt worden waren, lassen Zweifel berechtigt erscheinen), wirft der Sachverhalt doch ein Licht auf eine für die griechische Kultur und die Kultur der Antike generell bedeutsame Frage: Die Verbreitung der Kenntnis des Lesens und des Schreibens, kurzum das Thema Schriftlichkeit. Einerseits verweisen die vielen Tausend Óstraka zusammen mit den vielen öffentlich in Athen und anderen griechischen Städten aufgestellten Inschriften darauf, dass Lese- und Schreibkenntnisse offenbar weitverbreitet, gewissermaßen sogar essentiell für die Teilhabe an politischen Entscheidungen wie dem Scherbengericht waren. Andererseits zeugen aber gerade das Beispiel von Aristeides »dem Gerechten« bei Plutarch und das Óstrakon von Abb. 2 auch davon, dass eine generelle Schriftkenntnis nicht grundsätzlich und immer vorausgesetzt werden darf.
▪Schriftkultur versus Mündlichkeit
Sicher war aber die Schriftrevolution im 9. Jh., als die Griechen das phönizische Alphabet zu einer einfach zu erlernenden und leicht zu gebrauchenden Lautschrift umgewandelt hatten, eines der für das Abendland bedeutendsten Ereignisse. Da das Phönizische als semitische Sprache weitgehend ohne Vokale auskam, mussten die Griechen nur einige Schriftzeichen, für die sie keine Verwendung hatten, zu Vokalen umfunktionieren, um ein flexibles, auf Lautwerten aufbauendes Zeichensystem zu haben, mit dem jeder Sprachlaut abgebildet werden kann. Damit entwickelte man das erste Schriftsystem, das sowohl reinen Konsonanten als auch Vokalen eigene Zeichen zuwies. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass diese Neuerung auf eine kleine Gruppe, vielleicht sogar einen einzigen Mann zurückgeht. Der Gräzist Ulrich von Wilamowitz-Moellendorf sprach in diesem Zusammenhang von einem »unbekannten Wohltäter der Menschheit«. Bis heute beherrscht die erste Alphabetschrift mit ihren kyrillischen und lateinischen Ablegern weite Teile der Welt. Diese neue Schriftform sowie das Bedürfnis, sie auch ausgiebig in unterschiedlichen Kontexten zu verwenden, haben eigentlich die Griechen erst wirklich zu den Begründern der abendländischen Kultur gemacht. Denn ihrer Literatur (von Drama bis Philosophie), die über die römische und dann die humanistische Tradition ihren Weg ins moderne Europa gefunden hat, sowie deren lange gültigen Modellfunktion verdanken wir einen Großteil unserer Denkgewohnheiten.
Dabei war der Weg der Griechen zur Schriftkultur keineswegs ein Selbstläufer und Schriftkenntnis allein ist nur die Voraussetzung zur Entwicklung einer Schriftkultur (die Inka oder die Kelten etwa kannten Formen von Schrift, machten jedoch nur geringen, an spezielle Kontexte gebundenen Gebrauch davon). Dass sich in Griechenland und (zunächst vorbildhaft) in Athen eine Schriftkultur entwickeln konnte, hängt nicht in erster Linie mit der Ausbildung einer Literaturtradition oder der Notwendigkeit religiöser Kommunikation zusammen, wie man aus heutiger Sicht wohl zunächst vermuten könnte, sondern mit der Herausbildung der typischen auf Bürgergemeinschaften beruhenden, recht eigenartigen griechischen Staatswesen, deren Grundlage die in unterschiedlichen Graden erfolgende Beteiligung der Bürger an den politischen Entscheidungsprozessen war. Diese Stadtstaaten nannten sich Poleis, in der Einzahl Polis. Die Polis als – davon abgeleitet – »politisches« Ordnungssystem und als Lebensraum bildete sich fast zeitgleich mit der Übernahme der Schrift im 8. und 7. Jh. v. Chr. aus.
▪Die Entstehung der Stadtstaaten und die griechische Kolonisation: Die Polis als Stadt und Lebensraum
Zuvor hatten die Griechen bzw. ihre Vorfahren, die sogenannten »Mykener«, also die Träger der nach dem wichtigsten Ort auf der Halbinsel Peloponnes, Mykene, benannten bronzezeitlichen mykenischen Palastkultur, in von Königen beherrschten Städteburgen gelebt. Auch nach dem aus völlig ungeklärten Gründen um 1150 v. Chr. erfolgten Niedergang dieser durch zentrale Verwaltung geprägten Palastkulturen, zu deren wichtigsten Zentren in Griechenland neben Mykene auch Tiryns, Theben oder Pylos gehörten, war die Herrschaft eines Fürsten oder Königs über nunmehr kleinere Einheiten die übliche Organisationsstruktur der überschaubaren Gemeinwesen.
Das wissen wir – abgesehen von archäologischen Erkenntnissen aus den Ausgrabungen der »Paläste« solcher Kleinkönige (etwa Lefkandi auf Euböa) – vor allem dank der beiden Dichtungen, die am Anfang der griechischen Schriftkultur stehen: Ilias und Odyssee. In diesen etwa in der zweiten Hälfte des 8. Jh.s v. Chr. entstandenen Epen wird die Welt der griechischen Kleinkönige beschrieben, wie sie sich den Rhapsoden, den fahrenden Sängern dieser Zeit, aus der Überlieferung darstellte. Dabei lässt sich nicht mehr trennen, ob die Sänger um 750 v. Chr. eher die etwas geschönten gesellschaftlichen Umstände der kleinen Stammeskönigtümer der sogenannten »Dunklen Jahrhunderte« nach dem Untergang der mykenischen Kultur in ihren Versen beschrieben, oder ob noch weiter reichende Erinnerungsfetzen aus der Zeit der Paläste in den Dichtungen enthalten sind. Offiziell geben Ilias und Odyssee – die, das sei hier nur ganz kurz erwähnt, nicht vom gleichen Autor stammen – in der Tat vor, die Geschichte einer glorreichen Vergangenheit zu berichten, in der die Führer der Mittelmeerwelt aufgrund eines Frauenraubs und befeuert durch ihren Stolz einen Krieg um die Vorherrschaft, den Trojanischen Krieg, führen.
Realistisch gesehen berichtet die etwas später als die Ilias, nämlich wohl um 700 v. Chr. herum entstandene Odyssee aber nicht nur von den phantastischen Irrfahrten des namensgebenden Helden Odysseus, sondern wartet mit einigen Realien hinsichtlich ihrer Entstehungszeit auf. Denn genau in dieser Zeit lässt sich die Entstehung der eigenartigen Organisationsform »Polis« beobachten. Sie wird schon in der Odyssee beschrieben. Dort wird von der Gründung der Phäakenstadt Scheria berichtet (die Phäaken sind ein friedliebendes Phantasievolk), in der Odysseus gastliche Aufnahme findet und die bereits über wesentliche Elemente eines griechischen Stadtstaates verfügte: »Aber sie [die Phäaken] führte von dannen Nausithoos, ähnlich den Göttern,/ Brachte gen Scheria sie, fern von den erfindsamen Menschen,/ Und umringte mit Mauern die Stadt, und richtete Häuser,/ Baute Tempel der Götter, und teilte dem Volke die Äcker.« (Od. 6, 6 ff., Hervorhebungen A. R.).
Von Ausnahmen abgesehen ist die griechische Polis eine befestigte Siedlung, wie auch die Stadt der Phäaken im Epos. Polis meint auch etymologisch zunächst einmal den befestigten Ort – die »Akropolis« ist die erhöht gelegene Burg. Die zitierte Stelle aus der Odyssee verweist auch noch auf weitere wichtige räumliche Gliederungen griechischer Städte: Die Häuser der Menschen und die Häuser der Götter, die Tempel, sowie den zur Stadt gehörenden Ackerboden im unmittelbaren Umland der Polis, der Chora. In diesem Hinterland existierten oft zur Polis gehörige ländliche Siedlungen, die man vielleicht am besten mit Dörfern vergleichen kann, von den Griechen »Komen« oder »Demen« genannt.
Zu dieser idealtypischen Raumordnung gehört auch und besonders der städtische Versammlungsplatz, der ebenfalls schon in den homerischen Epen erwähnt wird: die Agora. Dieser öffentliche Raum ist der Versammlungsplatz der Gemeinschaft, aber auch Ort des Rechts und Platz für religiöse Feste. Der Versammlungsplatz der Polis war von alters her der Ort, an dem das ganze Volk am öffentlichen Leben, an religiösen Zeremonien und athletischen Spielen teilnahm. Natürlich diversifizierten sich im Laufe der Entwicklung die öffentlichen Räume und die Poleis entwickelten zum Teil unterschiedliche Traditionen. So verfügte Athen etwa über drei wichtige öffentliche Räume, einen Versammlungsplatz zur politischen Entscheidungsfindung (die Pnyx), die Agora als Marktplatz und Ort des Meinungsaustauschs, sowie einen Gerichtsplatz (den Areopag). Dennoch blieb die Agora das zivile Zentrum der Polis, was auf die von Anfang an integrierende Bedeutung der Bürgerbeteiligung für die griechischen Stadtstaaten verweist.
▪Polis als Exportprodukt: Die griechische Kolonisation
Diese grundlegende räumlich-funktionale Gliederung der Polis war schon zu einem recht frühen Zeitpunkt ausgeprägt, als sich die alten »homerischen« Kleinkönigtümer zunehmend in Einheiten verwandelten, in denen immer mehr Männer die politische Verantwortung untereinander aufteilten. In dieser Frühphase der antiken Poliskultur Griechenlands, der sogenannten »archaischen Zeit« (ca. 750–500 v. Chr.) fand gleichzeitig mit wichtigen politischen Veränderungen, die langfristig auf die Ausbildung von Bürgergesellschaften mit einem immer breiteren Kreis an politisch Berechtigten hinausliefen, ein bedeutender Prozess statt, den man allgemein als »griechische Kolonisation« bezeichnet. Der Begriff führt etwas in die Irre, da die auswandernden Griechen nicht etwa fremde Völker unterwarfen und große Gebiete in Anspruch nahmen, sondern an den Gestaden des Mittelmeers und des Schwarzen Meers (gr. Pontos Euxeinos) solche Orte aufsuchten, an denen sie möglichst unbehelligt ihre neuen, zunächst kleinen Gemeinschaften aufbauen konnten. Dabei nutzten sie für ihre landwirtschaftlichen Interessen nur überschaubare Gebiete des Hinterlands. Alle griechischen Neugründungen waren Küstensiedlungen und auf Handel und Kommunikation mit den übrigen Griechenstädten zum Meer hin ausgerichtet.
Als wichtigste Ursache für die Auswanderungsbewegung wird eine sprunghafte Zunahme des Bevölkerungswachstums im griechischen Kernland angesehen, die archäologisch durch eine größere Bestattungsdichte in dieser Zeit – zumindest für die gut untersuchten Gebiete Attika und Argos – nachgewiesen werden konnte. Zu dem massiven Bevölkerungswachstum gesellten sich in vielen Fällen weitere Faktoren, wie Dürren oder Missernten hinzu, die den Exodus forcierten.
Meist erfolgte die Auswanderung freiwillig unter der Führung eines angesehenen Mannes. Einem solchen Aufruf folgten dabei besonders abenteuerlustige und verarmte Mitglieder der entsendenden Metropolis (Mutterstadt). In einigen Fällen allerdings, wie bspw. in der Stadt Thera auf der Ägäisinsel Santorin, wurden junge Männer auch ausgewiesen, um eine neue Stadt zu gründen (hier Kyrene in Nordafrika). Durch die Not nach anhaltender Dürre beschlossen die Theraier, »dass aus allen sieben Gemeinden der Insel immer je einer von zwei Brüdern um die Auswanderung losen sollte«. Als die so zur Auswanderung gezwungenen jungen Männer nach einer ersten erfolglosen, da halbherzigen Ausfahrt wieder nach Hause zurückkehrten, wurden ihre Schiffe bei der Einfahrt in den Hafen von ihren ehemaligen Mitbürgern und Verwandten beschossen und zur Umkehr gezwungen. Die beim griechischen Historiker Herodot wiedergegebene Geschichte (4, 153) unterstreicht die genannten Faktoren für die massive Auswanderungswelle seit dem späten 8. Jh. Sicherlich mögen im Einzelfall auch Abenteuerlust und Entdeckersinn bei Auswanderern eine Rolle gespielt haben und manch ein Glücksritter wird die Chance beim Schopf ergriffen haben.
Die meisten Gründungen waren tatsächlich erfolgreich und manchmal übertraf die Apoikie (Pflanzstadt) bereits nach wenigen Generationen die Metropolis an Prosperität. Auch die Kolonien sandten ihrerseits wiederum Siedler aus, die neue Städte gründeten. Nach den ersten erfolgreichen Neugründungen bildete sich so etwas wie ein typisches Prozedere für die Kolonisation aus. Eine Gruppe junger Männer, kaum mehr als 200, scharte sich um einen Anführer, der meist auch für nötige Investitionen aufkam (Schiffe) und holte dann das entscheidende Votum beim Orakel in Delphi ein, das sich nach den Worten des Altertumswissenschaftlers Humphrey Kitto zu einer Art »colonial research bureau« entwickelt hatte. Denn in Delphi, dem griechischen Tor zur Welt, trafen sich bei den überregionalen religiösen Festen für den Gott Apoll Griechen ›aus aller Herren Länder‹, die vielseitige geographische und nautische Kenntnisse besaßen, sodass auch die Priesterschaft und die orakelnde Pythia – das war die in höchstem Ansehen stehende Priesterin, die allein die Orakel verkündete – über geeignetes Wissen verfügten, interessante Zielorte für Koloniegründungen auszuweisen.
Waren die Auswanderer am Bestimmungsort angekommen, wurde der Platz provisorisch befestigt. Manchmal überwinterten die Neusiedler zunächst sicherheitshalber auf einer vorgelagerten Insel und erkundeten das Gebiet. Im folgenden Jahr wurde das Land gerecht in gleichgroße bzw. ähnlich ertragreiche Landlose (kléroi) aufgeteilt und dann unter den Gefährten verlost. Dieser Sachverhalt ergibt sich nicht nur aus den Quellen (auch die Odyssee spricht bei der oben zitierten Ordnung der Phäakenstadt von der Zuteilung des Landes), sondern auch aus dem archäologischen Befund. Durch Ausgrabungen und Luftbildaufnahmen konnten auf Sizilien und in Süditalien gerasterte, von Straßen regelmäßig durchzogene Stadtanlagen belegt werden, deren Planung von Anbeginn gleich große Streifengrundstücke im Stadtzentrum für die Siedler vorsah.
Hatten die Neusiedler die ersten Jahre glücklich überstanden und sich friedlich mit den Einheimischen arrangiert oder die bodenständige Bevölkerung gewaltsam überwunden bzw. zurückgedrängt, stand ihnen eine blühende Zukunft bevor, wie die Erfolgsgeschichten der griechischen Pflanzstädte belegen. Dabei sollte man bei aller Bedeutung, die dem Fernhandel zukam, nicht vergessen, dass es den Kolonisten zunächst und in erster Linie um die Gewinnung neuen Ackerlandes ging, und dass somit die Landwirtschaft für die Versorgung und für das nachhaltige Wachsen und Gedeihen der Pflanzstädte von entscheidender Bedeutung war.
Die Siedler nahmen sich – im Einverständnis oder aber durch Raub – einheimische Frauen. Einige warteten auch auf Zuzug von Nachzüglern aus der alten Heimat, mit der intensiv Kontakt gehalten wurde und in der sich nach erfolgreicher Koloniegründung viele Auswanderungswillige, darunter offenbar auch Frauen, fanden, die nun kein so großes Risiko mehr tragen mussten.
Als Ergebnis konnte Platon im 4. Jh. v. Chr. bildhaft sagen, dass die Griechen mit ihren Städten um das Meer herum säßen, wie Frösche um einen Teich (Phaidon 109). Die Ausbreitung der griechischen Poleis im westlichen und östlichen Mittelmeer, sowie im Pontosgebiet sorgte bereits in archaischer Zeit für die weite Verbreitung der von den Griechen geprägten Lebensart und ihren Handelsgütern. Interessanterweise bilden diese Neugründungen seit dem 8. Jahrhundert v. Chr. räumlich und institutionell die Gliederung ab, die wir für die Polis gerade als typisch beschrieben haben. Das zeigt, dass die Organisationsform des Stadtstaates bereits zu diesem Zeitpunkt grundsätzlich ausgebildet war. Auch übernahmen die Pflanzstädte später politische und soziale Neuerungen vom alten Mutterland, da der Kontakt zu den Mutterstädten intensiv gepflegt wurde.
▪Tyrannen und Adelsgesellschaft im archaischen Griechenland
Die archaische Zeit, die sowohl durch die Ausbildung der Institutionen der Polis als auch die Kolonisationsbewegung gekennzeichnet ist, war keine ruhige Zeit der politischen Stabilität. Ganz im Gegenteil: Zwar hatten zunächst einflussreiche Adelsfamilien in den griechischen Städten in einem wenig spektakulären Übergangsprozess die herrschenden Kleinkönige marginalisiert und die Herrschaft unter den wichtigsten und einflussreichsten Clans aufgeteilt, doch kam es immer wieder und immer häufiger zu Konflikten um die Führung, wie sich aus den wenigen Quellen erschließen lässt. Solche Streitigkeiten nutzten bisweilen einzelne Adelige ohne große Hausmacht aus, um gegen den Willen ihrer Standesgenossen die Alleinherrschaft an sich zu reißen. Dabei stützten sie sich meist auf das einfache Volk. Man bezeichnete diese in vielen griechischen Städten auf jene Weise an die Macht gekommenen Männer mit dem aus dem Persischen stammenden Begriff »Tyrann«. Dieses Wort hatte im 6. Jh. v. Chr. noch keinen negativen Beigeschmack, sondern bezeichnete lediglich den Alleinherrscher, der nicht traditionelle Königsmacht verkörperte. Jene Machthaber herrschten meistens mit besonderem Gepränge und liebten die symbolische Prachtentfaltung. Um diese Tyrannen ranken sich schillernde Geschichten und die Historiker sind sich uneins, ob sie diesen Einzelfiguren, denen es – abgesehen vom Sonderfall Sizilien – nicht gelang, über mehr als zwei Generationen hinweg stabile Dynastien zu gründen, eine historische Bedeutung – etwa im Sinne eines Katalysators – in der Entwicklung der griechischen Stadtstaaten von Adelsherrschaften zu selbstbestimmten Bürgergemeinschaften zubilligen sollen.
In jedem Fall waren die Tyrannen, so sehr sie auch bemüht waren, im Interesse ihrer Herrschaft die anderen Adelsfamilien zu kontrollieren oder gar gewaltsam auszuschalten, Angehörige dieser Oberschicht, die die griechische Gesellschaft und Kultur der archaischen Zeit weitgehend bestimmte. An dieser Führungsschicht orientierten sich die gesellschaftliche wie kulturelle Entwicklung und ihre Sitten und Gebräuche wurden zur Leitkultur. Der Adel entwickelt auch ein spezifisches Standesbewusstsein, das grob mit unserer neuzeitlichen Vorstellung von Geburtsadel vergleichbar ist, wobei für die Griechen ein größeres Gewicht auf der individuellen Leistung lag. Dennoch hat bereits der griechische Universalgelehrte Plutarch darauf hingewiesen, dass es praktisch keinen griechischen Lyriker gibt, der nicht in seinen Gedichten lobend und preisend von edler Abkunft und hoher Geburt spricht.
Allgemein bezeichneten sich Angehörige dieser Führungsschicht als die Besten, áristoi;