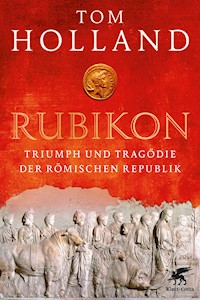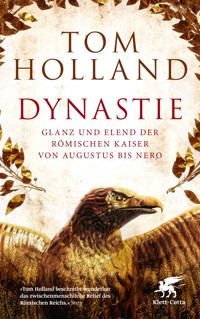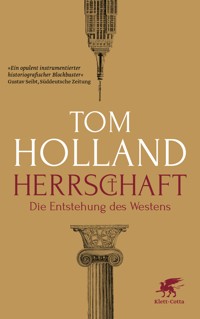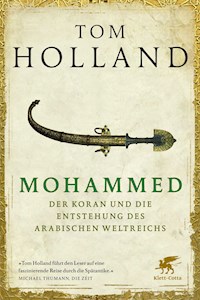23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2010
Mit "Millenium" schließt Tom Holland an seinen weltweiten Erfolg "Persisches Feuer" an. Anno Domini 900: Von drei Himmelsrichtungen durch unerbittliche Feinde bedrängt, während in der vierten Richtung nur der Ozean lag, schien es, dass der christlichen Bevölkerung keinerlei Spielraum mehr blieb. Und im Schatten des Jahrtausendwechsels befürchteten viele, dass der Antichrist erscheinen würde, um die Welt in Blut zu ertränken und ihr Ende anzukünden. Doch das Christentum brach nicht zusammen. Vielmehr wurde in den Erschütterungen jener furchtbaren Zeiten eine neue Zivilisation geschmiedet. In weit ausholendem epischem Zugriff, der uns von der Kreuzigung Christi zum Ersten Kreuzzug mitnimmt, vom Prunk Konstantinopels zu den trostlosen Küsten Kanadas, ist "Millennium" die brillante Darstellung einer schicksalsträchtigen Revolution: dem Auftauchen Westeuropas als einer unterscheidbaren, expansionistischen Macht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 910
Ähnliche
Tom Holland
Millennium
Die Geburt Europas
aus dem Mittelalter
Aus dem Englischen von Susanne Held
Klett-Cotta
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Besuchen Sie uns im Internet: www.klett-cotta.de
Klett-Cotta
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Millennium. The End of the World and the Forging of Christendom« im Verlag Little, Brown, London 2008
© 2008 by Tom Holland
Für die deutsche Ausgabe
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Cover: Atelier Versen
Unter Verwendung des Originalumschlags
Design: Peter Cotton – LBBG
Motiv: Bayeux Tapestry © Reading Museum
Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
Printausgabe: ISBN 978-3-608-94379-5
E-Book: ISBN 978-3-608-10144-7
INHALT
Dank
9
Vorwort
11
1
DIE RÜCKKEHR DES KÖNIGS
31
2
DIE ALTE ORDNUNG WANDELT SICH
79
3
… UND MACHT EINER NEUEN PLATZ
159
4
WESTWÄRTS
205
5
DER JÜNGSTE TAG WIRD VERSCHOBEN
251
6
DAS JAHR 1066: HASTINGS UND WAS SONST NOCH GESCHAH
309
7
EINE UNBEQUEME WAHRHEIT
355
Zeittafel
437
Anmerkungen
443
Ausgewählte Literatur
463
Verzeichnis der Karten
487
Bildnachweis
488
Register
489
Über den Autor
490
Für Patrick.
Wein!
[9]DANK
Pilgern ist eines der Hauptthemen dieses Buches. Daher ist es nur recht und billig, dass die Arbeit daran mir häufig wie eine lange, gewundene Straße vorkam. Jedem, der mir half, endlich das Ziel meiner Reise zu erreichen, bin ich daher unendlich dankbar: Richard Beswick und Iain Hunt, meinen Verlegern, beide wahre Wundertäter. Susan de Soissons, Roger Cazalet und all den anderen Mitarbeitern bei Little, Brown für ihren unermüdlichen Beistand. Jake Smith-Bosanquet für seine vehemente Schlagtechnik und sein sanftes Verhandlungsgeschick; und Patrick Walsh, dem besten Literaturagenten der Welt, dem dieses Buch auch gewidmet ist. Gerry Howard für seine ermutigenden Worte in einer Situation schlimmer Verzagtheit; Frits van der Meij für seine profunde mediävistische Unterstützung. James Palmer und Magnus Ryan für das äußerst sorgfältige, geradezu einschüchternd professionelle Lektorat und für die Großzügigkeit, mit der sie ihre Zeit, ihr Wissen und ihren Rat zur Verfügung stellten. Robert Irwin, dem Orientalisten ohnegleichen, der die Kapitel über die Beziehungen zwischen Christentum und Islam gelesen hat. Ben Yates, große Hoffnung der Nordistik in England, der trotz seiner zahlreichen sonstigen Verpflichtungen die gesamte Endfassung des Manuskripts gelesen hat – eine äußerst wertvolle Hilfe. David Crouch, der mir für die Herausforderungen die Augen öffnete, die nun vor mir liegen. Michael Wood, der mich in meiner Meinung bestätigte, dass es keine faszinierendere und gleichzeitig von der Wissenschaft unterschätztere Epoche gibt als das 10. Jahrhundert. Andrea Wulf und Maike Bohn, die meine bedauerliche Unkenntnis der deutschen Sprache mehr als wettmachten – und ja, Andrea, du hast recht: Heilige Lanzen sind wirklich interessanter als Pflanzen. Jamie Muir, der mit seiner gewohnten Genauigkeit und guten Laune die Kapitel jeweils direkt nach ihrer Niederschrift durchlas und mich zu der Wohnsiedlung begleitete, die jetzt an der[10] Stelle steht, wo Harald Hardråde fiel. Caroline Muir, die geduldig mit mir eine Jogging-Runde nach der anderen um unseren Stadtpark drehte, wann immer ich das Bedürfnis hatte, dem ersten Jahrtausend zu entkommen – oder nicht immer nur am Schreibtisch darüber nachzudenken. Pater Dunstan Adams OSB, der mich, wenn auch nur kurz, am klösterlichen Tagesablauf teilnehmen ließ, an den Rhythmen, die einst in Cluny lebendig waren. Marianna Albini, die mich nach Canossa begleitete. Meinem Bruder James Holland, der mir einen normannischen Helm schenkte. Meinen Eltern, Jans und Martin Holland, denen ich meine Kindheit im Herzen von Wessex verdanke. Vor allem meiner geliebten Familie, Sadie, Katy and Eliza, die sich geduldig mit meinen ausgedehnten Einsiedler-Phasen abfanden, mich klaglos zu dänischen Hügelgräbern und Kirchen in der Auvergne begleiteten und mir erlaubten, unsere Katzen Harold und Edith zu nennen. Beatus vir qui implevit pharetram suam.
[11]VORWORT
Nicht nur die schlimmste Zeit des Jahres, sondern dazu noch eines der schlimmsten Jahre überhaupt: Unter der Unbarmherzigkeit dieses Winters ächzten alle. Seit Wochen fiel Schnee, und in den Alpen lag er besonders hoch. Es war also kein Wunder, dass die kleine Gruppe von ungefähr fünfzig Reisenden, die sich die steilen Hänge des Mont Cenis hinaufquälten, von den Bewohnern der Dörfer, durch die sie kam, gewarnt wurde: Sie sollten doch umkehren, ihre Mission verschieben, den Frühling abwarten. »Denn die vor ihnen liegenden Hänge waren so voller Eis und Schnee«, lautete die Warnung, »dass kein Fuß und kein Huf hier Halt finden konnten.«1
Selbst die Führer – lauter Männer, die durch ihr Leben in den Alpen einiges gewöhnt waren – zeigten sich alarmiert von den unbarmherzigen Umständen. Der Aufstieg, so munkelten sie untereinander, mochte ja gefährlich sein – viel schlimmer aber würde der Abstieg werden. Und sie hatten natürlich recht. Schneestürme und Tiefsttemperaturen hatten die Straße, die nach Italien hinunterführte, in eine tödliche, eisbedeckte Klamm verwandelt. Die Frauen der Reisegruppe setzten sich vorsichtig in ausgebreitete Rinderfelle, die zu Schlitten umfunktioniert waren; die Männer aber mussten zu Fuß weiterschliddern und -stolpern, hilflos klammerten sie sich an der Schulter ihrer Führer fest, ja teilweise krochen sie auf allen vieren. So zu reisen war unglaublich erniedrigend – ganz besonders für einen König und sein Gefolge.
Eintausendsechsundsiebzig Jahre waren seit der Geburt Christi vergangen. Viel hatte sich in dieser Zeit verändert: Fremdartige Völker hatten sich zu Ruhm und Ansehen erhoben, berühmte Reiche waren zerfallen, und Rom selbst, die herrlichste aller Städte, die einstige Herrin der Welt, hatte sich in eine Wildnis aus in sich zusammengestürzten Prachtbauten und Unkraut verwandelt. Vergessen wurde sie nie. Obwohl die Herrschaft der alten Caesaren längst [12]verschwunden war, strahlte der Glanz ihres Ruhms noch immer in der Vorstellung ihrer Erben. Selbst für Völker, die nie zum Römischen Reich gehört hatten, und für Länder, die jenseits der Reichweite der römischen Legionen lagen, war die Person des Imperators, sein mit Sonnen und Sternen geschmückter Mantel die furchteinflößende, doch natürliche Entsprechung des einen himmlischen Imperators, der im Himmel herrschte. Daher hatte ein christlicher Caesar im Unterschied zu seinen heidnischen Vorläufern keine Steuern und Bürokraten und stehenden Heere nötig, um das Geheimnis seiner Macht aufrechtzuerhalten. Er brauchte auch keine Hauptstadt – und musste nicht einmal Römer sein. Seine eigentliche Autorität leitete sich aus einer höheren Quelle ab. »Nach Christus ist er es, der die Welt beherrscht.«2
Was um alles in der Welt hatte also ausgerechnet im tiefsten, kältesten Winter der Stellvertreter Gottes hier in den unwirtlichen Alpen, wo er sich stolpernd eine Schramme nach der anderen holte, zu suchen? Ein fürstlicher Herr wie er gehörte an Weihnachten auf seinen Thron in einer von Feuer erleuchteten Festhalle, sein Platz war am Kopf einer üppig bestückten Tafel, mit Bischöfen und Herzögen zu seiner Rechten und Linken. Heinrich, der vierte König, der diesen Namen als Herrscher des deutschen Volkes trug, war Herr über das größte aller christlichen Reiche. Vor ihm waren sowohl sein Vater als auch sein Großvater zu Kaisern gekrönt worden. Für Heinrich war es eine Selbstverständlichkeit, dass ihm dieser Herrschertitel – obwohl er ihm formal noch nicht verliehen worden war – rechtmäßig zustand.
In jüngster Zeit war diese Vermutung allerdings durch einige empfindliche Querschläge erschüttert worden. Schon seit Jahren arbeiteten Heinrichs Feinde unter den deutschen Fürsten an der Demontage seiner Person. Das war nichts Besonderes: Es war im Großen und Ganzen praktisch die zweite Natur deutscher Fürsten, gegen ihren König zu intrigieren. Höchst außergewöhnlich war jedoch das plötzliche Erscheinen eines Gegners, der nicht über zahlreiche Burgen verfügte, keine Heerscharen von Kriegern unter sich hatte, der nicht einmal ein Schwert trug – ein Gegner, dem es dennoch innerhalb nur weniger Monate zusammen mit den deutschen Fürsten gelungen war, den mächtigsten König der Christenheit in die Knie zu zwingen.
Dieser furchterregende Gegner nannte sich Gregor: ein Name, der zu einem Kriegsherrn nicht passte, wohl aber zum Hüter einer grex, einer Schafherde. Die Bischöfe folgten dem Beispiel ihres Heilands und nahmen oft und gern die Rolle eines Hirten an, und Gregor war durch sein Amt im Besitz des her[13]vorragendsten aller Hirtenstäbe. Als Bischof von Rom war er noch sehr viel mehr: Denn genauso wie Heinrich sich als Erben der Caesaren darzustellen pflegte, so beanspruchte Gregor von seinem Thron in der Hauptstadt der Christenheit aus, der ›Vater‹, der ›Papst‹ der katholischen, also allgemeinen Kirche zu sein. Ein todsicheres Konflikt-Rezept? Nicht unbedingt. Schon seit Jahrhunderten kam jetzt eine lange Reihe von Kaisern und Päpsten recht gut miteinander aus – sie sahen sich nicht als Konkurrenten, sondern als Partner. »Es gibt zwei Prinzipien, die vor allen anderen die Ordnung der Welt aufrechterhalten: die geheiligte Autorität der Päpste und die Macht der Könige.« So hatte es Papst Gelasius im Jahr 494 formuliert.
Zugegebenermaßen war dann Gelasius von der Versuchung zur Selbstbeweihräucherung zu der pompösen Formulierung verführt worden, dass er es sei, und nicht der Kaiser, der die größere Verantwortung zu tragen habe: »Denn es sind die Priester, die am Tag des Gerichts Rechenschaft über die Seelen der Könige ablegen müssen.«3 Aber das war ja lediglich graue Theorie. Die Praxis sah ganz anders aus. Die Welt war ein grausamer Ort voller Gewalt, und ein Papst war schnell in der Gefahr, von bedrohlichen Nachbarn in die Enge getrieben zu werden. Ein Hirtenstab, und sei er noch so eindrucksvoll, taugte wenig gegen einen gepanzerten Eindringling. Demzufolge hatte sich in den vergangenen Jahrhunderten zwar immer wieder ein Papst um Hilfe an einen Kaiser gewandt, doch das Umgekehrte war nie geschehen. Sie waren wohl Partner – aber wenn es hart auf hart kam, wurde immer wieder ganz klar, wer in dieser Partnerschaft der Junior war.
Und das wusste jeder. Ungeachtet der subtilen Argumentation eines Gelasius waren die Christen seit jeher davon ausgegangen, dass Könige – und vor allem Kaiser – eine ebenso enge Verbindung mit den himmlischen Mysterien hatten wie die Priester. Sie hatten nach Ansicht der Gläubigen nicht nur das Recht, sich in die Angelegenheiten der Kirche einzumischen, sondern geradezu die ausdrückliche Pflicht. Gelegentlich, wenn es in Zeiten einer akuten Krise nicht anders ging, konnte ein Kaiser sogar zur letzten Sanktion schreiten und die Abdankung eines unwürdigen Papstes erzwingen. Genau das war es, was Heinrich IV., der in Gregor eine akute Bedrohung der Christenheit sah, in den ersten Wochen des Jahres 1076 hatte veranlassen wollen: eine bedauerliche Notwendigkeit natürlich, aber nichts, was sein Vater vor ihm nicht auch schon erfolgreich durchgezogen hätte.
Gregor allerdings dachte gar nicht daran, dem kaiserlichen Unmut zu weichen [14]und brav sein Amt niederzulegen, er reagierte vielmehr äußerst ergrimmt und wagte einen vollkommen unerwarteten Schritt: Der Papst verkündete, dass Heinrichs Untertanen von ihrer Treue und ihrem Gehorsam gegenüber ihrem irdischen Herrn entbunden waren, und gleichzeitig wurde Heinrich selbst, das Ebenbild Gottes auf Erden, mit dem Kirchenbann belegt4 und aus der Kirche exkommuniziert: ein Gambit, das sich nach nur wenigen Monaten geradezu als verheerend erwies. Heinrichs Feinde erhielten eine mörderische Ermutigung. Die Anzahl seiner Freunde dagegen nahm rapide ab. Ende des Jahres war sein Reich schlicht unregierbar geworden. Und so kam es, dass der mittlerweile völlig verzweifelte König sich in die Winterstürme hinauswagte, um die Alpen zu überqueren. Er wollte sich zum Papst begeben, gebührende Reue zeigen und um Vergebung bitten. Er war zwar der Caesar, aber eine Alternative hatte er nicht.
Es war ein Wettlauf mit der Zeit – der, wie Heinrich wusste, durch ein unangenehmes Detail noch dramatischer wurde. Man berichtete, dass Gregor trotz seines stattlichen Alters von 55 Jahren ebenfalls auf den winterlichen Straßen unterwegs war. Er war seinerseits zu einer Reise über die zugeschneiten Alpen aufgebrochen, um Heinrich im Februar innerhalb der deutschen Grenzen persönlich zur Rede zu stellen. Als die erschöpfte königliche Reisegruppe um die Jahreswende 1076/77 in der Lombardei ankam, wurden natürlich panische Nachforschungen nach dem Aufenthaltsort des Papstes angestellt. Heinrich hatte einen recht engen Zeitplan, doch auch der Mann, den er treffen wollte, hatte glücklicherweise zeitlich knapp kalkuliert. Gregor war zwar schon bis zu einem Punkt gelangt, von dem aus er die Alpen sehen konnte, doch sobald ihn die Nachricht vom Eintreffen des Königs erreichte, machte er auf der Stelle kehrt und zog sich in die Festung eines seiner Anhänger in der Umgebung zurück.
Heinrich schickte Schwärme von Briefen vor sich her, um den Papst seiner friedlichen Absichten zu versichern, und machte sich sofort auf den Weg. Ende Januar war er, diesmal mit nur wenigen Begleitern, wieder auf einer Gebirgsstraße unterwegs. Vor ihm, gezackt wie riesige Wellen, die in der Kälte dieses furchtbaren Winters zu Eis gefroren waren, erstreckte sich die Grenze des Apennin. Nur 10 Kilometer entfernt von der Ebene, die er hinter sich ließ, aber erst nach vielen Stunden auf gewundenen Wegen erreichte Heinrich endlich ein Tal, das aus der wilden Berglandschaft herausgemeißelt schien und von einem einzelnen Berggrat überragt wurde. Jenseits davon über einer steil[15] abfallenden, wüsten Felsenklippe, die völlig unbezwingbar wirkte, konnte der König die Befestigungsmauern des Schlupflochs erkennen, in das der Papst sich zurückgezogen hatte. Der Name der Festung: Canossa.
Heinrich drängte weiter, in den Schatten der Burg. Als er dort ankam, öffneten sich die äußeren Tore, um ihn einzulassen, und dann, auf halbem Weg den Fels hinauf, die Tore einer zweiten Mauer. Es war selbst für die argwöhnischen Wachtposten völlig offensichtlich, dass ihr Besucher nichts Böses im Schilde führte und sicher keine Bedrohung darstellte. »Barfuß, in wollenem Gewand, hatte er sämtlichen königlichen Prunk abgelegt.« Heinrich, der von Natur stolz und reizbar war, beugte hier demütig sein Haupt. Sein Gesicht war tränenüberströmt. Demütig begab er sich zu einer Gruppe von Büßern und stellte sich vor den Toren der innersten Burgmauer auf. Dort wartete der Caesar, der Stellvertreter Christi, zitternd im Schnee. Und während der ganzen Zeit ließ er nicht von seinen Wehklagen ab, »bis er« – wie Gregor von seinem Beobachtungsposten aus feststellte – »bei allen, die dort bei ihm standen oder von den Geschehnissen erfuhren, ein solches Mitleid und Erbarmen erregt hatte, dass sie sich mit eigenen Gebeten und Tränen für ihn einsetzten«.5 Ein wahrhaft beeindruckender Anblick. Am Ende war nicht einmal der strenge, unbeugsame Papst dagegen gefeit.
Am Morgen des 28. Januar, einem Samstag, dem dritten Tag der königlichen Buße, hatte Gregor sich sattgesehen. Endlich gab er den Befehl, die innersten Tore aufzuschließen. Verhandlungen wurden eröffnet, die schon kurz danach beendet werden konnten. Der Papst und der König begegneten sich – vielleicht zum ersten Mal, seit Heinrich ein Kind gewesen war6 – von Angesicht zu An gesicht. Dem abgehärmten Büßer wurde mit einem päpstlichen Kuss die Absolution erteilt, womit eine Episode der europäischen Geschichte ihren Abschluss fand, deren Bedeutung gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann.
Wie bei der Überquerung des Rubikon, wie beim Sturm auf die Bastille bündelten sich in den Ereignissen in Canossa sämtliche Faktoren einer wahrhaft epochalen Krise. Es ging um weit mehr als nur um das Aufeinanderprallen zweier Alphatiere. Der Papst war zwar in einen verbissenen Machtkampf verwickelt, doch er hatte auch Ambitionen von atemberaubend globalen Ausmaßen. Was war sein eigentliches Ziel? Nichts weniger als »die rechte Ordnung in der Welt«.7 Was einst zu Zeiten eines Papstes Gelasius noch lediglich ein Wunschtraum gewesen war, verwandelte sich unter Papst Gregor in ein konkretes[16] Programm. Es zielte darauf, die gesamte Christenheit, angefangen bei ihren Anführern bis hinunter in die unbedeutendsten Dörfer, in zwei Teile zu spalten: ein Reich für den Geist, ein Reich für die weltlichen Dinge. Es sollte Königen nicht länger erlaubt sein, ihre Nase in kirchliche Angelegenheiten zu stecken. Die Initiative war so rebellisch wie weitreichend: Mit ihr wurde ein Anschlag auf Grundsätze verübt, die seit immerhin einem Jahrtausend für selbstverständlich gehalten wurden.
Doch selbst wenn Gregor das ganze Ausmaß seiner Mission bewusst gewesen wäre, wäre er davor sicher nicht zurückgeschreckt. Es ging, davon war er überzeugt, um die Zukunft der Menschheit: Denn wenn die Unantastbarkeit der Kirche in Frage gestellt wurde, welche Hoffnung gab es dann noch für eine sündige Welt? Es war also kein Wunder, dass der Papst, als sich ihm die Gelegenheit bot, an seinem bedeutendsten Gegner ein Exempel statuierte. »Der König von Rom wurde nicht als mächtiger Monarch geehrt, sondern behandelt wie ein menschliches Wesen – eine aus Lehm geschaffene Kreatur.«8
Die Zeitgenossen, die sich redlich abmühten, das ganze unvorstellbare Geschehen zu begreifen, waren sich durchaus darüber im Klaren, dass sie eine Erschütterung der christlichen Grundfesten erlebten, die so noch nie dagewesen war. »Unsere gesamte römische Welt bebte.«9 Viele fragten sich, ob dieses Erdbeben nicht direkt auf das Hereinbrechen des Jüngsten Tages hindeutete. Dass es mit den Menschen, ja der ganzen Welt bergab ging, war eine schon lange und weit verbreitete Überzeugung. Als die Jahre vorübergingen und das Ende der Welt nicht eintrat, sahen die Menschen sich genötigt, nach anderen Erklärungen zu suchen: eine wahrhaft gewaltige Aufgabe. Die drei Jahrzehnte vor dem Showdown in Canossa und die vierzig Jahre, die darauf folgten, waren nach Meinung eines berühmten Mediävisten eine Periode, in der die Ideale des Christentums, seine Regierungsformen, ja die gesellschaftliche und ökonomische Grundsubstanz »in fast allen Zügen« änderten. Hier, so Sir Richard Southern, ist die eigentliche Geburtsstätte des europäischen Abendlandes zu sehen. »Die Ausdehnung Europas begann ernsthaft. Dass all das in einer derart kurzen Zeit stattfinden konnte, ist an der Geschichte des Mittelalters am bemerkenswertesten.«10
Und wenn das für uns schon so bemerkenswert ist – um wie viel mehr muss es diejenigen aufgewühlt haben, die es direkt miterlebten! Für uns Menschen des 21. Jahrhunderts ist die Vorstellung des Fortschritts eine Selbstverständlichkeit: Wir gehen natürlich ganz zuversichtlich davon aus, dass die mensch liche[17] Gesellschaft nicht unaufhaltsam verfällt, sondern verbessert werden kann. Die Menschen des 11. Jahrhunderts waren von einem solchen Glauben weit entfernt. Indem Gregor die Stirn besaß, Heinrich IV. herauszufordern, war er der Vorbote eines ungeheuerlichen Phänomens. Er und seine Anhänger waren sich vielleicht nicht darüber im Klaren – und doch bescherten sie der modernen westlichen Welt eine erste Erfahrung von Revolution.
Eine Behauptung, die viele der Männer, die im Lauf der Geschichte Europa weitere Erschütterungen bescherten, natürlich als grotesk bezeichnet hätten. Dem einstigen Mönch Martin Luther, der seine Lebensaufgabe darin sah, alles, wofür Gregor stand, umzustürzen, erschien der große Papst geradezu als teuflische Gestalt: Höllenbrand, so nannte er ihn in Anlehnung an Gregors ursprünglichen Namen Hildebrand. Auch im Gefolge der Aufklärung, als die Träume von der Errichtung eines Neuen Jerusalems immer weltlichere Züge annahmen und die Weltrevolution bewusst als Ideal etabliert wurde, sahen viele Enthusiasten des Wandels in der römisch-katholischen Kirche den schlimmsten Hemmschuh auf ihrem Weg des Fortschritts.
Man musste kein Radikaler, ja nicht einmal ein liberaler Geist sein, um diese Überzeugung zu teilen. »Nach Canossa gehen wir nicht!«11, wetterte Fürst Bismarck, der Eiserne Kanzler eines wiedergeborenen Deutschen Reiches, im Jahr 1872, als er dem Reichstag zusicherte, dass er es dem Papst niemals gestatten werde, Deutschland auf seinem Weg in die Moderne aufzuhalten. Damit sollte Gregor als Urbild des Reaktionärs abgestempelt werden: eine Charakterisierung, die viele katholische Gelehrte, wenn auch von einem diametral entgegengesetzten Standpunkt aus, durchaus nicht in Abrede gestellt hätten. Sie hatten ebenso wie die Feinde der Kirche beträchtlichen Anteil daran, dass die Größe dessen, wofür Canossa stand, heruntergespielt wurde. Denn wenn das Papsttum als Hüter unveränderlicher Wahrheiten und Traditionen gelten sollte, wie konnte es dann der Motor eines Bruchs in der europäischen Geschichte sein, der nicht weniger folgenschwer war als die Reformation oder die Französische Revolution?
Gregor war, folgt man der gängigen katholischen Sicht der Dinge, ein Mann, der nichts Neues in die Welt brachte, sondern sich vielmehr bemühte, die Kirche in ihre ursprüngliche Makellosigkeit zurückzuführen. Gregor selbst hatte dies unaufhörlich beteuert, es war also nicht schwer, diese These bestätigt zu sehen. Und trotzdem führte sie in die Irre. In Wahrheit gab es zuvor nichts, das dem Umbruch, der sich in Canossa ereignete, gleichkam – weder in[18] der Geschichte der römischen Kirche noch in der Entwicklung irgendeiner anderen Kultur. Die Folgen waren von einer Tragweite, wie sie größer nicht denkbar ist. Westeuropa, das so lang im Schatten von weitaus höher entwickelten Kulturen und seiner eigenen antiken, verschwundenen Vergangenheit stand, hatte endlich eine Richtung gefunden, die sich unwiderruflich als seine eigene herausstellen sollte.
Gregor wurde mit Canossa zum Gründungsvater dieser Zukunft.
Seit der Westen sich in den Rang einer globalen Vormacht erhob, wurden die Entstehungsbedingungen dieser Einzigartigkeit heftig diskutiert. Normalerweise wurden sie in der Renaissance angesetzt, in der Reformation, oder in der Aufklärung: historischen Phasen, die sich alle bewusst in Abgrenzung von der Rückwärtsgewandtheit und Barbarei des sogenannten ›Mittelalters‹ definierten. Dieser Terminus hat jedoch einen trügerischen Charakter. Wenn man ihn zu unbedacht verwendet, besteht die Gefahr, dass ein wesentlicher, charakteristischer Bestandteil des Bogens der europäischen Geschichte aus dem Blick gerät. Der Begriff ›Mittelalter‹ impliziert, dass es zwei entscheidende Brüche in der Entwicklung des Westens gab. In Wahrheit war es nur einer – eine Umwälzung, die in den anderen Hochkulturen Eurasiens nicht ihresgleichen hat. Im Lauf eines Jahrtausends hatte sich die klassische antike Kultur zu einem Gipfel an exzeptioneller Vollkommenheit entwickelt; doch der Zusammenbruch dieser Kultur in Westeuropa umfasste, als er eintrat, fast alle Bereiche. Die soziale und ökonomische Substanz des Römischen Reiches kollabierte so vollständig, dass seine Häfen verödeten, seine Gießereien stillgelegt wurden, die großen Städte sich leerten, und tausend Jahre Geschichte lediglich in eine Sackgasse mündeten. Auch die Ambitionen eines Heinrich IV. konnten daran letztlich nichts ändern. Das Rad der Zeit konnte nicht zurückgedreht werden. Eigentlich hatte es nie eine konkrete Perspektive gegeben, das, was implodiert war, wiederherzustellen – zurückzubringen, was verloren war.
Dennoch hielt sich noch lang nach dem Untergang Roms in der Vorstellung der Christen hartnäckig die Überzeugung, dass die einzige Alternative zur Barbarei die Herrschaft eines allmächtigen Kaisers war. Und das bezog sich nicht nur auf die Christen. Von China bis in den Mittelmeerraum behielten die Menschen in den großen Reichen das Verhalten der alten Römer getreu bei und sahen in der Herrschaft eines Kaisers die einzige vorstellbare Widerspiegelung himmlischer Vollkommenheit. War denn überhaupt eine andere Ordnung[19] denkbar? Nur im äußersten Westen Eurasiens, wo von einem Reich nur noch Geister und zusammengeflickte Imitationen übrig geblieben waren, wurde diese Frage mit einer gewissen Ernsthaftigkeit gestellt – und das auch erst, nachdem viele Jahrhunderte vergangen waren. Vor diesem Hintergrund gewinnen die Ereignisse um Canossa ihren umwälzenden Charakter. Hier wurden Veränderungen angestoßen, die letztlich weit über die Grenzen des westlichen Europas hinauswirkten: Veränderungen, die uns heute noch prägen.
Natürlich hat Gregor heute nicht den Ruf eines Luther, eines Lenin, eines Mao – doch das ist kein Indiz für sein Scheitern, sondern im Gegenteil für das enorme Ausmaß seiner Leistung. Es sind die nicht konsequent zu Ende geführten Revolutionen, an die sich die Menschheit erinnert; das Schicksal derer, die sich durchsetzten, besteht darin, als Selbstverständlichkeit aus dem Bewusstsein zu verschwinden. Gregor selbst erlebte seinen endgültigen Sieg nicht mehr – die Sache aber, für die er sich einsetzte, sollte sich als womöglich das spezifische Merkmal der abendländischen Kultur erweisen. Dass die Welt in Kirche und Staat geteilt werden kann, und dass diese beiden Reiche getrennt voneinander existieren können: Das sind die Vorstellungen, die das 11. Jahrhundert »ein für allemal zur Grundlage für die europäische Gesellschaft und Kultur« machten. Was zuvor nur ein Ideal gewesen war, sollte sich schließlich zu selbstverständlicher Realität verdichten.
Es ist mithin kein Wunder, dass, wie ein bedeutender Historiker über diese »erste europäische Revolution« bemerkte, »Europas Kindern die Vorstellung schwerfällt, dass es je anders gewesen sein könnte«.12 Nicht einmal der heutige Zustrom beträchtlicher Bevölkerungsgruppen aus nicht-christlichen Ländern in den Westen half unserem Gedächtnis auf die Sprünge. Natürlich wird immer wieder darauf hingewiesen, dass der Islam keine Reformation kannte – kennzeichnender wäre allerdings die Aussage, dass es im Islam kein Canossa gab. Für einen frommen Muslim ist die Vorstellung, die politische und die religiöse Sphäre könnten voneinander getrennt werden, schockierend – genauso schockierend wie für viele Gegner Gregors.
Natürlich hatte es auch nicht andeutungsweise in Gregors Absicht gelegen, Gott aus einer ganzen Dimension des menschlichen Lebens zu verbannen, doch Revolutionen haben unweigerlich unbeabsichtigte Folgen. Schon als die Kirche sich seit der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts daran machte, ihre Unabhängigkeit von äußeren Einmischungen dadurch zu untermauern, dass sie ihre eigenen Gesetze, eigene Bürokratie und eigene Einkünfte geltend machte,[20] sahen sich die Könige im Gegenzug veranlasst, dasselbe zu tun. »Der Himmel ist der Himmel des Herrn; aber die Erde hat er den Menschenkindern gegeben.«13 Das sagte der Sohn Heinrichs IV. zu einem Priester, der ihn – aus Furcht, damit den Zorn Gottes zu erregen – bat, davon abzusehen, einen Grafen unterhalb der Mauern seiner Burg aufzuhängen. In ähnlichem Geist wurden die Fundamente des modernen westlichen Staates gelegt, Fundamente, denen jegliche religiöse Dimension abgeht. Eine Ironie der Geschichte: dass die Vorstellung einer säkularen Gesellschaft letztlich dem Papsttum zu verdanken ist. Voltaire und der 1. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten14, Multikulturalismus und Schwulenhochzeiten: lauter Marksteine an der Straße, die von Canossa aus in die Zukunft führte.
Doch der Blick in die Zukunft von diesem Ereignis aus, das treffend als ›päpstliche Revolution‹ bezeichnet wurde, und der Hinweis auf seine weitreichenden Folgen drängt zugleich eine offensichtliche Frage auf: Was war dieser so gewaltigen, schicksalhaften Umwandlung vorausgegangen? Die Ursachen sind, wie es von Expertenseite aus ganz offen zugegeben wird, »noch immer heftig umstritten«.15 Als Gregor in Canossa mit Heinrich zusammentraf, war das Papsttum bereits seit fast drei Jahrzehnten der Motor radikaler Veränderungen gewesen – und der Druck zur Reform hatte sich bereits ein Jahrzehnt zuvor aufgebaut. Was war in den frühen 1030er-Jahren die Inspirationsquelle für eine solche Bewegung gewesen? Die Frage wird aufgrund einer bemerkenswerten Koinzidenz noch interessanter: Genau die Jahre, in denen erste Anzeichen für die Entwicklung auftauchen, die dann in die päpstliche Revolution münden, wurden von vielen Mediävisten als Endpunkt einer früheren, nicht weniger schicksalsträchtigen Krisenperiode bezeichnet – einer Krise allerdings, die nicht von den Höfen und Kirchen der Mächtigen ausging, sondern von den unermesslichen Landstrichen der Provinz; und nicht in Deutschland oder Italien, sondern in Frankreich. Dort vollzog sich seit ungefähr 980 eine heftige ›Mutation‹, aus der innerhalb weniger Jahrzehnte fast alles entstehen sollte, was heute üblicherweise mit dem Mittelalter assoziiert wird: Burgen, Ritter und der ganze Rest.
Zugegeben: Der präzise Rahmen und der Charakter dieser Umwälzungen ist höchst umstritten; es gibt einige Fachleute, die sie gänzlich in Frage stellen, während andere sie als den entscheidenden Wendepunkt für das gesamte westliche Europa ansehen.16 In einer Phase der Geschichte, der es an trügerischen Sümpfen nicht mangelte, stellt sich die Frage, was genau in Frankreich während [21]den letzten Dekaden des 10. und den ersten Dekaden des 11. Jahrhunderts geschah, als der womöglich trügerischste Sumpf von allen dar. Französische Historiker, für die die ganze Debatte zu einer nachgerade ermüdenden Angelegenheit wurde, sprechen nur noch schlagwortartig von ›L’an mil‹ – dem ›Jahr 1000‹.
Eine markante Formulierung: Sie stellt zwar eine wissenschaftliche Kurzformel dar – trotzdem hat das Datum einen schaurigen Beiklang. Oder gilt das vielleicht nur für uns, die wir den Übergang vom zweiten christlichen Jahrtausend zum dritten erlebt haben? Historiker, die größten Wert darauf legen, der Vergangenheit keine zeitgenössischen Vorstellungen aufzubürden, haben immer wieder so argumentiert. Tatsächlich maßen bis vor wenigen Jahrzehnten sogar diejenigen, die mit Nachdruck für eine umfassende Umwandlung Westeuropas um die Jahrtausendwende argumentierten, dem Jahr 1000 selbst nicht mehr an impliziter Bedeutung zu als etwa den Jahren 1789 oder 1914. Dass es absolut präzis in der Mitte einer Periode lag, die von vielen Historikern als Geburtswehen einer radikal neuen Ordnung angesehen wurde – das, so das Argument nüchterner Gelehrsamkeit, war reiner Zufall, mehr nicht. Dass das Datum apokalyptische Ängste von der Art hervorgerufen haben könnte, wie wir sie, als wir auf das Jahr 2000 zugingen, in die Prophezeiungen des Nostradamus und den Millennium-Bug projizierten –, jeglicher Gedanke daran wurde mit größter Selbstverständlichkeit als absolut lächerlich zurückgewiesen; eine Phantasie, die ebenso gnadenlos abgeschmettert werden muss wie bizarre Theorien zu den Pyramiden oder zum Templerorden. »In dem Moment, da man aufhört, gegen einen tiefverwurzelten Irrglauben der Geschichtsschreibung anzugehen«, seufzte ein bedeutender Mediävist in resigniertem Hochmut, »erhebt er sofort wieder sein Haupt.«17
Das ist ohne Zweifel richtig – wenn man allerdings zu unbarmherzig auf eine Hydra einschlägt, besteht die Gefahr, dass nicht nur die Irrtümer, sondern auch die Wahrheiten dem Schwert zum Opfer fallen. Auch wenn der Hals sich schon dreht und windet – vielleicht verdient er es dennoch nicht, durchtrennt zu werden. In den ›Angeblichen Schrecken des Jahres Tausend‹18 (so der Titel eines kürzlich erschienenen Buches) sah man gern ein fiebrig-grelles Phantasie-Gebräu des romantischen 19. Jahrhunderts – doch das wurde der Sache nur sehr partiell gerecht. Häufig – ja man muss sagen überraschend häufig – stellten sich die Mythen um das erste Jahrtausend, gegen die Historiker des 20. Jahrhunderts zu Felde zogen, als selbsterdachte Schreckgespenster heraus.[22] Eine allgemein verbreitete Überzeugung, dass die Welt mit dem ersten Glockenschlag des Jahres 1000 enden würde; Fürsten und Bauern, die in heller Panik in die Kirchen strömten, als der schreckliche Augenblick näher rückte; die ganze Christenheit »erstarrt in totaler Lähmung«19 – das sind in der Tat nichts weiter als ›angebliche Schrecken‹, groteske, unglaubwürdige Kopfgeburten, die hauptsächlich von den Skeptikern selbst in die Welt gesetzt wurden. Das waren nicht nur häufig Verzerrungen der historischen Arbeiten des 19. Jahrhunderts; viel schlimmer noch: Es waren Verzerrungen der Zeugnisse selbst, die aus der Zeit der Jahrtausendwende auf uns gekommen sind.20
Allein schon die Formulierung ›Schrecken‹, ›Terror‹ übersieht, dass die Erwartung des unmittelbar bevorstehenden Weltendes für die Elenden, die Armen und Unterdrückten alles andere war als eine Quelle der Angst; im Gegenteil, für sie stellte es eine Perspektive der Hoffnung dar. »Er kommt, er kommt, der Tag des Herrn, wie ein Dieb in der Nacht!«21 Das war natürlich eine Warnung, doch ebenso eine Freudenbotschaft – und bezeichnend nicht nur im Tonfall, sondern auch im Hinblick auf den Zeitpunkt, da sie formuliert wurde. Dem Mann, der sie aussprach, einem niederländischen Mönch, war im Jahr 1012 durch keinen Geringeren als einen Erzengel eine erschütternde Vision des Weltendes zuteil geworden, und er hatte nicht den leisesten Zweifel daran, dass die Zweite Wiederkunft unmittelbar bevorstand. Der Umstand, dass der Jahrtausendwechsel bereits über zehn Jahre zurücklag, bekümmerte ihn nicht im Geringsten: Ebenso wie die ›Schrecken des Jahres 1000‹ nicht einfach nur Schrecken waren, so waren sie auch durchaus nicht auf das Jahr 1000 selbst begrenzt.
Damit soll nicht bestritten werden, dass der tausendste Jahrestag der Geburt Christi ein klarer Fokus für Endzeiterwartungen war – doch er war nicht der einzige, ja nicht einmal der wichtigste. Nachdem das Datum verstrichen war, flaute die Erwartung des Jüngsten Tages beileibe nicht ab, im Gegenteil: Sie schien sich in den 33 Jahren, die auf die Jahrtausendwende folgten, noch zu vergrößern – und wie sollte es anders denkbar sein? Hatten doch die Christen, die in jener schicksalsträchtigen Zeit lebten, ein ebenso grandioses wie schreckliches Privileg: »Ihre Lebenszeit fiel genau mit den Jahrzehnten zusammen, die die tausendste Wiederkehr des Eintretens ihres göttlichen Herrn in die menschliche Geschichte umfassten.«22 Es war also kein Wunder, dass die Erwartung der Zweiten Wiederkunft in den Jahren, »da sich die Passion zum tausendsten Mal jähren sollte«,23 einen Siedepunkt erreichte: Denn welches Ereignis im[23] gesamten bisherigen Verlauf der Geschichte konnte es an kosmischer Bedeutung mit dem Tod, der Auferstehung und Himmelfahrt Christi aufnehmen? Nichts – nicht einmal Seine Geburt. Die eigentliche Jahrtausendwende war also gar nicht das Jahr 1000. Es war vielmehr der Jahrestag Seines Abschieds von der Erde, auf der Er für einige wenige Jahre gewandelt war – ein Jahrestag, der ungefähr auf das Jahr 1033 fiel.
Diese Argumentation – dass die Menschen in den ersten Jahren tatsächlich in einer Endzeiterwartung lebten, dass diese sie mit einer Mischung aus Horror und Hoffnung erfüllte, und dass sie ihren Höhepunkt erreichte, als sich die Auferstehung zum tausendsten Mal jährte – verlor in den letzten Jahrzehnten zunehmend den Charakter einer Irrlehre, als die sie zuvor gegolten hatte. Mediävisten sind wie alle anderen Menschen auch Zeitströmungen und Moden unterworfen – und Diskussionen über den apokalyptischen Charakter des Jahres 1000 sind seit einiger Zeit der letzte Schrei. Kritische Stimmen bemängelten, dass diese Kontroverse dem Zeitpunkt ihrer Entstehung zu stark verhaftet sei: Dass sie ausgerechnet in den Jahren, die dem Jahr 2000 unmittelbar vorausgingen und folgten, so richtig in Fahrt kam, kann kein Zufall sein. Doch ist das ja kein Grund, sie zu diskreditieren. Historiker können nicht umhin, Kenntnisse ihrer Gegenwart in sich aufzunehmen. Eine Jahrtausendwende mitzuerleben ist eine Chance, die sich nicht alle Tage bietet. Wäre für einen Historiker überhaupt etwas Selbstschädigenderes denkbar, als die Augen vor den Perspektiven zu verschließen, die eine solche nur alle 1000 Jahre mögliche Erfahrung mit sich bringt?
Es wäre albern von mir zu leugnen, dass diese Studie des ersten christlichen Jahrtausends nicht in gewissem Ausmaß von Reflexionen zum zweiten Jahrtausend inspiriert wurde. Was mich vor allem beschäftigte, und was dieses Buch dann stark prägte, war meine Wahrnehmung, dass der Schritt in eine explizit neue Ära ganz anders ausfiel, als ich ihn mir vorgestellt hatte. Vor dem Übergang von 1999 nach 2000, in nervösen Phasen des Aberglaubens und der Endzeitstimmung, hegte ich vage Hoffnungen, dass die Welt des 3. Jahrtausends sich heller und optimistischer anfühlen würde, vielleicht sogar jünger. Doch das Gegenteil ist der Fall.
Ich erinnere mich noch an meine Jugendjahre: wie es war, im Schatten des Kalten Krieges zu leben; wie ich betete, dass ich – und die ganze Welt mit mir – das 21. Jahrhundert noch erleben durfte; jetzt aber, nachdem diese Schwelle überschritten ist, wird mir beim Blick nach vorn vor allem die schreckliche[24] Unendlichkeit der vor uns liegenden Zukunft bewusst und die im Vergleich dazu so erbärmliche Winzigkeit der menschlichen Existenz. »Die Erde wird weiterexistieren, aber mit dem Verglühen unseres Planeten, wenn die Sonne stirbt, werden nicht die Menschen zurechtkommen müssen; vielleicht nicht einmal mit der Erschöpfung der natürlichen Ressourcen«24, schrieb Martin Rees, der Leiter der königlichen Sternwarte, in seinem Buch Our Final Century: Will Civilisation Survive the Twenty-First Century? (Unser letztes Jahrhundert: Kann die Zivilisation das 21. Jahrhundert überleben?), einem Titel, der ja von propheti schem Frohsinn nur so strotzt.
Das Buch von Rees entstand nicht unter dem Einfluss von Fin-de-siècle-Angst, vielmehr wurde es unmittelbar zu Beginn des neuen Jahrtausends verfasst; und seit seinem Erscheinen im Jahr 2003 scheint die pessimistische Stimmung unter den führenden Wissenschaftlern kein bisschen nachgelassen zu haben. Als der berühmte Umweltforscher James Lovelock Our Final Century zum ersten Mal las, hielt er es lediglich für »eine Spekulation unter Freunden; kein Grund für schlaflose Nächte«. Keine drei Jahre später gestand er in seinem eigenen Buch Gaias Rache: »Ich habe mich komplett geirrt.«25 Lovelocks These, dass die Welt kurz davor ist, schlicht und einfach unbewohnbar zu werden, kann einem das Blut in den Adern gefrieren lassen, doch auch ohne Kenntnis seines Buchs, einfach angesichts des momentanen Alarmzustands bezüglich der globalen Erwärmung, dürfte es nicht allzu schwer sein zu erraten, was Lovelocks Umkehr bewirkte. Ebenso prägnant wie ernüchternd schreibt er: »Unsere Zukunft gleicht der von Passagieren auf einem Vergnügungsschiff, die seelenruhig oberhalb der Niagara-Fälle herumgondeln und keine Ahnung haben, dass gleich die Motoren ausfallen werden.«26 Und was schätzt Lovelock, wann uns der Klimawandel über die Klippe kippen wird? In 15 bis 25 Jahren: so um 2033 herum.
Vor über tausend Jahren benutzte ein heiliger Abt ein ganz ähnliches Bild. Das Schiff, das die sündige Menschheit trägt, befinde sich durch drohende Sturmwinde in größter Bedrängnis: »Gefährliche Zeiten liegen vor uns, das Ende der Welt droht hereinzubrechen.«27 Dass der Abt nicht recht behalten sollte, darf uns nicht zu der Annahme verleiten, dass sich auch James Lovelock und die Wissenschaftler täuschen, die Ähnliches vorhersagen: Denn die Wissenschaft ist zweifellos ein verlässlicherer Führer in die Zukunft, als die Bibel es war. Wir fühlen keine große Nähe zu den besorgten Christen des 10. und 11. Jahrhunderts, und auch ihre Hoffnungen und Ängste sind uns eher fern.[25] Wenn wir allerdings über die Möglichkeit nachdenken, dass unsere Sünden unseren Untergang bedeuten könnten, dann sind wir Bewohner der westlichen Welt sehr deutlich als ihre Nachfahren erkennbar. Allein schon das Meinungsspektrum zum Thema ›Globale Erwärmung‹ – von Lovelock und seinen Kollegen, die das Schlimmste befürchten, bis zu denen, die das ganze Problem schlicht in Abrede stellen; dann die ängstlich-verantwortlichen Menschen, die zwar zutiefst überzeugt sind, dass sich das Klima erwärmt, aber trotzdem ihre Autos volltanken, ihre Häuser heizen und Billigflieger nutzen; schließlich das weit verbreitete mulmige Gefühl, dass irgendwie irgendetwas geschehen muss: All das sind wohl Reflexionen, die tatsächlich in einem fernen Spiegel flimmern und zucken. Selbst wenn es dem Leser komisch vorkommen mag: Der Historiker des ersten Jahrtausends hat von dem Gefühl, an der Schwelle einer neuen Epoche zu stehen, durchaus profitiert.
Das Gefühl, dass eine neue Epoche heraufdämmert, schärft prinzipiell das Denken. Wer einen bedeutsamen Jahrestag hinter sich hat, ist unweigerlich sensibler für Veränderungsprozesse. So kam es, glaube ich, dass die Beschäftigung mit der globalen Erwärmung, obwohl es schon Jahre zuvor Beweise dafür gab, erst mit dem Beginn des neuen Jahrtausends mit echtem Nachdruck einsetzte. Dasselbe kann im Blick auf die Ängste vor anderen tiefverwurzelten Trends beobachtet werden: die Zunahme der Spannungen zwischen dem Islam und dem Westen beispielsweise oder das Erstarken Chinas. Genauso konnten in den 1030er-Jahren die Männer und Frauen, die das Gefühl hatten, aus einer Zeitordnung in eine andere übergewechselt zu sein, sich plötzlich des Eindrucks nicht mehr erwehren, dass es eine höchst befremdliche, seltsame und irritierende Zukunft war, die sich da vor ihnen ausbreitete. Lange war die Vorstellung, dass das Ende der Welt bevorstand, dass Christus wiederkommen und ein neues Jerusalem sich aus den Himmeln herabsenken werde, eine Art Antwort gewesen. Doch diese Erwartung wurde enttäuscht, und nun stellte die christliche Bevölkerung von Westeuropa fest, dass ihr nichts anderes übrigblieb, als Lösungen zu finden, die sich aus ihrer eigenen Rastlosigkeit und ihrem eigenen Scharfsinn ergaben: Sie musste die heroische Aufgabe auf sich nehmen, das himmlische Jerusalem auf Erden mit eigenen Händen zu errichten.
Wie die Menschen das alles anpackten, wie eine neue Gesellschaft und ein neues Christentum sich allmählich aus den Turbulenzen des Zeitalters ab zeichnete, das ist ein höchst bemerkenswerter und bedeutsamer historischer[28] Prozess – zudem einer, dem natürlich ein umfassender epischer Bogen innewohnt. Eine Revolution, wie das 11. Jahrhundert sie erlebte, kann letztlich nur im Kontext der Ordnung verstanden werden, die sie ablöste. Daher reicht die Geschichte, die ich in diesem Buch erzähle, weit in die Zeit zurück: bis zu den ersten Ursprüngen des Ideals eines christlichen Reiches. Der Leser wird sich auf eine Reise begeben, die zu den Ruinen der pax Romana führt und zu den lange Jahrhunderte prägenden Versuchen, sie wiederzubeleben; er wird von einem Kontinent hören, der von Invasionen, sozialen Zusammenbrüchen und dem Ethos von Schutzgelderpressungen verwüstet war; er wird die Erfindung des Rittertums miterleben, die Geburt des Ketzertums und die Entstehung der ersten Burgen; und er wird erfahren von den Taten von Kalifen, Wikinger-Königen zur See und Äbten.
Karte 1: Europa im Jahr 1000
Vor allem ist dies ein Buch darüber, wie aus dem Vorgefühl des Weltendes ein neuer Anfang wurde: Betrachtet man es nämlich von unserem Standpunkt aus, dann erstreckt sich die Straße zur Moderne deutlich aus dem ersten Jahrtausend vorwärts, und sie kennt zwar abrupte Wendungen und Kurven, aber sie ist nicht von einer so kompletten Katastrophe zerschnitten, wie sie das Jahr 1000 von der Antike trennt. Auch wenn uns der Gedanke vielleicht mit Unbehagen erfüllt – so können doch die Mönche, Krieger und Leibeigenen des 11. Jahrhunderts als unsere direkten Vorfahren bezeichnet werden, was die Völker früherer Jahrhunderte nie waren. Millennium handelt also kurz gesagt von der bedeutendsten Ausgangssituation der westlichen Geschichte: dem Beginn einer Reise, deren abruptes Ende vielleicht in ferner Zukunft erst durch eine wirkliche Apokalypse markiert wird.
[29]»Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie tausend Jahre ist und tausend Jahre wie ein Tag.«
2. Petrus 3.8
»Der Glaube ist Europa. Und Europa ist der Glaube.«
Hilaire Belloc
[31]KAPITEL 1
DIE RÜCKKEHR DES KÖNIGS
Die Hure Babylon
Das alles will ich dir geben«, sagte Satan zu Jesus und zeigte ihm alle Reiche der Welt, »wenn du niederfällst und mich anbetest.«1 Jesus aber, dem irdische Macht nichts bedeutete, widerstand der Versuchung. Satan zog sich konsterniert zurück; und Engel kamen und dienten dem Menschensohn. Dasberichteten jedenfalls seine Jünger.
Die Reiche, die der Satan Jesus zeigte, hatten bereits einen einzigen Herrn: Caesar. Er war der Herrscher über Stadt, die die ganze Erde niedergetrampelt, in Stücke gerissen und verschlungen hatte, »sehr greulich«2; und von seinem Palast auf dem Palatin in Rom herrschte er über das Schicksal von Millionen von Menschen. Jesus kam auf die Welt und lebte als lediglich einer von den unzähligen Untertanen Caesars. Aber das Gebot, das der ›Gesalbte‹, der ›Christ‹ verkündete, war nicht von dieser Welt. Die Herrscher und ihre Legionen konnten sich seiner nicht bemächtigen. Das Himmelreich war nämlich den Barmherzigen verheißen, den Sanftmütigen, den Armen. »Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen.«3 Und sogar im Angesicht des Todes handelte Jesus noch gemäß seinen Worten. Als die Wachen kamen, um ihn festzunehmen, trachtete Petrus, ›der Fels‹, auf dem der Prophezeiung zufolge die Kirche selbst erbaut werden sollte, danach, seinen Herrn zu verteidigen; Jesus aber heilte den Mann, der in dem Handgemenge verwundet wurde, und befahl Petrus, seine Waffe wegzustecken. »Denn wer das Schwert nimmt«, warnte er seinen Jünger, »der soll durchs Schwert umkommen.«4Jesus wurde vor einen römischen Statthalter gezerrt, doch auch hier wehrte er sich nicht und wurdeals Feind Caesars zum Tod verurteilt. Römische Soldaten bewachten ihn, als ersein Kreuz durch die Straßen von Jerusalem und hinaus zum Exekutionsplatz [32] schleppte, zur Schädelstätte, Golgotha. Römische Nägel wurden durch seine Hände und Füße getrieben. Die Spitze eines römischen Speers stieß man in seine Seite.
Die Jünger Christi behaupteten der Welt gegenüber in den folgenden Jahren und Jahrzehnten unermüdlich, dass ihr Herr aus seinem Grab auferstanden sei und dass er Satan und die Fesseln des Todes bezwungen habe; es war also nur folgerichtig, dass sie das Reich der Caesaren als Monstrosität ansahen. Petrus, der für sich entschieden hatte, im Rachen der Bestie selbst das Evangelium zu verkündigen, nannte Rom ›Babylon‹;5 er wurde dann dort derselben grausamen Hinrichtungsart unterzogen wie sein Herr: Er starb am Kreuz. Andere Christen, die man in der Hauptstadt gefangennahm, wurden in Tierfelle eingenäht und von Hunden in Stücke gerissen, oder man verwendete sie in den kaiserlichen Gärten als lebende Fackeln. Rund 60 Jahre nachdem Christus sich dem Anblick Seiner Jünger entzogen hatte, wurde einem Jünger namens Johannes eine Offenbarung zuteil, eine Vision vom Ende der Tage, in der Rom als Hure erscheint, »betrunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Märtyrer«; sie sitzt auf einem scharlachroten Tier und ist bekleidet und geschmückt mit Purpur und Gold – »und auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis: ›Das große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Greuel auf Erden‹.« Ihr Anblick überwältigend, doch der Untergang der Hure war vorherbestimmt. Rom würde fallen, verheerende Vorzeichen würden die Menschheit heimsuchen, und Satan, »der Drache, die alte Schlange«, würde aus seinem Gefängnis ausbrechen, bis endlich in der letzten Stunde der Abrechnung Christus selbst wiederkommt, und alle Welt wird gerichtet werden, und Satan und seine Engel werden verdammt und in den feurigen Pfuhl geworfen. Und ein Engel, derselbe, der Johannes die Offenbarung gebracht hatte, warnte ihn, die Worte der Prophezeiung, die ihm gegeben wurden, nicht für sich zu behalten: »Denn die Zeit ist nahe.«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!