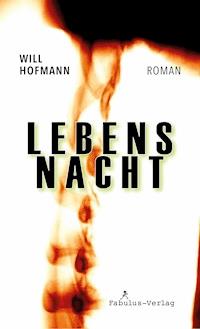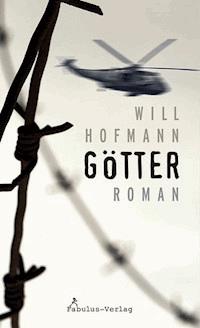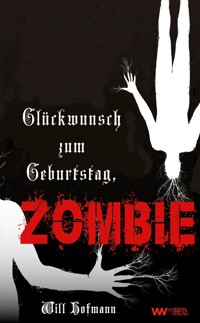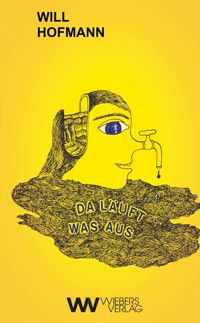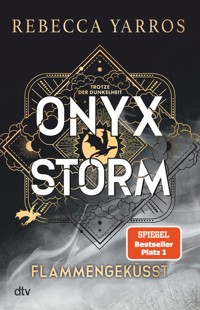Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wiebers Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ausgerechnet ein Jucken in der Kniekehle verhilft Ede zu unverhofftem Reichtum. Der Mittdreißiger, der sich schon als Kind für Geld begeistert hat, entdeckt einen Zusammenhang zwischen den quälenden Reizen seiner Neurodermitis und dem Lauf von Roulettekugeln. Schnell perfektioniert er sein System und wird ein gemachter Mann. Doch der Traum vom sorglosen Leben voller sinnlicher Genüsse währt nicht lange. Ede gerät in die Hände einer Verbrecherbande, die sich mit seiner Hilfe bereichern will, und eine Odyssee durch Spielcasinos rund um den Globus beginnt. Zunächst erkennt Ede in ihrer Route ebenso wenig eine Bedeutung wie in seiner Marotte, an jedem Ort eine seltene Münze zu erstehen. Doch bald begreift er, dass das Ziel der Reise etwas gänzlich anderes sein wird als materieller Reichtum. Der utopische Gedanke einer Welt ohne Geld ist Ausgangs- und Endpunkt für Will Hofmanns fantastischen Roman, der einen abenteuerlichen Reisebericht mit Mystery- und Science-Fiction-Elementen und mit leichtfüßig-philosophischen Reflexionen verknüpft. Edes Weltreise durch exotische Spielhöllen wird zugleich zu einer Reise durch die Geschichte des Geldes und dessen unheilvoller Wirkung - und eine Reise zur Entdeckung des eigenen Selbst.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 401
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Willi Hofmann,
Jahrgang 1949, bringt eine einzigartige Kombination aus naturwissenschaftlichem Wissen und literarischer Fantasie in seine Werke ein. Mit einem Hintergrund in Medizin, Psychiatrie und Psychotherapie, sowie einer langjährigen Tätigkeit als Dozent, verbindet er Fachwissen mit der Fähigkeit, komplexe Themen anschaulich und fesselnd zu erzählen.
Als Roman- und Kinderbuchautor hat Hofmann zahlreiche Bücher veröffentlicht, die Themen wie Menschlichkeit, Natur und die Grenzen des wissenschaftlichen Fortschritts beleuchten. Sein Stil ist geprägt von skurrilen Wendungen, tiefgründigen Figuren und einer besonders durchdachten Mischung aus Wissenschaft und Fiktion.
Will Hofmann
Million Dollar Boy
Eine Weltreise auf den Spuren des Geldes
Wiebers Verlag Berlin
Meinen Hundertjährigen: Frau Tollek, Frau Harder und Frau Gohr
Dank des Autors an
Trude Hofmann für Kritik und Anregungen,
Anna Pichotka für die Hilfe im Französischen sowie
Anne Theuer für die Ermutigung.
INHALT
Prolog
Teil I – Fähigkeiten
Teil II – Reisen mit Russen
Teil III – Verhaftung
Teil IV – Liáng Lan
Teil V – Lydien
Teil VI – Einblick
PROLOG
Jetzt, wo wir das M bekommen werden für den Flug in die Türkei, habe ich mir vorgenommen, die Ereignisse aufzuschreiben. Es ist erstaunlich, wie schnell wir uns alle an das neue System gewöhnt haben. Wir alle, auf der ganzen Welt − an das System ohne Geld.
Es ist mir längst selbstverständlich geworden, dass ich die neuen Tintenpatronen und den Packen Druckerpapier im Laden einfach nur aus dem Regal nehmen muss. An dem Kassierer kann ich einfach vorbeigehen, aber wir wechseln dabei freundliche Worte. Das war früher die Ausnahme. Er weiß, dass beide Güter zur Kategorie G gehören. Bei denen muss ich keine Berechtigung nachweisen. Diese Artikel stehen mir zu, stehen jedem zu.
Ich könnte auch zehn oder hundert davon mitnehmen, niemanden würde das scheren. Aber die stünden nur bei mir zu Hause herum, würden Platz wegnehmen und einstauben. Ich kann ja jederzeit neue holen, wenn sie aufgebraucht sind, so wie jetzt.
Die Aufregung hat sich erstaunlich schnell gelegt. Nicht gelegt allerdings haben sich die Spekulationen um das Warum. Täglich werden in den Medien neue Theorien von Fachleuten verbreitet, was sich abgespielt haben könnte. Manche klingen plausibel, andere hanebüchen. Die Koryphäen aller Disziplinen streiten sich.
Es gibt nur eine Handvoll Leute, die wissen, was sich abgespielt hat. Und dazu gehöre ich. Viele Einzelheiten sind aber auch mir verborgen geblieben. Die Natur des Prinzips und die Gestalt des Interpres sind mir nach wie vor ein Rätsel. Doch die Ereignisse, die zum Umbruch geführt haben, die kenne ich. Und ich denke, jetzt − nach fast einem Jahr − ist es an der Zeit, das Geheimnis zu lüften.
Es ist unglaublich, wie schnell dieses Jahr vorbei war. Tascha und ich sind inzwischen verheiratet, und ich bemühe mich, endlich Russisch zu lernen. Hätte ich nur besser aufgepasst, damals in der Schule. Doch Russisch war verhasst, nicht nur in meiner Klasse, nicht nur auf unserer Schule, sondern bei fast allen Schülern in ganz Magdeburg. Ach, was sage ich, in der ganzen DDR. Und die paar Bruchstücke, die ich mit Mühe gelernt hatte, hatte ich erfolgreich verdrängt.
Ich bin wieder beim Zoo am Bahnhof angestellt. Munz, der Chef der Tierhandlung, und die Kollegen haben mich nach meiner Rückkehr freudestrahlend aufgenommen. Es war eine bewegende Begrüßung. Anfangs hatte ich versucht, die Tränen meiner Rührung zu unterdrücken. Dann besann ich mich: Hatte ich nichts gelernt auf meinen Reisen? Zulassen, geschehen lassen! Als ich Marlene von der Kasse an mich drückte, brachen die Dämme. Ich schluchzte los und versuchte, dabei zu lächeln. Marlene küsste mich auf die Wange, und ich hatte beinahe das Gefühl, ich müsste mir in die Hose machen. Da ist man Mitte Vierzig, und dann das…
Viel Zeit zum Reden gab es nicht, der Laden machte ja bald auf. Nur kurz umriss ich, was ich in meiner Abwesenheit gemacht hatte – selbstredend, ohne das Geheimnis zu lüften. Verwundert waren die Mitarbeiter hauptsächlich, dass meine Braut keine Portugiesin war.
Auch die Abendschule hat mich wieder, ich mache gute Fortschritte. Nächstes Jahr steht das Abi an. Die Kollegen trauern jetzt schon, dass ich sie für das Veterinärmedizin-Studium wieder verlassen werde. Wahrscheinlich werde ich der älteste Studierende sein, doch das will ich jetzt durchziehen.
Ähnlich aufregend war das Wiedersehen mit Fritze. Machte der große Augen, als ihn sein alter Zellengenosse Ede im Gefängnis besuchte! Hier versuchte ich es gar nicht, mich zu beherrschen.
Wange an Wange schmiegte ich meinen Kopf an seinen – und konnte plötzlich verstehen, wieso Tascha immer meckerte, wenn ich unrasiert war. Die Freudentränen blieben hier zwar aus, aber ich atmete heftig. Für Fritze hatte sich das Leben fast überhaupt nicht geändert – Knast blieb Knast. Nur dass ihm das Abo von der Rheinischen Post nicht mehr zugestellt wurde, das fuchste ihn.
Tascha und ich wohnen weiter bei Frau Harder. Sie hat uns die Wohnung nebenan abgetreten. Wir haben eine Wand durchbrochen und so ausreichend Platz geschaffen. Wir wohnen noch dort, aber wir zahlen keine Miete. Niemand zahlt mehr Miete.
Tascha betreibt nach wie vor ihren Kunst- und Ikonenhandel. Es ist schon merkwürdig, wie sie an ihre Ware kommt, ohne dass sie einkaufen muss oder sie veräußert, ohne dass jemand bezahlt. Sie gibt die Kunstwerke heraus, wenn ihr ein Interessent würdig erscheint. Gespräche entscheiden, nicht das dicke Konto.
Manchmal führt das zu merkwürdigen Ereignissen. Auf diese Art kam Fritze wieder frei. Tascha hatte einem Kunden gegenüber nur erwähnt, dass das neue System auch Nachteile habe. Sie führte meinen Freund im Gefängnis an, dem das Abonnement der Rheinischen Post einfach deshalb nicht zugestanden werde, weil es ja in Magdeburg genügend Zeitungen gebe. Und Fritze war nicht der Typ, der bettelte. Ein Sturkopf, aber ein sympathischer.
Der Kunde war Anwalt. Er versprach Tascha, sich um die Angelegenheit zu kümmern – unabhängig davon, ob sie ihm sein Wunschbild aushändigen würde oder nicht. Er bekam es. Und er setzte nicht nur das Abo durch, er erreichte ziemlich schnell, dass Fritzes ganzer Fall nochmals aufgerollt wurde. Er deckte nicht nur Verfahrensfehler auf, sondern konnte die Unschuld meines Freundes hieb- und stichfest belegen.
Ich werde noch zur richtigen Heulsuse. Als wir Fritze abholten, flossen die Tränen. Und das tat gut. Zum Glück kam er provisorisch erst einmal bei Frau Harder unter, in einer kleinen Kammer. So hatten wir den Freund nicht nur in Freiheit, sondern auch in unserer Nähe.
Nicht nur Tascha fühlte sich anfangs merkwürdig bei ihrer Arbeit. Ähnlich ging es auch der Belegschaft im Zoo am Bahnhof. Die Kunden kamen und erkundigten sich nach einem Tier. Man unterhielt sich, man erforschte die Wünsche der Kunden, man beriet, schätzte ab, welche Erfahrung sie mit Tieren hatten und ob die kleinen Wesen es gut bei ihren neuen Herrchen haben würden. Nicht immer gaben wir ein Tier heraus, und fast immer konnten wir unsere Gründe dafür darlegen. Dass ein Kunde im Streit das Geschäft verließ, das kam eigentlich nicht vor. Missgestimmt war der eine oder andere schon, doch oft waren auch die nach ein paar Tagen wieder da – mit geänderter Einstellung. Dann gaben wir den neuen Liebling gerne ab. Wir löschten ein H, I oder J von der Chipkarte, je nachdem, um welches Tier es sich handelte. Mir kommt es jetzt vollkommen absurd vor, dass man früher Geld haben musste. Geld, Geld und nochmals Geld.
Seit der Wende ist vieles viel besser geworden. Ja, wir hatten wieder eine Wende, die zweite in meinem Leben. Bei der nationalen Wende 1989 war ich gerade mal den Kinderschuhen entwachsen – und jetzt gab es die internationale. Die Zahl der Kriminellen hat sich laut Statistik sprunghaft verringert. Die bewaffneten Konflikte – sprich Kriege – sind deutlich weniger geworden.
Viele Regierungen sind konstruktiv zusammengerückt, um die postmonetäre Ära kreativ zu gestalten. Es finden sich bis jetzt keine Anzeichen, dass Geld jemals wieder eine Rolle spielen sollte. Es hatte sich auch schnell gezeigt, dass die Wirtschaft nicht zusammenbrach. Im Gegenteil – es gab einen ungeahnten Aufschwung. Den Ökonomen war schnell klar: Gesteigerte Nachfrage war der Grund, und humanere Arbeitsbedingungen steigerten die Produktivität.
Die Nachrichten strotzen nicht mehr nur von Gräueltaten. Neben Sport hat sich eine neue Rubrik etabliert: Schönes im Leben. Hier wird von ›kleinen‹ Ereignissen berichtet, einfach von Erlebnissen, die einen oder mehrere Menschen besonders glücklich machen.
Zum Beispiel hat jemand unerwartet Hilfe erfahren oder etwas wiedergefunden, was er verloren und was ihm viel bedeutet hat. Menschen, die einen Brand, einen Unfall oder eine schwere Krankheit überstanden haben, berichten von ihrem Glück.
Ja, das Jahr war wie im Fluge vergangen! Und der nächste Flug stand an.
Für die Reise in die Türkei mussten Tascha und ich bei der Bank und dann bei der Kommission vorsprechen. Die freundliche Bankangestellte bescheinigte uns, dass wir beide schon die Luxusstufe K erreicht hatten. Für den Flug benötigten wir allerdings ein M. Die Kommission tagte zweimal in der Woche, den Antrag stellte man mindestens sechs Wochen vorher. Wir bekamen dann Tag und Uhrzeit der Bearbeitung mitgeteilt. Die Behörden hatten eine Internetseite eingerichtet, auf der jeder einsehen konnte, wer welchen Antrag gestellt hatte. Gleichzeitig wurde der Antrag im Lokalteil der Magdeburger Nachrichten veröffentlicht und im Rathaus ausgehängt.
Aufgeregt waren wir schon, als wir im Wartezimmer saßen. Dreißig oder vierzig weitere Leute waren dort, die machten uns noch nervöser. Es schien uns, als wären sogar Reporter darunter. Die Unruhe legte sich auch nicht, als wir aufgerufen wurden, zumal all die Leute mit uns in den Raum strömten. Unser Antrag hatte Aufmerksamkeit erregt, weil Edgar Nitschke durch die Gerichtsverhandlung zu den Steuerhinterziehungsvorwürfen noch eine kleine Berühmtheit war. Damals waren Millionen noch Sensationen, und ich hatte dem Gericht nicht plausibel machen können, woher meine stammten.
Beinahe sah es im KR des Rathauses aus wie in einem Gericht. Der Vorgang ähnelte auch einer Gerichtsverhandlung. Ach ja, KR bedeutet Kommissions-Raum.
Sechs Leuten saßen wir gegenüber. Der Vorsitzende fragte nach den Personalien und unserem Begehr. Wir trugen vor, dass wir in der Wendezeit im Tmolos gewesen seien, uns in dieser Zeit so richtig ineinander verliebt hätten und dort nun, nach einem Jahr, Freunde aus Russland und China treffen wollten. Was denn der Tmolos sei, wollte der Vorsitzende wissen. Wir erklärten, dass dieses Gebirge in der Türkei liege und heute Bozdağ heiße. Da wir aber beide ein Faible für Geschichte hätten, bevorzugten wir die alten Bezeichnungen.
Der Vorsitzende fragte die Zuschauer, ob jemand eine Frage habe. Tatsächlich wollte jemand wissen, was uns gerade in dieses Gebirge getrieben habe. Den Namen konnte er nicht richtig aussprechen. Das sei doch keines der üblichen Touristenziele in der Türkei.
»Ich habe damals Münzen gesammelt«, erklärte ich. »Und es wird vermutet, dass in dieser Gegend die allerersten Münzen der Menschheitsgeschichte geprägt wurden.«
»Hat das etwas mit Ihrem ungeklärten Reichtum zu tun?«, ollte der Frager weiter wissen. Ich musste aufpassen, was ich sagte.
Ich überlegte kurz, ob ich als Begründung unser komplettes Erlebnis im Bozdağ erzählen sollte. Ich fürchtete aber, dass ich dann eher im Irrenhaus als in der Türkei landen könnte.
Der Vorsitzende kam mir zu Hilfe. »Darüber haben wir hier nicht zu befinden«, erklärte er. »Das Verfahren ist abgeschlossen, Herr Nitschke wurde freigesprochen und sitzt hier wie jeder andere Antragsteller auch. Ihm geht es nicht anders als allen anderen Millionären, ihre damaligen Reichtümer nützen ihnen heute überhaupt nichts mehr.« Nach einer Pause fragte er weiter:
»Gibt es denn Einwände gegen das M für die Antragstellerin und den Antragsteller?«
Ein wenig Gemurmel, dann meldete sich noch eine junge Frau zu Wort: »Man soll es genehmigen. Das ist doch ein richtig romantisches Ereignis, das muss man unterstützen.«
Weitere Beiträge kamen nicht. Die Kommission zog sich zur Beratung zurück. Nach zehn Minuten betraten sie den Saal erneut.
»Dem Antrag wird stattgegeben. Und zwar einstimmig.« Das waren die erleichternden Worte des Vorsitzenden. Tascha und ich fielen uns in die Arme. Beim Verlassen des Rathauses bekamen wir einige Glückwünsche. Ein Reporter machte ein paar Fotos. Am nächsten Tag erschien in einem Lokalblatt ein kleiner Artikel in der Rubrik Schönes.
Die Verfahren in Russland und China unterschieden sich etwas von unseren, waren aber im Prinzip ähnlich. Alle bekamen wir die Reise bewilligt.
Deutschland hatte als erster Staat dieses Punktesystem eingeführt. Es wurde beinahe weltweit übernommen. Die USA hatten zunächst heftig dagegen protestiert. Sie wollten eine Klassifikation, die mit A beginnt: weil einerseits das Alphabet, andererseits Amerika mit diesem Buchstaben beginne. Die Diskussion ebbte schnell ab, als Tracy Chapman spöttisch bemerkte, da könne man doch auch das Star-Spangled Banner in A-Moll singen statt in C-Dur. Die Amerikaner setzten das G in der Folge für General Needs ein.
Wer hätte sich vor zwölf Monaten ausmalen können, was aus den Banken und ihren Angestellten werden würde? Jetzt ist auch das schon selbstverständlich: Sie verwalten die Bonusvergabe. Mit den Boni haben die Regierungen eine Art Vergütungssystem geschaffen. Leistungen und Berechtigungen werden auf einer Chipkarte gespeichert.
Für alle Einkäufe oder beanspruchte Dienstleistungen oberhalb G muss ich die Bonuskarte durch einen Scanner ziehen. Das bedeutet zum Beispiel: Nahverkehrsmittel sind frei, Fernreisen nur mit Bonus möglich.
Alle G-Leistungen bekomme ich ohne Boni. Das sind Grundnahrungsmittel, Wohnung und eine Grundausstattung an Kleidung.
An Kleidung steht jedem zu: Rock/Hose, Unterwäsche, Socken, Bluse/Hemd, Pullover – zu einer jeweils festgelegten Stückzahl pro Jahr. Der Bonusstand braucht nicht vorgelegt zu werden. Der Verkäufer verlässt sich auf die Ehrlichkeit der Kunden. Eine Kombination aus Anzug/Kostüm, Mantel und Schuhen steht einem alle drei Jahre zu. Die muss man sich auf der Bonuskarte mit Kaufdatum einspeichern lassen. Diese Artikel gehören in Kategorie H.
Für bestimmte Anträge muss die Bank die erreichte Stufe bestätigen, so wie bei unseren Flügen.
Als G steht einem weiter zu: ein Smartphone und ein einfach ausgestatteter Computer sowie ein Radio-, ein Fernseh- und ein Hi-Fi-Gerät samt Reparatur oder Austausch bei Irreparabilität. Weitere und aufwändiger ausgestattete elektronische Geräte fallen alle vier Jahre unter H.
Wasch- und Spülmaschinen gehören zu G. Verzichtet jemand auf diese Geräte, steht ihm ein Ausgleich in den Kategorien I bis M zu.
Die Kategorien I bis U sind die Luxus-Kategorien. Den Eintrag I bekommt jemand, der fünfunddreißig Stunden in der Woche arbeitet. Die Art der Arbeit zählt nicht. Eine weitere Möglichkeit aufzusteigen ist das Ableisten von Überstunden. Die werden allerdings nur anerkannt, wenn die Betriebsleitung nachweisen kann, dass sie erforderlich sind und keine geeigneten Mitarbeiter zu bekommen sind.
Engagement in der Freizeit bringt Punkte. Die Trainer beim MSV 90 bekommen alle ihr J. Ich bekomme das für meine Abendschule. Soziales Engagement bringt ebenfalls Steigerungen.
Steuern werden nicht mehr gezahlt – womit auch? Der Staat hat keine ›Ausgaben‹. Die Beamten wie Polizei, Feuerwehr und Verwaltung bekommen ihre Einträge auf die Bonuskarte.
Auf Arbeitgeberseite müssen Chefs und Vorgesetzte nachweisen, dass sie ihren Betrieb ordentlich führen. Zufriedene Angestellte, ermittelt über Befragung der Bank, erbringen ihnen eine mehr oder weniger hohe Stufe der Luxus-Kategorien, ebenso die Anzahl der Angestellten und der Erfolg eines Unternehmens. Bei Sportlern, Schauspielern, Musikern und Sängern fließt der Bekanntheits- und Beliebtheitsgrad in die Vergabe mit ein.
Erzielt jemand ein X, dann steht ihm alle fünf Jahre ein Luxuswagen zu, ein Porsche, Lamborghini, Jaguar oder Ferrari. Bekommt er einen neuen, gibt er den alten als Gebrauchtwagen ab. Der gilt dann immer noch als Artikel der Klasse U. X ist sozusagen die Luxus-Luxusstufe, das Allerhöchste.
Das bedeutet nun aber nicht, dass jemand, der M oder N eingetragen hat, niemals an einen Porsche kommen kann. Er stellt einen Antrag und begründet sein Verlangen. Die Kommission prüft und entscheidet. Als Argument kann der Bewerber Leistungen anführen, die auf der Bonuskarte nicht erfasst sind. Oder er stellt seine besondere Motivation dar, belegt etwa, wie fasziniert er von diesem Fahrzeug ist. Kreativität in der Argumentation wird gewürdigt. Der Wunsch, einfach mal aufs Gaspedal zu treten, vermindert die Chancen; die Absicht, Freunde zu erfreuen, steigert sie – beispielsweise durch einen Überraschungsbesuch.
In der Kommission kann jeder mitarbeiten. Sie entscheidet ähnlich einem Schöffengericht. Die Mitarbeit verbessert selbstredend den eigenen Bonus.
All das ging mir auf dem Flug nach Izmir durch den Kopf. Der Landeanflug erfolgte bei etwas stürmischem Wetter. Immer noch wurde mir mulmig bei solch wackeligem Aufsetzen, auch nach Hunderten von Flügen. Wenig später trafen Tascha und ich uns mit den Freunden im Hotel Palas, wie ein Jahr zuvor. Am nächsten Tag reisten wir mit dem Zug nach Alaşehir, auch wie vor einem Jahr. Wir zogen ein ins Hotel Benan und mieteten einen Land Rover. Zufällig bekamen wir genau den wieder, den wir schon einmal gehabt hatten.
Was genau uns erwarten würde, wussten wir nicht. Doch wie alles begonnen hatte, das wusste ich umso besser.
TEIL I – FÄHIGKEITEN
Wieder einmal setzte ich je fünf Euro auf Rot, Impair und Passe. Die Kugel rollte. Sie fiel auf die 23, eine rote, ungerade Zahl, größer als 18. Der Croupier schob mir sechs Jetons zu – dreißig Euro. Die Spielbank würde ich mit rund zwanzigtausend verlassen.
Ich hatte es mir zur Aufgabe gemacht, immer mit fünfzehn Euro zu beginnen. Sollte das erste Spiel keinen Gewinn bringen, wäre mein Aufenthalt im Casino für diesen Abend beendet. Diese Vorsichtsmaßnahme hatte ich Harry abgeschaut, sie war aber eigentlich nicht mehr nötig, seit ich die Signale deuten konnte und sie umsetzte. Sie funktionierten unmissverständlich.
Drei Körperstellen signalisierten mir, ob die linke oder die rechte Seite gewann.
Links auf dem Roulettetisch – mit Blick zum Kessel – sind Passe, Pair und Noir, Schwarz, rechts Manque, Impair und Rouge, Rot. Es geht dabei um die ›einfachen Chancen‹, um das Entweder-Oder. Ganz klar ist das bei Schwarz und Rot, auch für den, der sich im Roulette überhaupt nicht auskennt. Setze ich auf Schwarz, und die Kugel rollt auf ein schwarzes Feld, dann wird mein Einsatz verdoppelt; fällt sie auf Rot, ist er weg – er gehört der Bank.
Der Croupier zieht ungerührt alle Jetons, die nicht gewonnen haben, zu sich. Sie klackern in einen Schlitz wie bei einer großen Sparbüchse. Genauso verhält es sich bei dem Paar Passe und Manque, größeren oder kleineren Zahlen also – links von 19 bis 36 und rechts von 1 bis 18. Und das Gleiche gilt auch für die Alternative Pair oder Impair, gerade oder ungerade Zahlen.
Hier eine Anmerkung, zu der mir Frau Gohr, unsere gestrenge Deutschlehrerin, geraten hatte. Nachdem ich meine Geschichte fertig aufgeschrieben hatte, zeigte ich ihr das Manuskript. Neben einem Haufen Rechtschreibe-, Tipp-, Flüchtigkeits-, Kommata-, Grammatik- und stilistischen Fehlern – sie gab mir die Gesamtnote drei minus – meinte sie, meine Ausführungen sowohl was das Roulettespiel als auch die Biologie betrifft, seien zu ausschweifend und für jemanden, der sich nicht für diese Thematiken interessiert, zu langweilig. Das könnte den Lesespaß regelrecht abwürgen.
Sie riet mir dazu, diese Passagen einzurücken. So wäre leicht erkennbar, dass es hier ›sachlich zur Sache‹ gehe. Dann könne jeder entscheiden, ob er diese Stellen nur überfliegen oder ganz auslassen will. Der Verlauf der Geschichte bliebe ja trotzdem nachvollziehbar. Und wer es genau wissen wolle, der könne sich überzeugen, dass alle Ausführungen Hand und Fuß haben.
Geldsorgen musste ich mir also nicht mehr machen, das dämmerte mir schnell. Was hatte ich mir für Sparpläne aufgestellt, vorher. Ich hatte genaue Listen meiner Ausgaben geführt und sie mit meinem Gehalt verrechnet, hatte Preise verglichen und das Billigste gekauft. Gefreut hatte ich mich über jeden gesparten Cent und ihn in Grün in meine Listen eingetragen, um Rücklagen zu schaffen für unvorhergesehene Ereignisse und größere Anschaffungen. Vermögenswirksame Leistungen nahm ich selbstverständlich in Anspruch und wunderte mich über Kollegen, die sich die Zulagen entgehen ließen. Riestern und Bausparen gehörten zu meiner finanziellen Absicherung, wenn auch Rente und Eigenheim in unendlicher Ferne zu liegen schienen. Für mich war es eine Frage der Vernunft und des Prinzips, auch wenn ich dann im Moment weniger im Portemonnaie hatte.
Zu Beginn meiner Glückssträhne frischte ich nur mein Gehalt auf mit den Gewinnen, leistete mir ein bisschen was. Jedoch wurden die Ansprüche schnell höher, mein Bedarf größer. Auffallen wollte ich nicht und machte mir Gedanken, wie mir das am besten gelänge.
In der Spielbank kennen sich die Stammspieler, und Gewinnserien fallen auf. Weil ich nicht unter Beobachtung stehen wollte, war eine meiner Strategien, bei einem Spielbankbesuch nicht nur Gewinne einzufahren. Ich setzte bewusst immer wieder auf Verlierer-Felder.
Ich machte keine Gewinne von einer Million, nicht mal einer halben. Maximum waren für mich fünfzigtausend, und die holte ich längst nicht immer.
Ich wechselte die Casinos, ging nie mehrmals hintereinander in das gleiche. So hatte ich zu Beginn die klassischen Spielerstädte Baden-Baden, Bad Homburg und Wiesbaden kennengelernt. Allein in Deutschland gibt es vierundsiebzig weitere Spielbanken. Ich musste mich also in keiner allzu oft sehen lassen. Mehr als einmal pro Woche ging ich selten hin, verband das gerne mit einer gemütlichen Zugfahrt – immer erster Klasse – und einem Kurzurlaub. Ich arbeitete von Montag bis Mittwoch; Donnerstag bis Sonntag hatte ich Zeit fürs Geldscheffeln.
Das Ausland besuchte ich nur ein paarmal, so etwa Lüttich, Amsterdam und Salzburg. Las Vegas hätte mich gereizt, die lange Fliegerei schreckte mich allerdings ab.
Sorgen bereitete mir die Pflicht, am Empfang jedes Mal den Pass vorzulegen. Ich war mir nicht sicher, ob die Besucher zentral registriert würden. Verbotenes tat ich nicht, man würde mich nicht belangen können. Ich fürchtete nur, dass man mir eines Tages den Zutritt verwehren könnte. Wie das ablaufen sollte, war mir nicht klar, denn die Ausgabe der Jetons und der Gewinne erfolgte ohne neue Ausweiskontrolle. Vielleicht war aber jemand aufmerksam genug und meldete weiter, dass da immer wieder einer kam, der nur einstrich – selbst wenn ein Jahr dazwischenlag.
Eigentlich dachte ich eher nicht, dass das passieren würde, hielt es aber auch nicht für ausgeschlossen in Zeiten, in denen alles, aber auch alles überwacht wurde. Ich konnte ja nicht ahnen, dass all diese Prinzipien, ja die bestehende Gesellschaftsordnung aus den Fugen geraten würden. Wer hätte damals gedacht, dass Geld mir eines Tages vollkommen gleichgültig sein würde? Eine Welt ohne Geld konnte ich mir zu diesem Zeitpunkt ganz und gar nicht vorstellen.
Ich hatte drei glückliche Jahre. Was man so glücklich nennt. Für echtes Glück stand ich mir wahrscheinlich selbst im Weg. Also sagen wir: ›Verhalten glückliche Jahre‹, das trifft es besser. Oder auch: ›zufriedene Jahre‹.
Was hatte sich für mich alles geändert mit meinen neuen Fähigkeiten? Das Erste und Wichtigste: Die Geldsorgen waren weg, das sagte ich schon. In meinem Job wechselte ich jetzt auf Teilzeit. Unbezahlten Urlaub nahm ich nur selten, schnell fehlte mir nämlich meine Arbeit. Die Tierchen waren es, die ich vermisste. Und die paar Kollegen auch. Ich war Verkäufer in einer Tierhandlung – mittelgroß, der Zoo am Bahnhof.
Wir hatten das Übliche: Meerschweinchen, Mäuse, Ratten, Hamster, Kaninchen und ein paar andere Nagersorten, dazu Fische, Vögel, ein paar Schlangen und andere Reptilien. Selten kam ein Wurf kleiner Katzen oder Welpen herein. Dazu verkauften wir jede Menge Futter und alles Mögliche an Zubehör – so wie das jeder kennt, der in einen solchen Laden geht.
Dreizehn Kollegen waren wir und der Chef. Der war nicht nur tierlieb, er hatte auch ein Herz für Menschen, speziell für seine Angestellten. Ich konnte nicht klagen, die meisten Kollegen waren in Ordnung. Ein richtiges freundschaftliches Verhältnis hatte ich aber zu keinem. Ich war eher ein Einzelgänger, und das eigentlich schon immer. Ich konnte mich gewaltig aufregen, wenn jemand zu spät kam oder etwas falsch einräumte. Meist erntete ich Spott dafür und hatte gelernt, meinen Mund zu halten. Das schien mir besser fürs Betriebsklima.
Im Großen und Ganzen machte die Arbeit uns Spaß. Alle waren wir Tierfreunde, und alle erfreuten wir uns an den Kindern: Wie sie mit ihren großen Augen in die Käfige und die Aquarien schauten. Wie widerwillig sie sich wegziehen ließen, wie enttäuscht sie waren, wenn sie ihren Wunsch nicht erfüllt bekamen. Wie überglücklich aber ihre Augen strahlten, wenn ich ihnen ihren neuen Liebling überreichen konnte.
Ärger gab es selten. Klar starb schon mal ein Tier in unserem Laden. Meist waren das Fische, denen sieht man nicht an, wie alt sie sind. Hin und wieder verendete auch ein Nagetier, je kleiner, desto öfter, Mäuse und Hamster also häufiger als Meerschweinchen und Kaninchen. Herr Munz, der Chef, machte nie groß Theater.
Unangenehmer war es schon, wenn sich ein Kunde beschwerte, dass ein Tier kurz nach dem Verkauf eingegangen war. Das kam sehr selten vor, in den fünfzehn Jahren, die ich bei Zoo am Bahnhof war, vielleicht zehn Mal. Schlimm waren die Kinderaugen, die dann so traurig schauten. Das Gemecker der Eltern aber musste der Munz aushalten. Doch der verstand es elegant, die Aufregung zu schlichten. Er erkundigte sich nach den Umständen, fragte nach Haltebedingungen und wie mit dem Tier umgegangen worden war – und schaffte es diplomatisch, nicht dem Kunden die Schuld zuzuschieben. Trotzdem gab er eine Reihe Tipps. In der Regel gingen die Käufer mit einem Ersatztier aus dem Laden – und die Kinderaugen glänzten wieder.
Es war nicht nur der Umgang mit den Tieren und den Kunden, der mir gut gefiel. Biologie war mein absolutes Lieblingsfach. Mehr der Bereich Tiere als Pflanzen, das ist klar. Im Betrachten anatomischer Darstellungen konnte ich aufgehen. Mein Taschengeld hatte ich früher gespart und lieber für tiermedizinische Atlanten ausgegeben als für ›Fix und Foxi‹ – damals begehrt wie alles aus dem Westen; mir waren diese Heftchen viel zu teuer.
Die Entwicklung des Lebens konnte ich auswendig herunterbeten – Befruchtung, Zellteilung, Morula, Blastozyste und Gastrulation. Manche Eins hatte ich mit meinen Vorträgen ergat- tert.
Also, wenn ich erklären soll, wie das geht mit der Zellteilung, dann muss ich damit anfangen, dass die Samenzelle das Ei befruchtet. Das passiert auf dem Weg des Eis zur Gebärmutter im Eileiter. Wenn man das Ei suchen wollte, dann hätte man theoretisch tatsächlich eine Chance. Es ist einen sechstel Millimeter groß, man könnte es mit bloßem Auge gerade so erkennen.
Nach der Befruchtung heißt es nicht mehr Ei, sondern Zygote. Dieses kleine Wunderding kann alles, daraus wird ein neuer Mensch geschaffen. Auf der Wanderung beginnt die Zygote sich zu teilen. Aus einer Zelle werden zwei. Dann vier, dann acht. Das ist fast so wie beim Roulette mit Rot und Schwarz. Immer eine Verdopplung, wenn ich richtig setze. Anders als beim Roulette wird aber das Gebilde zunächst nicht größer. Nach wie vor ist es von der Außenhülle des Eis umschlossen. Die Teilung findet im Inneren statt. Die Oberfläche ist zerfurcht, es zeichnen sich bald sechzehn, dann zweiunddreißig Zellen ab.
Die können immer noch alles. Trennt sich in diesem Stadium eine Zelle ab, dann entwickelt sich auch daraus ein eigenständiger Mensch. Geboren werden neun Monate später eineiige Zwillinge. Das passiert nicht allzu oft. Meist bleibt es bei diesem einen Zellhäufchen. Es sieht jetzt aus wie eine Brombeere oder eine Maulbeere, und die Biologen nennen es nach Letzterer die Morula.
Die Morula ist in vier Tagen entstanden und hat ihren Weg in die Gebärmutter zurückgelegt. In deren Schleimhaut nistet sie sich ein. Jetzt weicht die äußere Hülle auf, und unser Häufchen beginnt zu wachsen. Aus dem Klümpchen wird ein Ball, innen mit Flüssigkeit gefüllt. Der bekommt schon wieder einen neuen Namen, das ist jetzt die Blastozyste. Nicht weil sie aussieht wie eine Blase, sondern weil das der Keim ist, auf Griechisch Blastos.
Diese Zellen, die können längst nicht mehr alles. Löst man eine heraus, wird kein neuer Mensch daraus, sie hat schon spezielle Aufgaben. Sie ist nicht mehr omnipotent, sondern nur noch pluripotent – nicht Alleskönnerin, sondern Vielkönnerin. Und das ist immer noch eine Menge. Aus manchen Zellen entwickelt sich der Mutterkuchen, aus anderen der kommende Embryo. Das sind die berühmten embryonalen Stammzellen.
Diese Vorgänge sind äußerst spannend. Sie laufen zielgerichtet und folgerichtig ab und scheinen doch so störanfällig. Ein Wunder, das sich nach jeder Befruchtung wiederholt. Das begeistert mich noch heute.
Natürlich kam von Munz und den Kollegen die Frage, warum ich plötzlich halbtags arbeiten wolle und ob ich im Lotto gewonnen habe. Ich deutete vage etwas von einer Erbschaft an. Es sei nur vorübergehend, beteuerte ich, ich wolle ein bisschen ausspannen, solange der Segen reichte. Den Chef bat ich ausdrücklich, mich jederzeit wieder um eine volle Stelle bemühen zu dürfen. Bald fragte keiner mehr nach, ich war jetzt der Halbtags-Ede.
Es freute mich, wie meine Strategie klappte, nicht aufzufallen. Man sah keine neuen Reichtümer an mir. Dass das maßgeschneiderte Schuhe für tausend Euro waren, die ich trug, das merkte niemand – auch nicht, dass ich mir eine Saxonia-Armbanduhr für gut achtzehntausend Euro geleistet hatte. Den Audi A7 bekam kaum jemand zu Gesicht, weil ich weiter mit dem Rad zum Dienst fuhr. Und was ich an Kleidung trug, das fiel nicht weiter auf – darüber hatte ich ja meinen Kittel an. Dass das darunter ausschließlich von Ladage & Oelke stammte, konnte niemand ahnen. Es brauchte auch niemand zu wissen, dass ich mich bei diesem traditionsreichen Herrenausstatter einkleidete, wenn ich in einem der vier Hamburger Casinos spielte.
In der Fußballabteilung des MSV 90 war es noch einfacher. Ich erschien nach wie vor zum Training, machte das eine oder andere Turnier mit, ging danach immer mit einen trinken. Dass ich unregelmäßiger kam durch meine eigenen ›Auswärtsspiele‹, das fiel nicht auf, obwohl ich als pünktlich bekannt war. Seit ich in der Altherrenmannschaft war, hatte meine Zuverlässigkeit sowieso nachgelassen. Ich kickte nur noch zum Spaß, sagte ich.
Vorher tobte ich mich hier aus, raste auf dem Platz herum wie ein Verrückter, powerte mich aus und kam auch oft zum Abschluss. Fußball war für mich reiner Stressabbau. Der beste Stürmer war ich nicht, lag aber an zweiter oder dritter Stelle. Unter der Dusche kühlte ich schnell ab, beim geselligen Zusammensein anschließend war ich schon wieder zurückhaltend, fast zugeknöpft.
Eine unangenehme Situation ist mir noch in Erinnerung: Ich komme frisch geduscht aus der Umkleide. Der Trainer nimmt mich in den Arm, weil ich drei Tore geschossen habe, und sagt: »Klasse gemacht!« Dabei wuschelt er mir durch die Haare.
Ich drücke ihn weg und sage gereizt: »Lass das!«
»Pff…«, stößt der Trainer aus, »was bist du denn für einer?«
»Konnte so was noch nie leiden!«
Das war halt so. Ich mochte auf dem Platz auch nie dieses Aufeinanderhüpfen nach einem Tor.
Im Verein war es ähnlich wie mit den Kollegen. Ich war gut gelitten, gehörte aber irgendwie doch nicht ganz dazu. Niemand wurde so richtig warm mit mir, und das war mir recht so. Zu viel Nähe war mir noch nie geheuer.
Auch meine Eltern und Marie, meine ältere Schwester, merkten nichts von meinem neuen Reichtum. Zu allen dreien hatte ich ein distanziertes Verhältnis. Vater war ein linientreuer Apparatschik gewesen – was hatte der mir zugesetzt mit seinen ewigen Vorträgen über den heiligen Kommunismus und den dekadenten Westen. China sei unser Bruderland.
In Geografie interessierte mich dieses Riesenreich erheblich. Die Gesellschaftsform allerdings war mir reichlich schnuppe. Viel erfuhren wir ja nicht von der Zeit vor dem Sozialismus. Mehr wie Gerüchte tauchten manchmal Berichte über die vorhergehende Philosophie auf. Mein Buchhändler, der mich mit den Anatomie-Atlanten versorgte, lieh mir einmal ein Werk über Laotse. Es war seine Biografie, die mich faszinierte. Leider fanden sich nur Andeutungen zu seinem geistigen Schaffen. Vertiefendes Material zu beschaffen, dazu sah sich nicht einmal der Mann an der Quelle in der Lage.
Wie ein geprügelter Hund litt mein Vater nach der Wende. Das Arbeitslosengeld und danach die Arbeitslosenhilfe waren eine Schmach für ihn. Wie es ihm wohl in der DDR ergangen wäre, falls er seinen Job verloren hätte, wollte ich einmal von ihm wissen. Doch er verbat sich allein die Frage.
Auch vorher hatte er kaum mal eine meiner Kinderfragen beantwortet. Nicht nur die schienen ihn zu nerven, sondern Gefühlsäußerungen meinerseits ganz allgemein. Ob ich nun aus Freude umhersprang und jauchzte oder mal heulte aus körperlichem oder seelischemSchmerz heraus.
Auch bei Mutter und Schwester waren Emotionennicht wohlgelitten. So lernte ich, sie in mir zu behaltenund nicht nach außen dringen zu lassen.
Meine Mutter hatte irgendwo eine Platte von Milva aufgegabelt. Da gab es das Lied ›So was hilft‹, das dudelte sie den ganzen Tag:
Wenn ich sehr glücklich bin,
dann sag ich mir immer,
das kann nicht lang dauern.
Es wird schon irgendwo
der nächste Kummer lauern.
So was hilft.
Sofort.
Ohh, das hilft.
Wenn ich sehr traurig bin,
dann sage ich mir immer,
das kann nicht lang dauern.
Es wird schon irgendwo
die nächste Freude lauern.
So was hilft.
Sofort.
Ohh, das hilft.
Und Milva summte weiter, sie summte die Melodie auch in mein Herz. Nicht überschäumen, in beide Richtungen nicht.
Diese Haltung gab mir Schutz. Danke, Mama, und danke, Milva. Ihr habt mich zum Herrn über meine Gefühle gemacht. Damit bin ich immer gut gefahren. Diese Einstellung ersparte mir nicht nur Kummer und manch realitätsfernes Hochgefühl, sondern vor allem auch die Angst. Nein, Angst musste ich nicht haben.
Ich ergänzte Milvas Lied um eine weitere Strophe:
Wenn ich sehr ängstlich bin,
dann sage ich mir immer,
das kann nicht lang dauern.
Es wird schon irgendwo
die Überwindung lauern.
So was hilft.
Sofort.
Ohh, das hilft.
Hmm, h-hm, h-hm, hmm.
Vielleicht hätte ich auch Ärger damit wegsummen können. Doch so weit war ich noch nicht. Am wenigsten aber konnte ich meinem Vater verzeihen, dass er mir damals meine Bee-Gees- Platte zerbrochen hatte, den Saturday-Night-Fever-Soundtrack. Wie hatte ich Stayin’ Alive geliebt! Das war eine der ganz großen Kostbarkeiten gewesen, die ich mir damals neben den Biobüchern geleistet hatte.
Marie hatte mich einfach schon dadurch genervt, dass sie sieben Jahre älter war und immer auf mich aufpassen musste. Dazu hatte sie natürlich keine Lust und ließ ihren Frust an mir aus. Das Verhältnis hat sich nie gebessert.
Die engste Bindung hatte ich zu meiner Mutter, da war schon so etwas wie ein Nähegefühl. Ihr konnte ich allerdings nicht verzeihen, dass sie sich diesem Tyrannen von Ehemann dauerhaft unterordnete.
Es blieb also bei lockerem Kontakt. Bei Familienfesten war ich anwesend, hielt mich aber in Gesprächen zurück. Politische Themen waren sowieso tabu und interessierten mich nicht sonderlich. Es kamen nie besonders viele Leute zusammen, unsere Verwandtschaft war nicht groß. Mutter hatte einen Bruder, den Onkel Helmut, Vater einen Bruder und eine Schwester. Zu denen bestand aber kaum Kontakt. Sie kamen nur zu runden Geburtstagen und blieben nie lange. Am meisten interessierte mich noch Onkel Helmut. Ich wusste, er sammelte Münzen. Und Geld, das hatte mich schon interessiert, so lang ich mich erinnern kann. Mutter sagte einmal, wenn ich ›Mama‹ gesagt hätte, habe das fast wie ›Mark‹ geklungen.
Onkel Helmut hatte mir ein paarmal stolz seine Sammlung gezeigt. Mich hatten diese runden Scheibchen mit den geheimnisvollen Bildern und Zeichen darauf und einem Wert, den ich nicht abschätzen konnte, enorm beeindruckt. Doch ich durfte keine dieser Münzen anfassen, sie nur in ihren Plastiktaschen betrachten. Nicht einmal der Onkel selbst nahm sie heraus. Sie könnten leiden, meinte er. Wie soll denn ein Metallstück leiden, hatte ich mich gefragt. Aber dadurch verlor ich recht schnell das Interesse an der Münzsammlung und damit auch an Onkel Helmut. Denn mit einem kleinen Jungen konnte auch er nichts anfangen.
Zumindest war er schuld an meinem zweiten Vornamen. Meine Eltern hatte er überredet, wenn sie mich schon Edgar nennen würden, noch Allan zuzufügen. Ich glaube nicht, dass sie wussten, dass er Poe-Fanatiker war. Meinen Vater habe ich sowieso nie etwas anderes als Soldaten-Schundromane lesen gesehen.
Ein bisschen von der Leidenschaft flammte erst wieder auf, als der Euro eingeführt wurde. Da legte ich mir ein Album an und war bemüht, alle Münzen von jedem beteiligten Land zusammenzubekommen. Selbstverständlich rührte ich mein Starterpaket nicht an, sondern bewahrte es auf wie eine Kostbarkeit.
Von meinem neuen Reichtum bekam die Familie also nichts mit. Nur Mutter fiel aus allen Wolken, als ich ihr zum Sechzigsten eine echte Perlenkette schenkte. Ungläubig starrte sie darauf. Zur Erklärung sagte ich: »Ja, Mams, da habe ich lange drauf gespart.« Sie fiel mir um den Hals. Ich stand steif da, freute mich über ihre Freude, blieb aber verkrampft. Vater, der alte Sturkopf, starrte misstrauisch auf die Kette. Er hatte wahrscheinlich niemals solchen Erfolg mit seinen Geschenken. Hoffentlich erkundigte er sich nicht nach dem Preis.
Also, ich hatte schon meinen Spaß an dem neuen Leben, auch wenn es weitgehend das alte blieb. Aber diese Unbeschwertheit, das war schon etwas ganz, ganz Tolles. Ich musste mir ein neues Konto anlegen. Sie hatten mich schon komisch angeguckt in diesem Uhrenladen, als ich siebenunddreißig Fünfhunderter hinblätterte. Als wäre das die Beute aus einem Banküberfall. Nun, so etwas in der Art war es ja auch.
Bei Audi blieb dem Händler fast der Mund offen stehen, als ch von Barzahlung sprach. Das sei doch ein Scherz, entschärfte ich sein Misstrauen. Ich würde eine Anzahlung überweisen und nach der Überführung den Rest. Was hätten sie wohl gesagt, wenn ich den A8 L W12 genommen hätte? Da ist man mit Zubehör schnell bei zweihunderttausend. Aber das verbot mir schon meine Strategie: nicht von allem das Maximum! Eine Uhr von A. Lange & Söhne – und keine Rolex. Audi, nicht Mercedes, und da nicht den teuersten.
Mit dem Konto gab es ein unvermutetes Problem. Ich konnte schlecht hingehen und alle paar Tage einige Zehntausender einzahlen. Dem Bankangestellten wollte ich nicht erzählen, dass ich einfach Glück beim Spiel hätte. Ich überlegte, womit ich in wenigen Tagen plausibel so viel Bares verdienen konnte. Weihnachten wäre das gegangen, ich hätte mich als Christbaumverkäufer ausgeben können. Die machen im November und Dezember immer einen riesigen Umsatz. Nun war nicht immer Weihnachten. Aber irgendetwas mit Verkauf war wirklich das Beste.
Beim Ordnungsamt beantragte ich einen Reisegewerbeschein und eröffnete damit ein Geschäftskonto. Ich handelte vorgeblich auf Flohmärkten mit orientalischem Billigschmuck, der mir weggehe wie warme Semmeln.
Ferner stockte ich meinen Bausparvertrag ordentlich auf und kaufte ein paar Chemie-Aktien – die hatten die letzten Krisen immer am besten überstanden. Ich speiste in den Carmignac-Patrimoine-Aktienfonds ein und schloss eine private Rentenversicherung ab. Alles geordnet, alles gelistet und verwaltet. Ich erfreute mich an den Zahlenkolonnen und ihrem Zuwachs.
Was sollte mir noch passieren?
Das fragte ich mich damals. Wie naiv war ich eigentlich?
Probleme hatte ich mit Frauen. Kontakte hatten nie gut geklappt, schüchtern und verklemmt, wie ich anfangs war. In der Schule und beim MSV lockten mich die Mädels. Gerne schaute ich den Turnerinnen-Riegen zu, wenn wir uns in der Halle aufwärmten.
Noch spannender wurde es, als die Cheerleader-Abteilung gegründet wurde. Ich bändelte immer wieder mal an. Zu einer richtigen Beziehung kam es trotzdem nie. Bald hatte ich zu mäkeln, war unzufrieden mit Körper, Charakter oder beidem. Meist war es die zu große Lässigkeit bei Verabredungen oder beim Ordnunghalten, die mich störte. Die wenigsten konnten mit Geld umgehen, und wenn sie meine Tipps ablehnten, bekam ich schlechte Laune, sagte aber nichts.
Was hätte ich meiner jeweiligen Freundin auch sagen sollen?
Dass mir ihre Haare nicht mehr gefielen?
Dass es mir im Bett zu langsam mit ihr ging oder zu schnell?
Dass sie zu unordentlich war oder zu unpünktlich?
Ich hätte sie mir damit zur Feindin gemacht, wie im Laden die Kollegen. Meine Launen konnte ich trotzdem nicht verbergen, wurde gereizt und mürrisch. Das hielt keine Frau länger als ein halbes Jahr aus. Ich hatte hochgesteckte Erwartungen, Wunschträume – die Ideale lagen so hoch, dass die passende Frau für mich kaum zu finden war.
Ich suchte eine Prinzessin, war aber selbst kein Prinz. Wenn ich nach dem Duschen in den Spiegel schaute, blickte mich ein eher finsterer Bursche an. Dunkle, wellige Haare, die die Ohren verdeckten, und der schwarze Schnäuzer gaben dem Gesicht etwas Kastenförmiges. Tiefliegende Augen wurden durch riesige Brauen verschattet, sie funkelten mir heimtückisch aus dem Dunkel entgegen. Fehlende Symmetrie verstärkte das Unheimliche – die linke Stirnseite war wuchtiger und drückte das Auge etwas herunter. Der kleine Mund strahlte wenig Freude aus, die ganze Erscheinung wirkte viel zu ernst.
›Werde locker!‹, mochte ich mir zurufen. Doch wie sollte ich das bewerkstelligen?
Aber keine Angst: Entstellt wie ein Monster sah ich trotzdem nicht aus. Doch die Ungleichförmigkeit in meinem Gesicht war nicht zu übersehen. Sie wurde noch verstärkt durch meine Nase, die leicht nach links abwich.
Der Mann dort gegenüber, der hatte aber zumindest eine passable Figur. Kein Herkules, doch auch kein Schwächling. Ein Mittdreißiger mit allenfalls einer Spur Bauchansatz. Die Gestalt, die gab mir Selbstbewusstsein, auf die war ich durchaus ein bisschen stolz. Doch sie allein hielt keine Frau bei mir.
Wenn ich meine Einsamkeit nicht mehr aushielt, verschaffte ich mir Erleichterung im Rotlichtmilieu, wie man so sagt. Aber das war nicht richtig befriedigend. Alles viel zu kurz, viel zu mechanisch. Noch dazu war ich immer so aufgeregt, dass es oft nicht klappte.
Das war jetzt anders. Ich sah mir im Internet Anzeigen der Rubrik ›Herzklopfen‹ an, nahm Kontakt auf, probierte aus und fand schließlich die Frau, die mir erotisch zusagte, die mir keinen Stress machte, bei der ich mir die Zeit lassen konnte, die ich brauchte. Denn gerade hier ist die Zeit ja Geld. Geld war da und damit die Zeit.
Rita war für mich da, wann immer ich sie brauchte, und nie hat sie gefragt, wie ich zu meinem Geld käme.
Mein neues Leben hatte sich eingependelt, die Aufregung hatte sich gelegt. Casinobesuche, Einkäufe, Geldanlagen – all das war Routine. Die Bank schaffte sich einen Automaten an, mit dem man Bargeld einzahlen konnte. Das kam mir sehr entgegen, brauchte ich doch nicht mehr persönlich zum Schalter zu gehen. So konnte es ewig weitergehen – aber wollte ich das denn? Routine wird irgendwann langweilig. Was wollte, was sollte ich aus mir und meinem Leben machen?
Ruckzuck musste ich keine Entscheidung treffen, konnte mir aber auch nicht ewig Zeit lassen. Der Jüngste war ich nicht mehr, es musste etwas geschehen.
Tiere habe ich immer geliebt. Mit dem Hund fing es an. Bello war vor mir da, in unserer Familie. Mit dem wuchs ich auf, verbrachte mit ihm die frühe Kindheit. Wie litt ich, als er beim Gehen wimmerte, immer steifer und immer dünner wurde. Was war das für ein Graus, als wir ihn einschläfern lassen mussten.
Mein erstes eigenes Tier war der Hamster Fipsi. Den fraß bald der Bello – meine Eltern sagten mir, er sei weggelaufen. Dann kam Arthur, ein Zwergkaninchen, das konnte ich richtig knuddeln. Und es war so zutraulich, dass man es kaum glauben konnte. Arthur war der Trost, wenn es Ärger gab – mit Eltern, Marie, den Lehrern oder Freunden.
Freunde hatte ich nicht viele. Nur einen komischen Kauz, den Ixo. Wahrscheinlich weil ich genauso komisch war. Wir beiden Käuze, wir kamen miteinander klar – aber uns trotzdem nicht zu nah.
Häufig machten wir Hausaufgaben miteinander, mal bei mir, mal bei ihm. Wir redeten kaum dabei, stellten nur gegenseitig Fragen, wenn wir nicht weiterkamen. Sportlich war Ixo nicht, aber ein treuer Kumpel. Wenn wir ein Spiel mit dem MSV 90 hatten, war er immer als Zuschauer dabei. Manchmal stellte er sich sogar beim Training an den Rand. Oft genug hatte ich ihn gefragt, ob er nicht einfach mal mitmachen wollte. Das sei ihm zu anstrengend, hatte er gemeint.
Vielleicht war Ixo deshalb so komisch, weil seine Eltern evangelisch waren. Die paar Christen, die es in der DDR noch gab, die wurden alle etwas schief angesehen. Und wenn man abgelehnt wird, dann benimmt man sich schnell etwas schrullig. Nicht dass viele Leute die Parteiideologie verinnerlicht gehabt hätten. Aber dass man an keinen Gott glauben müsse, das war allgemeiner Konsens, das war den meisten recht.
Ich war mir da nicht so sicher und fragte Ixo, ob er auch so was mache wie Beten.
»Klar, jeden Abend.«
»Und was betest du da so?«
»Es fängt immer an: Lieber Gott.«
»Wieso ist der lieb?« Dass ein Gott automatisch lieb sein sollte, das leuchtete mir nicht ein.
»Wir sind doch seine Geschöpfe, und das, was man erschaffen hat, das liebt man.«
»Und wenn man Mist gebaut hat?« Ixo schwieg erst mal. Ich legte nach. »Wenn ich eine Sandburg baue, und die wird nix, dann trete ich die doch wieder zusammen!«
»Gott baut aber keinen Mist, der ist ja schließlich allmächtig.«
Das ließ ich erst einmal gelten. Dann erklärte Ixo, dass er sich beim Beten bedanke, für sein Leben, für seine Gesundheit, für den schönen Tag.
»Und wenn der Tag nicht schön war?«
»Dann bitte ich darum, dass der nächste wieder schön wird.«
»Man kann also auch um etwas bitten?«
»Klar kann man das!« Das gefiel mir, darüber erkundigte ich mich etwas genauer. Ixo regte an, ich könne es doch einfach mal probieren. Wieso eigentlich nicht?
»Und am Schluss kommt ein ›Amen‹.« Das verstand ich nicht ganz, aber Ixo konnte mir die Bedeutung auch nicht erklären.
Am Abend probierte ich es aus. Tat innerlich so, als glaubte ich ganz fest an den evangelischen Gott.
»Lieber Gott«, begann ich. »Schenke mir doch bitte ein Taschenmesser. Amen.« Das war kurz und bündig und eindeutig.
Nach der Schule übergab mir meine Mutter tags drauf ein Taschenmesser, einfach so. Nicht zum Geburtstag, nicht zu Weihnachten. Komisch, Weihnachten feierten wir schließlich immer noch. Verblüfft hielt ich das Messer in der Hand, probierte die Klingen aus und konnte es kaum fassen.
»Ich höre ja gar nichts«, sagte Mutter. Ich wusste erst nicht, was sie meinte. Wie aus der Versenkung heraus dämmerte mir, dass ich mich ja bedanken musste. Doch eigentlich hätte ich mich ja beim lieben Gott bedanken müssen.
»Danke, Mama«, sagte ich, strahlte und ging auf mein Zimmer. An einem alten Holzstück musste ich sofort ausprobieren, was das Messer taugte.
»Lieber Gott, vielen Dank für das Taschenmesser.« Bei ihm bedankte ich mich auch. »Und bitte, lass mich in der nächsten Russischarbeit eine Drei schreiben. Amen.«
Daraus wurde nichts. Ich bekam eine Fünf minus. Ich beschwerte mich bei Ixo. Vor allem, wo ich doch sehr bescheiden um eine Drei gebeten hatte und nicht um eine Eins.
»So leicht kannst du dir das nicht machen. Man muss schon selbst was tun!«
Also war der ganze Gottglaube doch recht kompliziert. Viel klarer wurde der durch meine Besuche in der Kirche allerdings nicht. Ixo hatte mich ein paarmal mitgenommen. Meine Sünden sollten weg sein, weil Christus an ein Kreuz genagelt worden war. Ich sollte mit ihm in Verbindung stehen, indem ich symbolisch seinen Leib aß und sein Blut trank. Das alles kam mir sehr merkwürdig vor. Aber das Mystische daran gefiel mir schon, es hatte etwas Anziehendes.
Ein paar Jahre später fragte ich Ixo, ich glaube, nach seiner Konfirmation war das, ob er denn wirklich an diesen Gott und das ganze Drumherum glaube. Biologie war damals schon mein Lieblingsfach. Darwins Evolutionstheorie hatte mir eingeleuchtet. Und trotzdem hegte ich meine Zweifel, ob die ganze Entwicklung sämtlicher Lebewesen nur eine Abfolge millionenfacher Zufälle war, ob es dahinter nicht doch ein ordnendes Prinzip gab, eines, das so etwas wie ein Gott sein konnte.
»So, wie wir das aus der Bibel gelehrt bekommen, so glaube ich das nicht«, erklärte mir mein Freund. »Doch dass es ein göttliches Prinzip gibt, davon bin ich überzeugt.« Komisch, dass auch er den Begriff Prinzip gebrauchte. »Doch viel mehr halte ich von den Chinesen.«
Jetzt lachte ich ihn aus. Die seien doch genauso bescheuert wie das, was wir vom Kommunismus eingebläut bekämen. »Ich meine doch nicht die Mao-Bibel und so was«, entgegnete er. »Ich meine die alten Philosophen. Ganz besonders Laotse. Eigentlich kenne ich wirklich nur von ihm ein bisschen was.«
Ich blieb skeptisch. »Woher willst du denn etwas über Laotse wissen und so? Darüber werden wir nie etwas in der Schule erfahren, und darüber gibt’s auch keine Bücher. Wenigstens nicht bei uns.«
Jetzt zeigte Ixo mir einfach eine Reihe chinesischer Briefmarken. »Was meinst du, woher ich die habe?«
»Briefmarken sammelst du also? Na, die wirst du getauscht haben oder gekauft.«
»Nein, die habe ich von meinen Briefen aus Peking abgemacht!«
Nun war ich reichlich verblüfft. »Du bekommst Briefe aus Peking?« Ich wollte es kaum glauben.
Ixo hatte ein Faible für China. Dieses Riesenreich interessierte ihn brennend. Deshalb hatte er schon ein paar Jahre vorher angefangen, Radio Peking zu hören. Der Sender strahlte auf Langwelle regelmäßig Beiträge in Deutsch aus. Und die hörte er begeistert. Irgendwann schrieb er einen Hörerbrief, denn dazu wurde immer wieder aufgefordert. Ein Brief nach China, etwas vollkommen Exotisches! Und tatsächlich, drei Wochen später hatte er eine Antwort von dem chinesischen Reporter. Die erste chinesische Briefmarke. Stolz zeigte mir Ixo, welche es war.
Von da ab entwickelte sich eine regelmäßige Korrespondenz zwischen den beiden. Vorsichtig fragte Ixo nach den alten chinesischen Philosophen und erhielt reichlich Informationen.
Ich blieb skeptisch. »Du fragst, und dein Chinese antwortet. Einfach so. So ein Brief kommt doch nie durch die Zensur. Bei uns nicht und bei denen nicht.«
»Chinesen sind ein kluges Volk«, kam die Entgegnung. »Natür