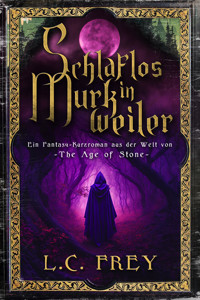4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DarkWing Publishing
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Die Reisenden erreichen ihr Ziel. Der Kreis schließt sich. Und die Welt endet. Heute // Hier. Professor Chomskys Probleme nehmen neue Dimensionen an, als die Welt auf ihr Ende zutaumelt. Sarah Barrett hat einen ungewöhnlichen, nächtlichen Besucher. Morrow erfährt endlich, wer sie ist und was alles zu bedeuten hat, und sie muss eine schwierige Entscheidung treffen. Doch dazu muss sie zunächst lernen, Wahrheit von Lüge zu unterscheiden, und Freund von Feind. Heute // Dort. Ein zynischer Fremder taucht vor den Toren von Morgans Burg auf und fordert den König zu einem Duell auf Leben und Tod heraus. H. H. Holmes sieht sich endlich am Ziel seiner monströsen Pläne und schart seine Getreuen um sich - für den finalen Angriff auf die Realität, wie wir sie kennen. Ein letztes Mal brechen Morrow und der Junge auf, denn hier beginnt der letzte Abschnitt ihrer Reise durch die Riftwelt ... es beginnt die Mission Omega.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
MISSION OMEGA
DIE RIFTWELT-SAGA
L.C. FREY
Band 5
IMPRESSUM
Copyright © 2021 by L.C. Frey. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit schriftlicher Genehmigung von L.C. Frey. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Autors reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Lektorat: Anne Bräuer, Textbüro Bräuer, Frankfurt am Main, Layout und Satz: Ideekarree Leipzig. Umschlaggestaltung: L.C. Frey, unter Verwendung von ©Grand Failure, https://stock.adobe.com
2202.17.2138
www.Alex-Pohl.de
Die in diesem Roman beschriebenen Personen und Geschehnisse sind fiktiv. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen, Orten, Unternehmen und Produktmarken sind rein zufällig und keinesfalls beabsichtigt. Gleichwohl kommen in der Handlung dieses Buches Personen und Zusammenhänge von historischer Bedeutung vor. Der Autor bemüht sich, diese Fakten nach bestem Wissen respektvoll zu behandeln, sie werden jedoch im Kontext dieses Buches frei ausgelegt. Der Autor distanziert sich von einer historischen oder sonstigen Deutung von geschichtlichen und anderweitigen Ereignissen und Zusammenhängen.
Dieses Werk ist reine Fiktion.
Noch.
WAS BISHER GESCHAH
In unserer Welt des Jahres 2005 hockt Professor Chomksy im Neubau der Murnauer-Geheimlabore unter der Erde und ist mit seinem Latein am Ende.
Sarah Barretts Verlobter David Vaughn ist inzwischen ein Bestseller-Autor und schlachtet Verschwörungstheorien für seinen Erfolg aus, doch nie war er unglücklicher, denn er hat das Loch, das Sarahs Verschwinden bei dem Laborunfall in der Wüste in sein Herz riss, nie verwunden.
Der Junge beißt auf eine Nuss und erlangt eine Klarheit, auf die er lieber verzichtet hätte – die scheinbar friedliche Glaubensgemeinschaft der Kinder der Göttin stellt sich als eine verblendete Horde von Kannibalen heraus, doch es gibt noch weit schlimmere Charaktere in ihrer Mitte. Erneut müssen Morrow und der Junge in die Wüste fliehen, wo sie, vom Sandwurm verfolgt, in einen Sandsturm geraten – und im Auge des Orkans landen, wo die Zeit stillsteht.
Dort finden sie den alten Sloat, der sich selbst vergessen hat. Als es Morrow gelingt, den Bann zu lösen, beginnt die Zeit erneut, der Sandsturm erwacht zum Leben und der Sandwurm erfährt eine schreckliche Verwandlung. Er verletzt den Jungen gefährlich, und Morrow wacht am mittelalterlichen Hof des Königs Morgan auf, wo sie den kauzigen Zauberer Merlin und den eitlen Ritter Lancelot kennenlernt.
Holmes erreicht indes die Reste der »Kinder der Göttin« und erklärt sich kurzerhand zu deren neuem Gott, nachdem er dem Usurpator Adam eine Lektion erteilt, die diesen den Kopf kostet, und dem Fahrer Trigger ein leckeres Brathuhn einbringt.
Nachdem Morrow mehrere vergebliche Versuche unternimmt, nach dem Jungen zu suchen, entdeckt sie ein schreckliches Geheimnis, das König Morgan und der Ritter Lancelot den Bewohnern der Burg vorenthalten, und trifft endlich auf den roten Gott – einen gefangenen Wissenschaftler namens Nikola Tesla.
Der Junge erwacht im Kreise alter Bekannter – der Kinder, die einst wie er die Gefangenen von Onkel Ruggs waren – und er versteht nun, wo er hingehört.
Ein Drache, der Morrow seltsam bekannt vorkommt, greift die Burg an, und Merlin findet seinen Mut, sein Gedächtnis – und den Tod. Der Drache kann vernichtet werden, doch der Sieg schmeckt schal, denn auch die Barriere, die die Burg schützte, ist nun verschwunden.
Mister Sloat geht heim, und Morrow und der Junge brechen ein letztes Mal auf, denn hier beginnt der letzte Abschnitt ihrer Reise durch die Riftwelt ... es beginnt die Mission Omega.
Karte der Riftwelt © Franz Alken
TEIL XXXV
2021 // HIER UND DORT
There is no God, no universe, no human race, no earthly life, no heaven, no hell. It is all a dream – a grotesque and foolish dream. Nothing exists but you. And you are but a thought – a vagrant thought, a useless thought, a homeless thought, wandering forlorn among the empty eternities.
- Mark Twain, Stranger Nr. 44
1
HEUTE // HIER
NEUBAU DES MURNAUER LABORKOMPLEXES
Sarah lag in vollkommener Dunkelheit.
Seit Jahren, vielleicht schon immer, wer konnte das wissen? Dunkel war ihre Gegenwart, und dazwischen immer wieder das Dunkel der Erinnerung, einer fernen Erinnerung, die ihr doch stets wieder entglitt. Wie ein Traum, aus dem man gerade erst erwacht ist. Wie lange war das alles her?
Alles, aus dem ihr Denken jetzt noch zu bestehen schien, waren unwirkliche Traumfetzen, Reste eines fein gewobenen Spinnennetzes und jeden Tag wurden die Lücken darin größer, riss das Netz unter ihren Füßen weiter auf, bis sie eines nicht mehr all zu fernen Tages haltlos in die Tiefe stürzen würde. In eine Zukunft, die genauso schwarz und ungewiss war wie ihre Vergangenheit.
Wie lange noch?
Das, was sie ihr über die Vergangenheit erzählt hatten, war zutiefst verstörend gewesen, aber vermutlich wahr. Wahr wie die anderen Bilder, die sie im Traum sah, oder wenn sie ohnmächtig wurde, und das wurde sie oft in letzter Zeit. Jetzt kam sie zu sich, spürte die Schläuche, die sie in ihren Körper hineingesteckt hatten, um sie am Leben zu erhalten. Kabel, die mit kleinen Klebepads an der Haut ihrer Arme, der Brust und dem Kopf befestigt waren. Ein endlos verlängerter Zustand des Hinübergleitens, und doch unaufhaltsam seiner Natur nach, gleich einem schwarzen Loch, das alles in sich hineinzieht, bis es am Ende die Zeit selbst verschlingt.
Hatte sie geschlafen?
Ja, sie musste geschlafen haben und es musste Nacht sein, denn die Dunkelheit blieb, als sie die Augen aufschlug. Sie hatte wieder von dem Jungen geträumt, jenem grotesken Wesen, welches die letzte der ›Botschafterinnen‹ begleitet hatte. Grotesk und abstoßend – oder das war zumindest, was sie empfinden sollte bei so einem Anblick. Allein, irgendetwas an dieser deformierten Gestalt erfüllte ihr Herz gleichermaßen mit Schmerz und Sehnsucht.
Und ... Liebe?
Irgendetwas Reines und Klares war im Geist dieser Kreatur, eine Ehrlichkeit jenseits aller Tücke und Hinterlist, trotz allem, das sie ihn hatte tun sehen. Vielleicht war es die unbefleckte Gegenwart eines Geistes, der keine Reue kannte, und nicht die fadenscheinige Moral, aus der andere sich die Begriffe von Gut und Böse bastelten. Ein Wesen, das lediglich seinem Instinkt folgt, und daher unschuldig ist, und rein.
Doch nun hatte sie auch den Kontakt zu der Kreatur verloren, die Bilder von ihm waren schon seit über einer Woche ausgeblieben, und sie befürchtete, dass sie nie zu ihr zurückkehren würden. Das letzte Bild, das sie empfangen hatte, war schrecklich gewesen.
Ein Untier, ein Monster, groß wie ein Haus, der massige, wurmartige Leib mit blasser, schorfiger Haut bedeckt, auf der sich unzählige Geschwüre tummelten, und Fangarme wie bei einem Tintenfisch, und ein schreckliches viergeteiltes Maul, die groteske Nachbildung eines Kleeblatts, weit aufgerissen, um den monströsen Jungen zu verschlingen. Flügel und Zähne. Riesenhafte Zähne, die sich in den Leib des Jungen gebohrt hatten.
Und dann nichts mehr.
Langsam gewöhnten sich ihre Augen an das spärliche Licht in dem Zimmer, das hauptsächlich von den matt glimmenden Anzeigen der medizinischen Geräte herrührte. Die Monitore hatten sich selbstständig abgeschaltet, aber sie würden sofort wieder zum Leben erwachen, wenn ihre Atmung oder ihr Herzschlag sich außerhalb der vorgegebenen Parameter zu bewegen begannen.
Eine schmale Grenze.
Eine Veränderung würde kommen, das war unausweichlich. Sie hatte es gespürt, lange bevor Chomsky ihr seine Ergebnisse dargelegt hatte. Jahre der Forschung, Unsummen an Geldern und menschlichen Kapazitäten – mit welchem Ergebnis?
Eine Serie von Misserfolgen und verzweifelten neuen Versuchen, alle mit demselben niederschmetternden Ergebnis, und nun waren sie auch noch ihres letzten Probanden beraubt worden. Die Zeit würde nicht für weitere Versuche ausreichen. Die Zeit würde für überhaupt nichts mehr ausreichen, denn die Zeit war am Ende angelangt.
Und dabei sind wir mal zum Mond geflogen, dachte Sarah zusammenhanglos. Haben mit Goldplatten beklebte Raumschiffe ins All geschossen, weil wir glaubten, es würde uns etwas über die Ursprünge unserer Existenz verraten. Welche Narren wir doch waren! Unwissende Kinder mit teuren Spielzeugen, nicht mehr.
Und doch spürte sie die gewaltige Veränderung, unaufhaltsam und still. Jenseits des Greifbaren, zumindest im Moment noch. Jenseits dessen, das sie in Worte kleiden konnte, die ein Mensch wie Professor Chomsky je verstehen würde. Wie der Schatten eines Drachen, der sich über das Land gelegt hat, während die Bestie selbst noch im Schutz der Wolken dahingleitet, unaufhaltsam und immer hungrig.
Woher dieses Bild in ihrem Kopf nur wieder stammte?
Der Schmerz in Sarahs Schulter wurde stechend – auch das passierte mehrmals jede Nacht, obwohl die Ärzte ihre Muskeln und Sehnen mit Stromstößen trainierten, so gut es ging.
Stöhnend vor Schmerzen drehte sie sich auf ihre linke Seite, sorgsam darauf bedacht, die Kabel und Schläuche, die in ihrem Körper steckten, nicht herauszureißen. Ächzend hievte sie ihren Körper herum, bis der pulsierende Schmerz ein wenig nachließ.
Der Großteil des Schmerzes aber blieb.
Das war der Krebs, der in ihren Knochen wütete, bis er sie schließlich umbringen würde. Schon bald, und keine Minute zu früh. Auch diesen Kampf hatten Chomskys Leute auf groteske Weise und über jedes Maß hinausgezögert. Wie oft hatte sie sich schon gewünscht, dass sie sie einfach sterben lassen würden?
Der Sache ein Ende machen, für immer.
Dennoch hatte sie Chomsky nie darum gebeten, denn sie wusste, dass ihr Wunsch auf taube Ohren stoßen würde. Das einzige Ergebnis wäre vermutlich, dass man sie dann rund um die Uhr bewachen würde, und ihr damit jede Möglichkeit nahm, die Sache vielleicht doch noch selbst in die Hand zu nehmen, sollten die Schmerzen eines Tages wirklich zu unerträglich werden. Oder für den unwahrscheinlichen Fall, dass ihre Experimente zum Schluss doch noch erfolgreich sein würden.
Als Sarah die Füße erblickte, schrak sie zusammen.
Einer der Monitore sprang an, während die Maschine zwei piepsende Warntöne von sich gab.
Neben ihrem Bett stand jemand – eine schlanke, beinahe zierliche Gestalt.
Sarahs Blick löste sich von den schmutzverkrusteten, nackten Füßen und wanderte nach oben. Ihre trägen Gedanken ordneten sich nur langsam zu sinnvollen Mustern. Auch daran waren vermutlich die Medikamente schuld. Sie schloss die Augen, öffnete sie wieder. Die Gestalt stand immer noch da.
Ein Mädchen mit schmutzigen, blonden Haaren.
Als das Gerät hinter ihr ein drittes Piepen ausstieß (was unweigerlich die Nachtschwester alarmieren würde, wie sie wusste), hatte Sarahs Blick das Gesicht des Mädchens erreicht. Denn das war es, ein nacktes und völlig schmutzverkrustetes Mädchen von vielleicht vierzehn Jahren, das vor ihrem Bett stand, und außerdem offenbar völlig unter Schock. Ihre Augen blickten leer auf einen unsichtbaren Punkt in weiter Ferne. Ein dünner Blutstrom lief aus ihrer Nase und sie schwankte leicht.
Aber sie lebte noch.
Sarahs Hand war unbewusst zu der Fernbedienung gewandert, welche sich am Rahmen des Bettes befand. Da, wo sie sie jederzeit gut erreichen konnte. Sie drückte den Knopf, und als das Licht auf ihrem Nachttisch automatisch aufflammte, verschwand die Erscheinung nicht, sondern kniff die Augen zusammen und blinzelte Sarah an.
Kein Geist. Kein Traum.
Das Mädchen war echt.
Das Mädchen öffnete den Mund, und stammelte etwas Unverständliches, während es einen dünnen Arm nach Sarah ausstreckte und einen Schritt auf ihr Bett zutaumelte. Erst verstand Sarah nicht, was das Mädchen flüsterte, doch dann ergaben ihre Worte Sinn.
»Wo … wo bin ich?«
Kaum mehr als ein Wispern, ein Windhauch in der Stille des Krankenzimmers. Doch dann … Die Erkenntnis traf Sarah wie ein Blitzschlag.
Sie kannte dieses Mädchen.
Sie kannte es sehr gut, besser als jeder andere Mensch auf der Welt, denn sie war die Mutter dieses Mädchens – wenn sie es auch nicht geboren hatte.
Nummer Vierundvierzig war zurückgekehrt.
2
Es ist ein Sommertag. Sie sitzen im Garten hinter dem Haus und machen ein Barbecue. David hat ein saftig gegrilltes Steak auf die lange Grillgabel gespießt und jetzt hebt er es in die Höhe und wedelt ein bisschen damit herum. Er hat eine blau-weiß karierte Schürze um, auf der ›Küss den Koch!‹ steht.
»Jetzt oder sofort, Ladies«, ruft er, »sonst wird es noch schwarz wie Kohle!«
»Jetzt und sofort!«, ruft sie, dann steht sie auf und läuft mit dem Baby im Arm zu ihm hinüber.
»Hey, langsam, Prinzessin«, ruft David, als er sie in die Arme nimmt, dann gibt er der Kleinen einen Kuss auf die Stirn, die daraufhin fröhlich zu glucksen beginnt. Während David knusprig gebratene Steaks auf ihren Teller häuft, verblasst er und dann ist er ganz verschwunden. Der Grill steht noch da, die Holzkohle raucht, aber das brutzelnde Fleisch darauf verströmt keinen köstlichen Geruch mehr, es ist nur noch wie ein Bild von Fleisch.
Wie eine Erinnerung.
Während ihr halb bewusst wird, dass sie träumt, reißt der Himmel auf. Die Sonne ist jetzt kein orangerot glühender Ball mehr, sondern der gesamte Himmel erstrahl in einem blendenden Gleißen, das sich auf alles herabsenkt.
Das Mädchen dreht sich um, doch David bleibt verschwunden, und mit ihm der Grill und der Campingtisch und die kleine Bank, und der Garten und das ganze Haus. Stattdessen ist jetzt überall nur strahlend weißer Sand. Weiß wie Zähne in einem Schädel, weiß wie die verblichenen Gebeine von Toten in der Wüste. Eine tote Einöde, die sich bis zum Horizont erstreckt, und das Mädchen ist das einzige auf dieser gesamten weiten Ebene, das jetzt noch lebt.
Ein Fremdkörper im gleißenden Reich des ewigen Todes.
Da erwacht sie.
3
Langsam blinzelte Morrow sich zurück in die Realität. Oder in das, was sich vermutlich als die Realität herausstellen würde. Die Wüste war verschwunden, ebenso die ausgeblichenen Knochen, aber die gleißende Helligkeit war geblieben. Weiß war das Bett, in dem sie lag, und die Decke, unter der sie steckte. Weiß war die Zimmerdecke über ihr, und hell strahlte das Licht von der Decke des Zimmers.
Während Morrow noch versuchte, diese Eindrücke zu verarbeiten, fiel ihr plötzlich ein, was ihr an dieser Umgebung so seltsam fremd vorkam, nämlich: Die komplette Abwesenheit von Schmutz.
Soweit sie zurückdenken konnte, also bis etwa zu dem Zeitpunkt, da der Junge sie ins Leben zurückgepflegt hatte, war der Dreck so allgegenwärtig gewesen, das ihr dieser Umstand erst jetzt auffiel, wo er komplett fehlte. Sie nahm einen tiefen Atemzug.
Die Luft fühlte sich ein wenig abgestanden an, wie Luft, die ein bisschen zu lang in einem Raum ohne Fenster gewesen ist. Und diese Luft roch nach … etwas Scharfem, das Morrow an den Geruch von verschüttetem Gebrannten erinnerte, und auch wieder nicht.
Sie schaute sich um. Soweit sie erkennen konnte, hatte der Raum tatsächlich kein Fenster, eine Reihe Deckenstrahler war die einzige Lichtquelle – diese genügten allerdings, um den Raum in taghelles Licht zu tauchen. An der Wand ihr gegenüber befand sich ein großer Spiegel, und als Morrow den Kopf drehte, um hineinzublicken, bemerkte sie einen stechenden Schmerz in ihrem Unterarm, und ließ den Versuch bleiben. Als sie versuchte, ihren Arm mit der Hand des anderen anzufassen, um herauszufinden, was das Stechen gewesen war, stellte sie fest, dass sie das nicht konnte. Ihre Handgelenke waren von weichen, aber nichtsdestotrotz unnachgiebigen Fesseln umschlossen, die vermutlich mit dem Rahmen des Bettgestells verbunden waren. Ohne all zu große Hoffnung probierte sie, ihre Füße zu bewegen, aber da war es genau dasselbe.
Sie war an das Bett gefesselt.
Sie drehte den Kopf in die entgegengesetzte Richtung. Da stand ein Gestell, an dem ein Beutel mit einer klaren Flüssigkeit hing, von dem ein durchsichtiger Schlauch abging und dann aus Morrows Sichtfeld verschwand. Von irgendwo hinter sich vernahm sie das leise Surren elektrischer Apparate.
Ja, dachte sie, so muss es heißen: Elektrisch, nicht Ek’troisch. Ein weiteres Bruchstück ihrer Erinnerung war zurückgekehrt, von jenseits des Schleiers, der ihre Erinnerung begrenzte. Elektrische Geräte, ja. Damit überwachen sie einen, und der durchsichtige Beutel heißt Tropf, und das andere Ende des Schlauches stecken sie einem in den Arm, damit … Morrow stöhnte auf, als die Erinnerung wie ein Wasserfall auf sie einprasselte. Bruchstück um Bruchstück, die von ihrem Geist angezogen wurden wie Eisenfeilspäne von einem Magneten.
Es kam zurück, es kam alles zurück.
Morrow drückte ihren Kopf in das weiche Kissen und presste die Augenlider aufeinander, als ob das die Flut der Erinnerungen zurückhalten oder wenigstens eindämmen würde, was es natürlich nicht tat.
Dann hörte es auf, so plötzlich, wie es begonnen hatte.
In dem Moment begriff Morrow, dass sie nicht mehr im roten Turm war, und auch nicht in der Burg namens Wardenclyffe. Das hier war ein …
Die Tür ging auf, was Morrow zwar nicht sehen, aber hören konnte. Eine Frau (und auch das hörte Morrow) bewegte sich in schnellem Laufschritt durch das Zimmer auf ihr Bett zu, und als sie über ihr stand, blickte Morrow in ein Paar erstaunt aufgerissener Augen.
»O mein Gott«, flüsterte die Frau. »Sie ist wach!«
Dann hastete sie wieder davon.
Ihre Kleidung, fiel Morrow auf, war genauso weiß gewesen wie das Zimmer und die Bettdecke und das Licht der Strahler. Und das war nur logisch, denn die Frau war eine … Das Wort lag Morrow auf der Zunge, aber dann kam sie doch nicht darauf. … irgendwas mit einer Schwester, obwohl sich Morrow ziemlich sicher war, dass die Frau ein bisschen zu alt dafür war, dass sie Geschwister sein konnten. Aber hatten nicht auch die Kinder der Göttin sich gegenseitig mit Bruder und Schwester angesprochen?
Kurze Zeit später öffnete sich die Tür erneut, und diesmal waren es die Schritte eines Mannes, die sich Morrows Bett näherten. Der Mann hatte schlohweißes Haar, das ihm bis auf die Schultern fiel, und trug einen ebenfalls schlohweißen Bart in einem faltigen, abgespannten Gesicht.
Seine Augen blickten Morrow durch die runden Gläser einer stahlgerahmten Brille an. In ihnen lag weniger Überraschung als professionelles Interesse. Doch Morrow, die seit dem Beginn ihrer Reise eine Menge über Augen gelernt hatte, erkannte auch die Sorge und die tiefe Verzweiflung, die am Grunde dieser Augen lag, wie ein Unglücklicher, der in einen Brunnen gestürzt ist. Doch vor allem sah sie den Ausdruck einer stillen Hoffnung, als diese Augen sie musterten.
»Du bist tatsächlich wach«, sagte der Mann und sein Mund verzog sich zu einem schiefen Grinsen, das erkennen ließ, dass sein Träger in dieser Art von Gesichtsausdruck nicht all zu viel Übung hatte. »Willkommen zurück, NummerVierundvierzig!«, sagte er. »Willkommen zu Hause.«
Morrow öffnete den Mund, um etwas zu sagen, doch es kam nichts dabei heraus. Ihr Gesichtsfeld verschwamm zu einem milchigen Schleier und etwas kitzelte auf ihren Wangen. Kaum hörbar krächzte sie: »Zu … zu Hause …?«
Dann sank sie zurück in die Schwärze.
4
Als sie das nächste Mal erwachte, stand die Schwester neben ihrem Bett und lächelte sie mitfühlend an.
»Wo bin …«, begann Morrow, doch dann brach ihre Stimme ab, heraus kam nur ein unverständliches Krächzen.
»Psscht!«, machte die Schwester und legte einen Finger auf die Lippen. »Du bist noch sehr schwach. Du solltest erstmal nicht sprechen, bis wir dich ein wenig aufgepäppelt haben, einverstanden?«
Morrow nickte langsam, zum Zeichen, dass sie verstand. Wenn es auch durchaus eine Menge Dinge gab, die sie noch immer kein bisschen verstand. Aber die Schwester hatte recht, ihre Kehle war wie ausgedörrt. Etwas Ruhe würde ihr vermutlich guttun.
»Sicher hast du Durst?«, fragte die Schwester, als hätte sie Morrows Gedanken gelesen. Und wer weiß, dachte Morrow, vielleicht hatte sie das ja? Die Schwester führte einen kleinen, durchsichtigen Plastikbecher an Morrows Lippen. Es war ein berauschendes Gefühl, als das köstlich kühle Nass die Lippen berührte und schließlich tröpfchenweise ihre Kehle hinabrann.
»Nicht so gierig«, sagte die Schwester lächelnd, »Trink immer nur kleine Schlucke, ja? Wir müssen deinen Körper erstmal wieder daran gewöhnen. Du bist immer noch sehr schwach.«
Morrow nickte, und diesmal schmerzte ihre Kehle nicht mehr ganz so sehr bei der Bewegung. Sie versuchte, die Arme zu bewegen und stellte fest, dass diese nicht länger mit Manschetten an das Bettgestell fixiert waren. Morrow zog einen Arm unter der Bettdecke hervor und betrachtete ihr Handgelenk. Dort, wo gelegentlich das rote Licht geblinkt hatte, war jetzt eine Narbe von einem Schnitt quer über die Innenseite ihres Handgelenks. Was immer sich unter der Haut befunden hatte, man hatte es offenbar herausgeschnitten.
»Ich …«, begann Morrow wieder, nachdem sie den Becher mit der kühlen Flüssigkeit ausgetrunken hatte, aber sie merkte schnell, dass ihre Stimme noch nicht für ganze Sätze ausreichte. »Hunger«, war alles, das sie herausbekam.
Die Schwester nickte begeistert. »Du bist hungrig? Das ist gut, ich werde sofort …«
In dem Moment öffnete sich die Tür, und Morrow richtete sich in ihrem Kopfkissen auf, um zu sehen, wer ihr neuer Besucher war. Es war der weißhaarige Mann mit dem Bart und der Brille.
»Doktor Chomsky«, sagte die Schwester, »sie hat einen kleinen Becher Wasser getrunken. Und sie sagt, dass sie hungrig ist.«
»Ausgezeichnet«, sagte der Mann namens Chomsky und schenkte der Schwester ein abwesendes Lächeln, bevor er an Morrows Bett herantrat. Er holte einen kleinen Stoffbären hinter seinem Rücken hervor und hielt ihn ungeschickt für eine Weile in Morrows Richtung. Die warf einen Blick auf das Plüschtier und sah den Mann dann fragend an.
Doktor Chomsky zuckte mit den Schultern und stellte den Bären dann auf den Nachttisch neben Morrows Bett. Dann setzte er sich auf den Stuhl, auf dem vorher die Schwester gesessen hatte.
»Ich werde ihr ein bisschen Flüssignahrung holen«, sagte diese, während der weißhaarige Mann Morrow schweigend in die Augen sah. Jetzt lächelte er nicht mehr. »Tun Sie das«, sagte er, und die Schwester verschwand aus dem Zimmer.
»Mein Name ist Doktor Chomsky«, sagte der Mann, obwohl Morrow das längst wusste.
»Morr … Morrow«, krächzte sie, was ihr Gegenüber mit einem erstaunten Gesichtsausdruck quittierte.
»Morrow, so so«, sagte er, und dann: »Die Schmerzen werden bald vergehen, und dann bist du in Nullkommanichts wieder auf den Beinen, Nummer Vierundvierzig.«
Morrow nickte, auch wenn sie keine Ahnung hatte, wieso der Mann sie Nummer Vierundvierzig nannte. Dann schob sie beide Arme unter der Bettdecke hervor und deutete auf die Narbe an ihrem Handgelenk.
»Der Induktor, ja«, sagte Chomsky, »wir haben ihn entfernt. Die Analyseabteilung beschäftigt sich gerade damit, die Aufzeichnungen auszuwerten. Aber vermutlich ist dir das ja ohnehin klar.«
In Morrows Augen schien er zu lesen, dass das nicht der Fall war, was er mit einem weiteren Schulterzucken beantwortete. »Verstehe«, sagte er dann, »Du weißt nicht, wo du hier bist oder wie du hergekommen bist?«
Morrow schüttelte den Kopf.
»Nun«, sagte Chomsky, »du bist in einem Krankenhaus. Und wir sind alle sehr daran interessiert, dass du schnell gesund wirst, um uns zu erzählen, was dir … was du erlebt hast, im … Drüben.«
Morrow versuchte erneut, den Mund zu öffnen, und der Mann sagte hastig: »Warte!«, dann griff er sich die Glaskaraffe vom Nachttisch und füllte den kleinen Becher wieder voll, bevor er ihn Morrow an die Lippen hielt. Sie trank und bemühte sich dabei vergeblich um disziplinierte, kleine Schlucke, wie die Schwester es ihr geraten hatte. Es brannte ein bisschen beim Schlucken, aber das ließ sich aushalten.
»Bin ich ... Zu … zu Hause?«, krächzte sie, als sie den Becher ausgetrunken hatte.
»Ja«, sagte Chomsky und nickte. »Du bist wieder zu Hause. Du warst lange fort, sehr lange. Aber vermutlich weißt du auch das nicht mehr.«
»Mommy?«, fragte Morrow, »und Daddy?«
»Ja«, sagte der Mann, »alles zu seiner Zeit. Erst musst du … erst habe ich ein paar Fragen an dich, und ich möchte nicht riskieren, dass du die Antworten vergisst, bevor du sie mir gegeben hast.«
Morrow sah ihn fragend an.
»Du vergisst manchmal Dinge, nicht wahr?«, fragte Chomsky und musterte sie mit einem eindringlichen Blick.
Morrow nickte.
Ja, sie vergaß manchmal Dinge, aber …
»Danach darfst du Mommy und Daddy sehen. Sobald du mir alles erzählt hast. Einverstanden?«
Morrow nickte erneut.
»Das Wichtigste zuerst«, sagte Chomsky, »Was ist das letzte, an das du dich erinnern kannst? Bevor du … nun ja, bevor du hier aufgewacht bist?«
Gute Frage, dachte Morrow und schloss die Augen, weil ihr das manchmal half, sich zu erinnern. Es war seltsam, jetzt, wo sie in diesem weißen Zimmer lag, kamen ihr die Rote Burg und Morgan und Merlin vor wie ein ferner Traum, oder wie die Erinnerung an einen Traum. Camelot, oder, wie Tesla es genannt hatte: Wardenclyffe. War sie wirklich dort gewesen? Hatte sie den Drachen gesehen, und Tesla, den elektrischen Gott, und Morgan und seine Runde der toten Ritter und …?
Dann begann sie zu sprechen, zunächst mit krächzender Stimme, sodass Chomsky sich tief hinabbeugen musste, um sie zu verstehen. Dabei machte er sich die ganze Zeit Notizen. Hin und wieder trank Morrow einen Schluck, ihre Stimme erholte sich zusehends. Sie erzählte Chomsky alles, woran sie sich erinnerte. Der Junge, und wie er sie aufgepäppelt hatte, und die Mickies in der Stadt, und der Sandwurm und der schwarze Mann, der hinter den Wolken geht, und ihnen durch die Wüste gefolgt war.
An dieser Stelle unterbrach sie Chomsky.
»Ein schwarzer Mann? Und was meinst du damit, dass er hinter den Wolken geht?«
»Ariadne hat diesen Ausdruck verwendet, und noch irgendjemand, aber ich erinnere mich nicht mehr genau, wer. Ich glaube, es heißt, dass der Mann sein wahres Gesicht verbirgt, und dass er sehr, sehr böse ist. Und sehr mächtig.«
»Hast du ihn gesehen?«, wollte Chomsky wissen.
»Nein«, flüsterte Morrow, »oder nicht richtig. In meinen Träumen, glaube ich. Und als ich kurz vor dem Verdursten war. Ich glaube, seine richtige Gestalt kennt niemand, aber er erscheint manchmal in einem schwarzen Anzug. In meinem Traum hatte er einen dicken Schnurrbart und trug einen seltsamen Hut auf dem Kopf, wie ein halber Ball.«
»Eine Melone?«, fragte Chomsky, und als Morrow nickte, schlich sich ein vages Entsetzen in seine Züge und er begann in seiner Tasche zu kramen. Nach einer Weile zog er ein flaches Gerät hervor (Cylla hätte es Toh-Ken genannt, oder Ek'troisch), und tippte darauf herum. Dann hielt er es Morrow hin. Das Display zeigte eine verschwommene Fotografie des Mannes, der Morrow so gern eine eiskalte Ko'hk verkauft hätte, und wer weiß, was noch …
Unter dem Bild stand:
H.H. Holmes, Chicago, ca. 1895
»Ja, das ist er«, sagte Morrow und sah dann schnell woanders hin. Chomsky brummte irgendetwas und steckte dann das Gerät weg.
Morrow erzählte ihm auch den ganzen Rest, und während sie das tat, spürte sie, dass der Mann recht gehabt hatte. Die Erinnerung an all das begann bereits zu verblassen wie ein Traum, der im Wüstenwind davongeweht wird. Den Rest der Geschichte hörte sich Chomsky mit unbewegter Miene an und es war Morrow schlicht unmöglich, herauszufinden, ob er ihr auch nur den kleinsten Teil davon glaubte.
Der Drache, welcher den Schutzschirm angegriffen hatte, obwohl er doch nur in der Einbildung existierte, welche Morgan in die Köpfe der Bewohner der Burg projiziert hatte, ein Zauberer namens Merlin und die seltsamen Metallröhren in dem Geheimraum unter der Krypta, all das notierte sich Chomsky mit gleichmütigem Gesichtsausdruck. Nur gelegentlich nickte oder brummte er leise, oder reichte Morrow den Becher mit dem Wasser, wenn sie ihn darum bat.
Erst als sie auf die Maschine zu sprechen kam, in die sie gestiegen war, nachdem sie ein letztes Mal mit Tesla gesprochen hatte, horchte er auf. »Er sagte mir«, krächzte Morrow, »das der Drache doch echt ist, und den Schutzschirm schwächt, den Morgan über die Stadt gelegt hat. Der Schirm … die Energie war beinahe aufgebraucht und der Drache war drauf und dran, hindurchzubrechen und …«
Morrow ließ sich in die Kissen sinken.
»Ich glaube, er hätte sie alle umgebracht. Jeden einzelnen Bewohner der Burg. Also stieg ich in die Maschine. Ich musste den Zeuss, also Mister Tesla, aus der Röhre herausholen. Er war … so glitschig von dem roten Zeug darin, und so … so schwach. Ganz dünn war er, als ob er nur noch aus Knochen bestünde. Und dann … dann bin ich selbst reingestiegen. Damit meine Energie … damit sie den Schutzschirm wieder erstarken lässt, weil ich … Morgan sagte, ich habe sehr viel Energie. Außergewöhnlich … viel … Energie, weil ich aus der alten Realität komme, die stabil ist und stark. Und ...«
Morrows Sichtfeld verschwamm erneut und sie fürchtete, wieder ohnmächtig zu werden. Chomsky packte sie an der Schulter und rüttelte sie sanft. Schließlich flogen ihre Lider flatternd wieder auf.
»Ich … habe ich sie gerettet?«, fragte Morrow, »Die Bewohner der Burg? Hat es funktioniert?«
»Das hat es ganz sicher«, sagte Chomsky bestimmt, aber ohne all zu großes Interesse. Seine Gedanken schienen bei ganz anderen Dingen als dem Schicksal der Bewohner der roten Stadt zu verweilen. »Was ist dann geschehen?«, fragte er, »Als du in die Maschine gestiegen bist und Telsa sie aktiviert hat?«
»Ich … da war … ich weiß nicht mehr genau«, flüsterte Morrow. »Ein Licht … ganz grell, wie ein Blitz … ein Bett, mit Schläuchen und Kabeln … ich dachte erst, ich wäre immer noch in dem Turm, aber das war keine der Röhren … es war ein Bett … so wie das hier.«
»Verstehe«, sagte Chomsky.
»Da war … eine Frau, glaube ich. Da war ein Bett, genau wie das hier, und eine Frau lag darin, die krank aussah und schwach. So wie ich selbst.«
»Du musst dich ausruhen«, sagte Chomsky und stand auf.
Morrow, die noch so viele Fragen hatte, streckte eine schwache Hand nach ihm aus, doch er trat einen kleinen Schritt zurück.
»Du wirst sicher viele Fragen haben«, sagte er und Morrow nickte, »Und du wirst Antworten darauf erhalten, ich verspreche es. Aber erstmal musst du richtig gesund werden.«
Morrows Hand hing für eine Weile zwischen ihnen wie ein Ende einer eingestürzten Brücke, dann öffnete sich die Tür und die Schwester bugsierte ein kleines Wägelchen herein, auf dem eine dampfende Schüssel stand. Morrows Magen krampfte sich sehnsuchtsvoll zusammen. Wie lange war es wohl her, seit sie etwas gegessen hatte?
Die Schwester warf erst Morrow und dann Chomsky einen strafenden Blick zu, doch der schien das gar nicht mitzubekommen.
»Du musst ganz schnell gesund werden, ja?«, sagte er, und dann nickte er der Schwester zu. »Behandeln Sie unseren Gast gut!«
»Natürlich«, sagte die Schwester, »ich …«
Aber da war Chomsky schon zur Tür hinaus.
5
Später an diesem Tag, den sie größtenteils schlafend verbrachte, erhielt Morrow noch einmal Besuch von Professor Chomsky. Diesmal wurde er von einem Mann begleitet, der im Gegensatz zu Chomsky keinen weißen Kittel trug.
»Hi«, sagte er und schenkte ihr ein strahlendes Lächeln. »Ich bin David Vaughn. Du kannst Dave zu mir sagen. Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen.«
»David …«, sagte sie, und spürte, wie ihr Herz wie wild zu klopfen begann. Auch Chomsky schien das zu bemerken, denn sein sorgenvoller Blick zuckte von dem Bildschirm am Kopfende ihres Bettes zu ihr. Erst da fiel Morrow auf, dass es das erste Mal war, dass sie jemand anlächelte, seit sie hier war. Und ihr fiel auf, dass sie diesen anderen Mann, David, sofort mochte. Vielmehr war ihr, als habe sie ihn schon immer gemocht. Aber wie konnte das sein? Waren sie sich schon einmal begegnet? Offenbar nicht, denn warum hätte der Mann sich ihr dann vorstellen sollen?
Er hielt ihr seine Rechte hin und sie ergriff sie, um sie zu schütteln, und dann lächelten sie sich beide für eine Weile an. Dabei entging ihr nicht Chomskys erschrockener Blick. Offenbar, weil David weder einen weißen Kittel noch Gummihandschuhe trug, während er sie berührte. Chomsky dagegen schien seine nie auszuziehen. Jedenfalls nicht, wenn er in ihrem Zimmer war.
Chomsky begann erneut damit, Morrow mit seinen Fragen zu löchern, und diesmal betrafen die hauptsächlich den roten Turm. Ob sie sich an die Anordnung der Zylinder erinnern könne, in denen Mister Tesla und die anderen gelegen hätten? Wie die Röhren genau beschaffen waren, welche Höhe der Turm in etwa gehabt hatte, und eine endlose Litanei ähnlicher Fragen mehr.
Für den Mann namens David, der hinter Chomsky still an einer Wand lehnte, interessierte Morrow sich allerdings viel mehr als für Chomskys endlose Fragerei. Er mochte in den Fünfzigern sein, doch seine Augen, die ständig verschmitzt zu lächeln schienen, ließen ihn deutlich jünger aussehen. Er trug ein dunkles Hemd, aus dessen Brusttasche die bunten Kappen verschiedener Stifte ragten, so als wolle er allzeit bereit sein, irgendetwas aufzuschreiben. Das imponierte Morrow auf unbestimmte Art. Das Haar des Mannes sah aus, als sei er soeben nach einer Nacht voll schwerer Träume aufgestanden oder vielmehr aus dem Bett gezerrt worden, widerspenstige, dunkle Locken standen in alle Richtungen ab. Und es schien ihn überhaupt nicht zu stören. Auch das mochte Morrow.
Seine braunen Augen blickten sie müde, aber aufmunternd an. Auch das, fiel Morrow auf, war ein erstes Mal, seit sie hier angekommen war. Chomsky und die Krankenschwester sahen öfter zu Boden oder auf ihre Geräte und Zettel, wenn ihnen Morrow bestimmte Fragen stellte. Wie zum Beispiel die, wann sie endlich ihre Eltern sehen würde.
Diese Feststellung versetzte Morrows Herz einen kleinen Stich, weil sie jetzt wieder an den Jungen denken musste. Sie konnte zwar nicht in die Herzen von Menschen schauen, so wie er, aber die gemeinsam durchlebten Strapazen hatten sie zu solch einer aufmerksamen Beobachterin gemacht, dass sie es beinahe konnte.
Der Mann namens David war in Ordnung, sagte ihr dieser Instinkt, und Chomsky war ein Typ, bei dem man besser aufpasste, was man sagte. Beide Männer schienen ein Gewicht mit sich herumzuschleppen, das sah man deutlich in ihren Augen, auch wenn es beide zu verbergen suchten, und irgendwie schien auch das mit ihr zusammen zu hängen.
»Okay«, sagte Chomsky, als sie dessen vorerst letzte Frage zu dem roten Turm beantwortet hatte. Der Arzt drehte sich zu David um und nickte ihm zu. Daraufhin stieß dieser sich seufzend von der Wand ab und trat an Morrows Bett.
»Darf ich?«, fragte er und deutete auf die Kante ihres Bettes.
Morrow nickte. Seltsam, dachte sie, Chomsky hatte immer eine gute Armlänge Abstand von ihr gehalten, als habe sie eine ansteckende Krankheit, und auch die Schwester trug stets weiße, eng anliegende Handschuhe, wenn sie im Zimmer war. David schien das egal zu sein. Er setzte sich einfach zu ihr.
»Es tut mir leid«, sagte er, »dass wir dich so quälen müssen.«
Morrow nickte und versuchte ein tapferes Lächeln.
»Sicher hast du auch jede Menge Fragen an uns«, sagte er und warf Chomsky einen kurzen Blick zu, den dieser ohne die geringste Regung erwiderte. »Es wird sich alles aufklären, das verspreche ich dir. Du bist jetzt zu Hause, du tapferes Mädchen, und hier bist du in guten Händen.«
»Dann ist jetzt alles gut?«, fragte Morrow. »Ich bin wirklich zu Hause?«
»Ja«, sagte Chomsky aus der Tiefe des Raumes. Morrow meinte, eine Spur von Ungeduld in seiner Stimme auszumachen.
David blickte sie weiter traurig an. Und dann, zu Morrows Verblüffung zuckten seine Augen kaum merklich von links nach rechts und wieder zurück. Die Bewegung war so minimal, dass Morrow sich nicht sicher war, ob er das wirklich gerade gemacht hatte. Wegen Chomsky, dachte Morrow, der sollte das nicht mitbekommen. David räusperte sich, und sagte dann: »Ich habe nur eine einzige Frage an dich, okay? Dann lasse ich dich in Ruhe. Einverstanden?«
Morrow nickte, aber sie wünschte sich durchaus nicht, dass David sie in Ruhe ließe. Sie wünschte sich, dieser Chomsky würde endlich aus dem Zimmer verschwinden und sie alleine lassen. Aber es sah nicht so aus, als würde dies in absehbarer Zeit geschehen.
»Also«, sagte David, »als du … drüben angekommen bist, oder vielmehr aufgewacht, da warst du in der Höhle dieses … Jungen, nicht wahr?«
Morrow nickte.
»Aber er sah nicht aus wie ein Junge, nicht? Nicht wie ein ... Mensch?«
Morrow schüttelte den Kopf. »Nein. Irgendwie ... eher wie ein Tier. Zumindest habe ich das am Anfang gedacht.«
Dave nickte. »Du hast dich anfangs vor ihm gefürchtet, weil er aussah wie ein …«
»Monster«, flüsterte Morrow und eine einzelne Träne löste sich von ihren Wimpern und begann, ihre Wange hinabzurollen. David zuckte zusammen und sein Gesicht verzog sich zu einem schmerzerfüllten Lächeln. Dann wischte er ihr die Träne mit dem Daumen von ihrer Wange, eine Geste voller Zärtlichkeit.
»Aber er war kein Monster«, fuhr er dann fort, »Er war dein Freund. Er hat dich beschützt, nicht wahr?«
Morrow nickte.
»Oh, du armes Kind, wenn ich nur …« Chomsky räusperte sich aus der Ecke, und Dave verstummte. »Also«, fuhr er dann fort, »Bevor der Junge dich in seine Höhle geschleppt hat, gibt es irgendetwas davor, an das du dich erinnern kannst? Wie du angekommen bist … da drüben?«
Wieder räusperte sich Chomsky, aber diesmal ignorierte Dave es.
»Da war ein Platz …«, flüsterte Morrow, »Und ein großes Haus, mit einem Kreuz, glaube ich …«
»Einem Kreuz?«, schnarrte Chomsky vom anderen Ende des Zimmers, als fände er das absolut unglaublich – wie vermutlich überhaupt den größten Teil von Morrows Erzählungen.
»Ja, auf dem Dach des Hauses«, erinnerte sich Morrow. »Aber es war kaputt, abgebrochen, und es hing ganz schief. Das Haus war auch kaputt, die Fenster … alle Scheiben waren eingeworfen, und …«
»Gut«, sagte Chomsky, »das könnte uns vielleicht weiterhelfen. Sonst noch was?«
»Ja«, sagte Morrow, und sammelte all ihre Kräfte, um mit fester Stimme zu sprechen, während sie über Davids Schulter zu Chomsky hinüberblickte, der einen Notizblock aus seiner Tasche gezogen hatte, und hastig darauf herumkritzelte. »Aber wann kann ich denn nun nach Hause?«
»Hm?«, sagte Chomsky und blickte von seinem Notizblock auf. Davids Hand fand die von Morrow und drückte sie leicht, aber nur für einen Augenblick. Dann stand David auf und drehte sich zu Chomsky um.
»Sie möchte wissen, wann Sie nach Hause gehen kann«, sagte er. »Und, Professor? Was meinen Sie, hm?«
»Oh«, sagte Chomsky und wurde knallrot, »Bald. Sicher ganz bald. Sobald es ihr besser geht.«
»Aber mir geht es …«, begann Morrow, doch in diesem Augenblick schnappte die Welt um sie herum aus den Angeln. Für den Bruchteil einer Sekunde war sie wieder in dem anderen Zimmer, das ihrem auf so verblüffende Weise ähnelte. Die Frau, ausgezehrt und hohlwangig in einem Bett, neben dem sie stand und … dann war es wieder vorbei.
»Was war das?«, fragte Chomsky, der sich jetzt über sie beugte. Als Morrow die Augen langsam wieder öffnete, blickte sie in blaue, weit aufgerissene Augen hinter einer Brille mit Stahlrahmen. Und diesmal blickten diese Augen ehrlich besorgt.
»Nichts …«, krächzte Morrow. Ihr Hals war wieder furchtbar trocken.
»Holen Sie ihr was zu Trinken, Dave«, befahl Chomsky, ohne den Blick von Morrows Gesicht abzuwenden.
»Nur ein bisschen Kopfschmerzen«, sagte Morrow, und zwang sich zu einem Lächeln.
Chomsky erhob sich und trat vor die Front der blinkenden Apparate hinter ihrem Bett. Er drückte auf ein paar Knöpfen herum und nach einer Weile brummte er etwas Unverständliches, scheinbar vorerst befriedigt. Inzwischen war David aus dem Badezimmer zurückgekehrt. In der Hand trug er einen Becher, den er offenbar mit Wasser gefüllt hatte.
Klares, sprudelndes Wasser, dachte Morrow, das aus einer seltsamen Röhre mitten in der Wüste aus dem Nichts kommt. Und das man nur finden kann, wenn man die Schrauben aus dem Metallturm vor sich auf den Boden wirft.