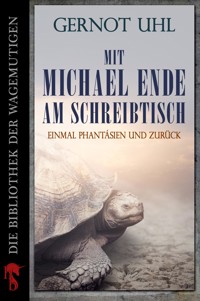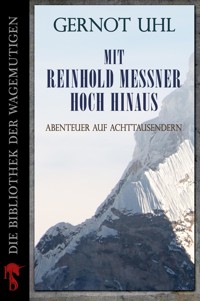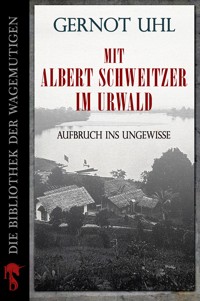
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks: e-book first
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
»Dieser Mann hat Weh in der rechten Keule.« Sprechstunde im Hühnerstall von Lambarene, mitten in Afrika. Der Urwalddoktor Albert Schweitzer nickt seinem Übersetzer dankbar zu. Der ist zwar gelernter Koch und spricht nur holprig die Sprache des weißen Medizinmanns, aber darauf kommt es im Urwaldkrankenhaus nicht an: Auch Albert Schweitzer, der jetzt sein Wundermittel anrührt – eine Salbe aus Schwefelpulver, Ölresten und Schmierseife –, ist kein geborener Tropenarzt. Eigentlich ist er Pfarrer, Wissenschaftler und europaweit gefeierter Musiker. Aber aus Überzeugung lässt er aussichtsreiche Karrieren an der Uni und an der Orgel sausen, um am Ende der Welt die Nachfolge Jesu anzutreten … Dieses E-Book aus der »Bibliothek der Wagemutigen« nimmt Sie mit in Albert Schweitzers Lebensgeschichte von gelebter Nächstenliebe: Streifen Sie mit dem Pfarrerssohn durch die idyllischen Weinberge in seiner elsässischen Heimat, begleiten Sie ihn die Kirchen und Hörsäle von Straßburg und brechen Sie mit ihm auf in den afrikanischen Urwald, wo Schweitzer nicht nur mit komplizierten Brüchen, Lepra und Malaria fertig werden muss, sondern auch mit zwei Weltkriegen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 136
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Gernot Uhl
Mit Albert Schweitzer im Urwald
Aufbruch ins Ungewisse
Die Bibliothek der Wagemutigen
Rebellische Künstler, furchtlose Freiheitskämpfer, kühne Sportler – Wagemut hat viele Gesichter. Starke Persönlichkeiten folgen nicht flüchtigen Trends, sondern inneren Überzeugungen. Leidenschaftlich, streitbar und risikobereit gehen die Helden dieser Reihe außergewöhnliche Lebenswege, auf denen nichts unmöglich ist. Erleben Sie unterhaltsam und spannend erzählte Lebensgeschichten voller Überzeugung: Wo ein Wille ist, ist auch ein Lebensweg. Die E-Books aus der Bibliothek der Wagemutigen führen Sie zu den dramatischen Schicksalsmomenten im Leben von Menschen, die Geschichte machen.
Die Entscheidung für Afrika
»Sie sollten doch wohl eher in der Psychiatrie vorsprechen!« Misstrauisch mustert Professor Hermann Fehling den jungen Mann mit dem zerzausten schwarzen Haarschopf und dem buschigen Oberlippenbart, der sich bei ihm gerade als Medizinstudent einschreiben will. Eigentlich wäre er dafür sogar an der richtigen Adresse. Professor Fehling, ein renommierter Frauenarzt und Geburtshelfer, ist Dekan der medizinischen Fakultät an der Universität Straßburg. Allerdings spricht da kein Abiturient bei ihm vor, sondern ein angehender Kollege. Albert Schweitzer ist Doktor der Philosophie und Doktor der Theologie. Als Direktor des Studienstifts St. Thomas bildet der umtriebige Schweitzer angehende Pfarrer aus. Fast jeden Sonntag predigt er selbst in der Straßburger St. Nicolai-Gemeinde, in erster Linie aus Freude am Gottesdienst, aber auch, weil er als Praxisanleiter nicht aus der Übung kommen will. Gewissermaßen nebenbei gibt Albert Schweitzer in halb Europa gefeierte Orgelkonzerte. Das Markenzeichen des Musikers Schweitzer ist seine einzigartige Interpretation der Werke von Johann Sebastian Bach. An der Universität lehrt er als Privatdozent der Theologie. In der Forschung hat er mit selbstbewussten Veröffentlichungen über den historischen Jesus und den Komponisten Bach bereits für einiges Aufsehen gesorgt, weil er sich mit seinen Büchern quer zum Mainstream stellt. Das sind nicht die schlechtesten Voraussetzungen für eine akademische Laufbahn. Aber Albert Schweitzer will gar nicht Professor werden. »Ich habe nicht mehr den Ehrgeiz, ein großer Gelehrter zu werden, sondern mehr – einfach ein Mensch«, schreibt Schweitzer an seine vertraute Freundin Helene. »Die Leute um mich herum verstehen mich nicht mehr, erst recht nicht, warum ich mich nicht um meine ›Karriere‹ als Professor kümmere! Als ob das mein Ziel wäre, die Karriere eines Professors! – Nein, ich will ›leben‹, mein Leben leben.«[1]
Der dröge Universitätsbetrieb, der Wettstreit um die besten und um die am besten vermarkteten Ideen und Erkenntnisse, das langsame Einstauben in muffigen akademischen Studierzimmern, das ist nicht die Welt von Albert Schweitzer. »Die Wissenschaft verblasst«, erklärt er Helene, »ich fühle nur noch eines: dass ich handeln will. Alles andere kommt mir vor wie eine Komödie.«[2]
Wie eine Komödie muss es dem armen Professor Fehling auch vorkommen, als ihm Schweitzer erklärt, warum er auf einmal Arzt werden will – denn medizinisch ist der Tausendsassa ein völlig unbeschriebenes Blatt. Professor Fehling hört staunend zu, was Schweitzer ruhig, aber entschlossen berichtet. Da habe eines Tages dieses grüne Heft auf seinem Schreibtisch im Studienstift gelegen: das Nachrichtenblättchen der Pariser Missionsgesellschaft. Zwar sei die Ausgabe schon ein paar Monate alt gewesen, aber er blättere nun einmal leidenschaftlich gerne in den Berichten über die gelebte Nächstenliebe herum. An diesem Herbsttag des Jahres 1904 habe ihn ein Artikel besonders berührt: »Was der Kongomission nottut«, sei da zu lesen gewesen und der Autor sei niemand Geringerer gewesen als Alfred Boegner selbst, der Direktor der Pariser Mission. Dann referiert Schweitzer, dass es offenbar an tatkräftigen Christenmenschen fehlt, die die frohe Botschaft Jesu’ nach Zentralafrika tragen. Vor allem aber brauche man dort Ärzte, um die leidenden und kranken Eingeborenen medizinisch versorgen zu können, die bei der Mission Hilfe suchten. Den Schlussappell des Artikels wiederholt Schweitzer aus dem Gedächtnis Wort für Wort: »Menschen, die auf den Wink des Meisters einfach mit: ›Herr ich mache mich auf den Weg‹ antworten, dieser bedarf der Kirche.«[3]
Professor Fehling beginnt zu ahnen, worauf Schweitzer hinauswill. Was er nicht weiß: Schweitzer ist selbst auf der Suche. Er sucht seit langem nach einem Weg, auf dem er seinem Lebenshelden Jesus nachfolgen kann. Von Kindesbeinen an beschäftigt ihn, dass er ein angenehmes und glückliches Leben führen darf, während so viele Menschen leiden müssen. »Immer klarer wurde mir, dass ich nicht das innerliche Recht habe, meine glückliche Jugend, meine Gesundheit und meine Arbeitskraft als etwas Selbstverständliches hinzunehmen«, denkt sich Schweitzer und zieht daraus eine schicksalsträchtige Konsequenz: »Aus dem tiefsten Glücksgefühl erwuchs mir nach und nach das Verständnis für das Wort Jesu, dass wir unser Leben nicht für uns behalten dürfen. Wer viel Schönes im Leben erhalten hat, muss entsprechend viel dafür hingeben.«[4]
Aus diesem Grund hatte sich Albert Schweitzer schon als junger Student einen Matchplan für das Spiel seines Lebens zurechtgelegt und beschlossen, sich bis zum Alter von dreißig Jahren in der Kunst des Orgelspiels und in der Welt der Wissenschaft auszutoben, um danach sein Leben ganz praktisch in den Dienst Christi zu stellen.[5] Ursprünglich hatte er sich diesen Dienst so vorgestellt, dass er als Theologieprofessor Waisenkinder bei sich aufzunehmen würde.[6] Schweitzer hatte sogar schon beim Leiter des städtischen Sozialamts vorgesprochen, einem gewissen Dr. Rudolf Schwander, und sich angeboten.[7] Aber ihn hatte man mit dieser Idee gar nicht ernst genommen: ein alleinstehender Mann soll Kinder erziehen? Das ist an der Jahrhundertwende noch undenkbar. Untröstlich und enttäuscht hatte Schweitzer an Helene schreiben: »Alles ist gescheitert! Ich habe umsonst gesucht. Entweder gibt es die Kinder nicht, oder will man sie mir nicht geben und hält meinen Plan für Phantasterei.«[8] Doch schon beim Schreiben war der dickköpfige Trotz gegen die biederen Gewohnheiten und die gesellschaftlichen Rollenbilder in ihm erwacht: »Ich will mich aus diesem bürgerlichen Leben befreien, das alles in mir töten würde, ich will leben, als Jünger Jesu etwas tun. Aber die Leute lassen ja nicht zu, dass man aus dem Gewöhnlichen heraustritt, dass man sich aus seinen natürlichen Bindungen löst. Ja, aber ich würde darin zugrunde gehen. Ich muss mich daraus lösen.«[9]
Deshalb hatte Schweitzer die vorerst gescheiterte Suche rasch wieder aufgenommen – und tatsächlich: Jetzt, da er 29 Jahre alt ist, findet sie doch noch ein glückliches Ende: Jesus ruft ihn als Missionsarzt nach Afrika, um dort aus eigener Kraft ein Urwaldhospital aufzubauen und zu unterhalten. Wie lange vermisste Puzzleteile fügen sich frühe Kindheitserinnerungen in diesen Plan: Denn schon als kleiner Junge hatte Schweitzer gebannt den Lebensberichten der Missionare gelauscht, die an jedem ersten Sonntag im Monat in der Kirche vorgelesen worden waren.[10] Auch von dem traurig dreinblickenden Schwarzafrikaner auf dem Colmarer Marsfeld – einer monumentalen Statue aus der Hand von Frédéric-Auguste Bartholdi – war der junge Albert auf geheimnisvolle Weise angezogen worden.[11]
Jetzt scheint ihm Bartholdi, der auch die Freiheitsstatue geschaffen hatte, mit dieser Plastik einen ganz persönlichen Weg in die Freiheit aus den bürgerlichen Bahnen zu weisen. »Lieber Herr und Amtsbruder«, schreibt er an den Pariser Missionsdirektor Boegner, der den flammenden Aufruf geschrieben hatte. »Ich wende mich heute an Sie mit der Frage, ob Sie jemand für den Kongo benötigen. Ich wäre glücklich, mich zu Ihrer Verfügung zu stellen.« Schweitzer lässt nichts anbrennen und schickt einen gleichzeitig unterwürfigen, selbstbewussten und frommen Brief nach Paris, um sich für den Dienst in Afrika zu bewerben. »Sollte ich zufällig das Klima nicht ertragen oder als Folge der Strapazen invalide werden, so würde ich der Missionsgesellschaft nicht zur Last fallen, denn ich kann immer in den Pfarrberuf im Elsass zurück kehren«, kann Direktor Boegner da lesen und nur wenige Zeilen später muss er sich fast wundern, dass er immer noch denselben Brief in der Hand hält, denn jetzt zeigt Albert Schweitzer ein weiteres Talent: das der Eigenwerbung. »Vielleicht haben Sie in letzter Zeit meinen Namen in einer Zeitung oder einer Zeitschrift gelesen, denn man hat viel von meinem Buch über Bach gesprochen, das im Februar dieses Jahres erschienen ist.« Auch Familie und Freunde kommen ins Reden, als sie Albert über seine Afrika-Pläne informiert. Frustriert schlagen sie die Hände über dem Kopf zusammen, als sie erfahren, wofür Albert seine ihm lange zugedachten und aussichtsreichen Karrieren an der Universität und an der Orgel aufgeben will. Schweitzer ahnt, dass neben dem stirnrunzelnden Professor Fehling, der ihm irgendwie misstrauisch gegenüber sitzt, auch der einfache Pfarrer Boegner an der Spitze der Pariser Mission Zweifel an seinen Plänen haben wird. »Erschrecken Sie nicht darüber, dass ich mich in der theologischen und philosophischen Wissenschaft bewege und sogar Musikschriftsteller bin«, beruhigt er in seinem Brief. »Ja, ich habe alles gekannt: die Wissenschaft, die Kunst, die Freuden der Wissenschaft, die Freuden der Kunst, ich kenne das erhebende Gefühl des Erfolges, und mit wahrem Stolz habe ich meine Antrittsvorlesung mit 27 Jahren gehalten.« Nein, an Selbstvertrauen mangelt es diesem jungen Mann nicht. »Aber das alles hat meinen Durst nicht gestillt«, fährt Schweitzer fort, »ich fühle, dass das nicht alles ist, dass es nichts ist. Ich bin immer einfacher, immer mehr Kind geworden, und ich habe immer deutlicher erkannt, dass die einzige Wahrheit und das einzige Glück darin besteht, unserem Herrn Jesus Christus dort zu dienen, wo er uns braucht.[12]
So kommt also der wissenschaftlich hoch dekorierte Straßburger Frauenarzt Professor Fehling zu seinem wichtigsten Einsatz als Geburtshelfer: Er braucht dafür weder Zange noch weder Glocke. Ein schlichter Füllfederhalter reicht aus. »Fehling«, kritzelt der Dekan unter das Immatrikulationsgesuch, das so etwas ist wie die Geburtsurkunde des Urwalddoktors Albert Schweitzer.
Jugend mit Gott
Albert Schweitzer ist im Elsass geboren und aufgewachsen. Kurz nachdem er am 25. Januar 1875 in Kaysersberg das Licht der Welt erblickt, übernimmt sein Vater Louis Schweitzer als Pfarrer die evangelische Gemeinde von Günsbach im Münstertal. Der winzige Albert ist ein Sorgenkind. Bleich und schlaff liegt er im Arm der bis zur Verzweiflung besorgten Mutter Adele. Schon rechnen sie im Dorf mit dem Schlimmsten: »Das Bueble isch die erschte Beerdigung, wo der neue Pfarrer halten wird.«[13] Allem Geraune zum Trotz kommt es anders. Klein-Albert berappelt sich und wächst sehr zur Freude seiner Eltern zu einem robusten und frommen Jungen heran, der sich später dankbar erinnert: »Die Milch der Kuh des Nachbars Leopold und die gute Luft Günsbachs taten Wunder an mir.«[14] Tatsächlich ist Günsbach ein Paradies im Grünen, umgeben von saftigen Wiesen, steilen Weinbergen und eingefasst von dicht bewaldeten Vogesenausläufern. Unter der Woche tollt Albert in der wunderbaren Natur herum, am Sonntag ist er in der Kirche kaum zu bremsen. Aus vollem Hals singt er die Choräle mit, bis sich alle zu ihm umdrehen und seine Mutter ihm einen peinlich berührten Klapps gibt, weil sie sich nicht mehr anders zu helfen weiß. Am Mittagstisch dann, beim Braten, bedrängt Albert seinen Vater mit hartnäckigen Fragen zu zweifelhaften biblischen Überlieferungen. Übertreibt es das Alte Testament nicht ein bisschen? Die Sache mit der Arche Noah ist so eine Geschichte, die der kritische Albert nicht wirklich recht glauben will. Im ersten Buch Mose hat er über die angeblich katastrophalen Auswirkungen von vierzig Regentagen gelesen: »Und das Gewässer nahm überhand und wuchs so sehr auf Erden, dass alle hohen Berge unter dem ganzen Himmel bedeckt wurden.«[15] Da ist er stutzig geworden und jetzt vermutet er, dass die Sintflut gar nicht so schlimm gewesen sein kann. »Bei uns hat es jetzt schon an die vierzig Tage und vierzig Nächte geregnet«, stellt er bei Tisch fest, »und das Wasser kommt nicht einmal an die Häuser, geschweige denn bis hinauf über die Berge.« Betretenes Schweigen, nicht einmal das Besteck klappert noch. »Ja, damals«, setzt der studierte Theologe und routinierte Seelsorger Louis Schweitzer langsam zu einer unbeholfenen Erklärung an, »damals, zu Beginn der Welt, hat es eben nicht in Tropfen geregnet, wie jetzt, sondern wie wenn man Wasser aus Kübeln ausschüttet.« Dann greift er entschieden wieder zu Messer und Gabel, bevor der Braten ganz kalt wird. Insgeheim ist der belesene und allseits interessierte Vater aber stolz, dass ihn sein Sohn nur in Erklärungsnöte bringt und ihm keine ernstlichen Sorgen macht.
Das hält aber nur bis zum ersten Schultag. Albert ist ein Romantiker durch und durch, für den die Sonne nicht scheint und wärmt, sondern strahlt und lacht; einer, dem das vielstimmige Vogelzwitschern im Frühling kein Wettbalzen, sondern ein lustiges Singen und Jubilieren ist; einer, der in einem gewöhnlichen Wind einen zarten Lufthauch spürt, der durch die Bäume streicht und die Blätter zum fröhlichen Tanz auffordert. Die harte Schulbank ist jedenfalls nicht das Ziel seiner sehnsüchtigen Träume. Die funkelnagelneue Schiefertafel, die ihm sein stolzer Vater wie eine Trophäe unter die Nase hält, treibt ihm die Tränen in die Augen – aber es sind keine Freudentränen.[16] Nein, lernen will er nicht, zumindest nicht den vorgegebenen Stoff. Und weil er mit der guten Gesundheit auch ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein entwickelt hat, macht er es seiner Lehrerin nicht leicht. Als die nichtsahnend erzählt, wie die Arche Noah durch die Wassermassen schaukelt, ruft Albert von seinem Platz aus: »Fräulein Lehrerin, du musst die Geschichte auch richtig erzählen: Du musst sagen, dass es damals nicht in Tropfen regnete, sondern wie wenn man Wasser aus Kübeln ausschüttet.«[17] Nicht nur, wenn es um die Bibel geht, fällt Albert unangenehm auf. »Schweitzer lacht!«, steht ein ums andere Mal im Klassenbuch.[18] Sein glockenhelles Kichern stört immer dann den Unterricht, wenn ihn die Klassenkameraden mit kleinen Witzchen und Neckereien aus der Fassung bringen. Das machen sie ungeniert und schadenfroh, denn sie haben das »Herrenbueble« aus dem wohlsituierten Pfarrhaus auf dem Kieker. Selbst beim Raufen auf dem Schulweg lässt die Dorfjugend das »Pfarrerssöhnle« spüren, dass es nicht dazugehört: »Ja, wenn ich alle Woche zweimal Fleischsuppe zu essen bekäme wie du«, ruft der unterlegende Georg Nitschelm, »da wäre ich auch so stark wie du.«[19] Das sitzt. Von nun an weist Albert konsequent alle Annehmlichkeiten von sich, die ihn von den anderen Jungs trennen könnten. Standhaft weigert er sich, den eigens geschneiderten Wintermantel zu tragen; als Handschuhe kommen für ihn nur die gewöhnlichen Fäustlinge in Frage und auch die modische Matrosenmütze schlägt er aus. Vater Louis, der politisch und in der Kirche immer ein offenes Ohr für andere Ansichten hat, reagiert unwirsch mit der flachen Hand und mit dem Kellerschlüssel. Aber weder Ohrfeigen noch Dunkelarrest brechen Alberts festen Willen – um nicht zu sagen: seinen bereits früh ausgewachsenen Dickkopf.
Auch Albert kann schon mal kräftig zulangen, selbst wenn es eigentlich um nichts geht. Als seine jüngere Schwester das gemeinsame Spiel nicht ganz so ernst nimmt wie ihr hochkonzentrierter Bruder, rastet Albert aus. Ärgerlich und geradezu wütend verpasst er ihr eine ordentliche Ohrfeige, weil sie sich nicht genug Mühe gibt, ihn beim Spiel zu besiegen und ihn allzu leicht gewinnen lässt.[20] Da versteht er keinen Spaß!
Wenn er doch diese Ernsthaftigkeit und Entschlossenheit auch im Unterricht an den Tag legen würde. Dort lässt er es nach wie vor locker angehen. Als er auf die Realschule im benachbarten Münster wechselt, da freut er sich nur über den schönen Schulweg, der ihn drei Kilometer lang durch die unberührte Natur führt und auf dem er in unschöner Regelmäßigkeit schlechte Noten mit nach Hause bringt. Der Direktor druckst herum, als er dem Herrn Pfarrer nahelegt, seinen Sohn von der Schule zu nehmen, weil Albert schlicht und ergreifend überfordert sei.[21] Der spätere Universalgelehrte schafft es beinahe nicht aufs Gymnasium. Seine Leistungen reichen dafür jedenfalls nicht, aber Schweitzer hat einen Großvater, der seinerseits einen Halbbruder hat, der wiederum Direktor der Mühlhausener Elementarschulen ist, der deshalb genau weiß, bei wem man ein gutes Wort einlegen muss, der einen bei sich aufnimmt und der obendrein auch noch das Schulgeld bezahlen kann. Opas funktionierendes Familiennetzwerk bringt den Knaben vom Lande aufs städtische Gymnasium.[22] Dort tut sich Albert nicht lange schwer, denn seine Mühlhausener Gastfamilie und seine Lehrer wirken wie einst die Kuh des Nachbarn Leopold wahre Wunder an ihm. Sein Großonkel – der genau wie der Vater Louis Schweitzer heißt – erzieht ihn mit der Quizmethode zum neugierigen und kritischen Zeitungsleser: Wie heißen die Fürsten der Balkanstaaten? Wer gehört der französischen Regierung an? Und wer hat Frankreich vorher regiert? Was wird gerade im Deutschen Reichstag diskutiert? Solche Fragen will der lebenslange Besserwisser nicht unbeantwortet lassen und er saugt das Zeitungsallgemeinwissen begierig in sich auf. Der Großonkel lächelt still in sich hinein.
Die Großtante Sophie führt derweil zu Hause ein strenges Regiment. Penibel regelt und überwacht sie Alberts Tagesablauf: unter der Woche Frühstück, Schule, Mittagessen, Klavier üben, Schule, Schulaufgaben, wieder Klavier üben und Abendbrot; sonntags ausgedehnte Spaziergänge. Auch Tante Sophie legt damit den Grundstein zweier lebenslanger Schweitzer-Tugenden: Arbeitseifer und Disziplin.