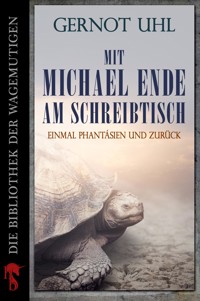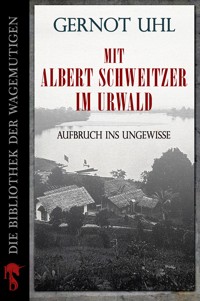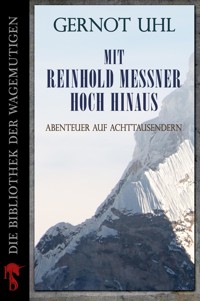2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks: e-book first
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Freudenmädchen in rosa Formen, jugendliche Selbstmörder auf dem Totenbett und völlig entstellte Geliebte – die Bilder von Pablo Picasso empören seine Zeitgenossen. Auch der Maler ist empört – über den Bombenangriff auf das wehrlose Baskenstädtchen Guernica. Wütend rührt er alle erdenklichen Schwarz- und Grautöne an und greift zum Pinsel. Bis unter die wuchtigen Dachsparren seines Ateliers reicht die riesige Leinwand, auf die er das Grauen von Guernica bannt. Die Welt soll sehen, welche Verbrechen das spanische Militär an seinen eigenen Landsleuten verübt – auch wenn der Jahrhundertkünstler damit seine geliebte Heimat aufs Spiel setzt … Dieses E-Book aus der »Bibliothek der Wagemutigen« nimmt Sie mit in Pablo Picassos bunte Lebensgeschichte: Begleiten Sie den talentierten Malereischüler vom beschaulichen Málaga über das Künstlerviertel von Madrid und die Bohème-Szene von Barcelona bis auf den Gipfel der europäischen Avantgarde: auf den berühmt-berüchtigten Montmartre in Paris, wo aus dem kleinen Pablo der große Picasso wird …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 149
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Gernot Uhl
Mit Pablo Picasso an der Leinwand
Farbe bekennen
Die Bibliothek der Wagemutigen
Rebellische Künstler, furchtlose Freiheitskämpfer, kühne Sportler – Wagemut hat viele Gesichter. Starke Persönlichkeiten folgen nicht flüchtigen Trends, sondern inneren Überzeugungen. Leidenschaftlich, streitbar und risikobereit gehen die Helden dieser Reihe außergewöhnliche Lebenswege, auf denen nichts unmöglich ist. Erleben Sie unterhaltsam und spannend erzählte Lebensgeschichten voller Überzeugung: Wo ein Wille ist, ist auch ein Lebensweg. Die E-Books aus der Bibliothek der Wagemutigen führen Sie zu den dramatischen Schicksalsmomenten im Leben von Menschen, die Geschichte machen.
Die Schreckensnachricht
Zuerst ist es nur Geraune in den Straßen von Paris. Von einer Feuersbrunst erzählt man sich an diesem 28. April 1937, von einer Trümmerwüste und von hunderten Toten. Die Schreckensnachricht platzt mitten in den schönsten Frühling: Im Spanischen Bürgerkrieg soll das unschuldige Baskenstädtchen Guernica bei einem gnadenlosen Luftangriff dem Erdboden gleich gemacht worden sein. Pablo Picasso sitzt gerade mit frisch gebrühtem Kaffee und einer Zigarette an dem kleinen Tischchen in seinem Stammlokal, dem Café de Flore am Boulevard Saint Germain. Er liest Zeitung, freut sich darüber, dass die jungen Frauen nach dem langen Winter endlich wieder kürzer tragen, und genießt die ersten warmen Sonnenstrahlen. Plötzlich Unruhe, Motorengeheul, quietschende Bremsen, Türenschlagen. Wenige Meter entfernt hat ein Taxi gehalten und herausgesprungen ist ein junger Spanier, der jetzt wild gestikulierend auf Picasso zustürzt. »Stell dir vor«, ruft er und seine Stimme überschlägt sich fast, »diese verfluchten Faschisten haben Guernica bombardiert!« Die Stadt sehe aus »wie ein Porzellanladen, in dem ein Stier Amok gelaufen ist.«[1]
Picasso ist außer sich. Seine dunklen Augen funkeln zornig und sein Blick ist noch stechender als sonst. Er hasst diesen faschistischen General Francisco Franco für seinen brutalen Militärputsch. Seit Monaten tyrannisiert Franco die spanische Republik mit einem blutigen Bruderkrieg und greift gewaltsam nach der Macht. Als ob das nicht schlimm genug wäre! Wenn es aber stimmen würde, dass Franco nun eine wehrlose Stadt zerstört hat, dann wäre das eine unerhörte Gräueltat. Auch wenn Picasso seit vielen Jahren in Paris lebt und obwohl ihm die französische Hauptstadt zu einer zweiten Heimat geworden ist: Picasso ist und bleibt mit jeder Faser seines untersetzten und stämmigen Körpers ein stolzer Spanier mit der festen Überzeugung: »Ein Mensch gehört für immer seinem Land!«[2] Picasso leidet mit seinen Landsleuten und die furchtbaren Neuigkeiten schlagen bei ihm ein wie die Bomben im Stadtkern von Guernica.
Aber woher soll Franco, dieser aufsässige General, eigentlich eine Luftwaffe haben, die zu einem solchen Vernichtungsangriff fähig ist? Picasso muss das jetzt genau wissen. Er kehrt nach Hause zurück und schaltet das Radio ein. Stirnrunzelnd sitzt er vor dem gespenstisch rauschenden und knackenden Gerät. Der Empfang ist genauso schlecht wie die Nachrichten. Picassos Hand, die sonst so feinfühlig den Pinsel führt, dreht nun behutsam am Frequenzknopf. Immer wieder überlagern französische Stimmenfetzen die verzweifelte Ansprache des baskischen Präsidenten José Antonio Aguirre, der in Bilbao vor dem Mikrofon steht und seine ungeheuerliche Botschaft durch den Äther schickt: »Vor dem Gericht Gottes und der Geschichte, von der wir alle gerichtet werden, bezeuge ich: dreieinhalb Stunden haben deutsche Flugzeuge mit einer unvergleichlichen Grausamkeit die Zivilbevölkerung der historischen Stadt Guernica bombardiert, ihre Stadt in Asche gelegt, Frauen und Kinder mit Maschinengewehren verfolgt, sodass viele umkamen und die Überlebenden in Panik geflohen sind.«[3]
Deutsche Flieger? Ist das wahr? Macht Franco denn wirklich vor gar nichts halt? Tatsächlich weicht das Gerücht nur wenig später der Gewissheit. Die Heilige Stadt der Basken ist von einer unheiligen Allianz zermalmt worden. Franco ist jedes Mittel recht, um den Bürgerkrieg für sich zu entscheiden und die spanische Republik zu stürzen – selbst der Pakt mit dem Teufel! Und Hitler hat bereitwillig eine geheime Luftwaffeneinheit geschickt, die Legion Condor. Den Nationalsozialisten ist das eine willkommene Übung für den Weltkrieg und Franco kann jede Waffenhilfe brauchen: Die deutschen Flugzeuge sollen seinen Bodentruppen den Weg ebnen und die tapferen Basken brechen, die dem Faschismus trotzen.
Täglich erreichen Paris neue grausame Details. Pablo Picasso kann die Augenzeugenberichte des Angriffs in den letzten Apriltagen 1937 nach und nach schwarz auf weiß nachlesen: Die sozialistische Zeitung L’Humanité – die Menschlichkeit – berichtet von einer bis auf die Grundfesten ausgebombten, brennenden Ruine: »Es handelt sich um das schrecklichste Bombardement des Krieges. Die Zahl der im Feuer Umgekommenen ist unermesslich. Die deutschen Flugzeuge flogen in geringer Höhe. Sie bombardierten die Bevölkerung in der Stadt und in der Umgebung mehrere Stunden lang. Es war ausschließlich zivile Bevölkerung, nicht ein Soldat hielt sich dort auf! Aber es gab Hospitäler dort, und die Verwundeten wurden bei lebendigem Leibe verbrannt.«[4] Auch die altehrwürdige und unabhängige Londoner Tageszeitung The Times erhebt Anklage gegen ein Kriegsverbrechen: »Guernica war kein militärisches Ziel«, kommentiert ihr Reporter George Steer, der noch während des Angriffs in halsbrecherischem Tempo aus Bilbao nach Guernica aufgebrochen ist und die Zerstörung mit eigenen Augen gesehen hat. »Eine Fabrik, die Rüstungsgüter herstellte, befand sich außerhalb der Stadt und blieb unangetastet.« Noch kennen weder der erfahrene Kriegsberichterstatter noch seine Leser die rücksichtslosen Flächenbombardements, die im Zweiten Weltkrieg halb Europa niederreißen werden. Guernica ist der erste Versuch, eine Stadt vollständig auszulöschen. Selbst der hartgesottene George Steer, der schon viel Elend gesehen hat, erschaudert beim Anblick der brennenden Stadt. »Noch aus 10 Meilen Entfernung war der Widerschein der Flammen in den Rauchwolken über den Bergen zu sehen«, notiert er zuerst für sich und dann für die Nachwelt, »die ganze Nacht hindurch stürzten Häuser ein, und die Straßen verwandelten sich in lange Haufen undurchdringlichen Schutts. Hinter der Bombardierung steckt offenkundig die Absicht, die Zivilbevölkerung zu demoralisierenden. Alle Tatsachen sprechen für diese Einschätzung.«[5]
Trotzdem verschließen die demokratischen Regierungen Frankreichs und Englands die Augen vor dem menschenverachtenden Angriff und hüllen sich in peinliches Schweigen. Weiß man denn im Élysée-Palast und in 10 Downing Street nicht, welche Stunde geschlagen hat? Während Hitler Franco sekundiert und mit Waffen und Soldaten versorgt, lautet die offizielle Parole in London und Paris: Nichteinmischung! Unerträglich ist das für Picasso: Wenn schon die Politik wegschaut, muss wenigstens die Kunst Farbe bekennen: »Künstler, die mit geistigen Werten leben und arbeiten«, ereifert sich Picasso, »können und dürfen in einem Konflikt, in dem es um die höchsten Werte der Menschheit und Zivilisation geht, nicht gleichgültig bleiben.«[6]
Natürlich führt man mit dem Pinsel keine Regierung, Staatsverträge werden nicht auf Leinwänden unterzeichnet und ein Diplomat ist an dem oftmals kauzigen und mürrischen Picasso auch nicht verloren gegangen. Die Welt kennt ihn nicht für politische Bekenntnisse, sondern für seine oft rätselhaften Bilder: Erst sind sie alle blau gewesen, dann rosa; schließlich hat er die schönsten Frauen in klobige Würfel, Dreiecke, Halbkreise und andere geometrische Formen zerlegt. Großformatige und vor allem eindeutige Antikriegsbilder sind bislang jedenfalls nicht dabei gewesen. Weiß Picasso überhaupt, wie man politische Botschaften auf die Leinwand bringt? Kann er überhaupt anmalen gegen den Faschismus? Solche Zweifel ringen ihm selbst nur ein müdes Lächeln ab. »Was ist wohl ein Künstler?«, fragt er. »Ein Schwachsinniger, der nur Augen hat, wenn er Maler ist, nur Ohren, wenn er Musiker ist? Ganz und gar nicht!« Picasso schüttelt den Kopf. Ein Künstler muss keine billige Propaganda machen, um zu zeigen, wie eng er verwoben ist mit den großen Begebenheiten seiner Zeit. »Der Künstler ist ein politisches Wesen«, grantelt Picasso trotzig, »ein politisches Wesen, das ständig im Bewusstsein der zerstörerischen, einschneidenden oder der beglückenden Weltereignisse lebt und sich nach ihnen formt!« Das zerstörerische Weltereignis von Guernica und das Schicksal seiner Landsleute – »Wie könnte man kein Interesse nehmen an den anderen Menschen«? – formen in Pablo Picasso den Entschluss zur Gegenwehr mit dem Pinsel: »Die Malerei ist nicht erfunden worden, um Wohnungen auszuschmücken! Sie ist eine Waffe zum Angriff und zur Verteidigung gegen den Feind.«[7]
Der geborene Maler
Pablo Ruiz Picasso kommt am 25. Oktober 1881 im andalusischen Málaga zur Welt, aber niemand kann sich freuen in den ersten Minuten dieses Jahrhundertlebens.[8] Der Neugeborene zappelt nicht, schreit nicht und atmet nicht. Die Hebamme versetzt ihm einen Klaps nach dem anderen und versucht verzweifelt, ihn zu beleben, doch vergebens. Schon schluchzt die erschöpfte Mutter Maria Lopez Picasso Tränen der Trauer; schon wendet sich der Vater José Ruiz Blasco entsetzt ab und sinkt stumm in sich zusammen. Nur der Onkel, Josés jüngerer Bruder Salvador, hat noch nicht aufgegeben. Salvador Ruiz Blasco ist Arzt, durch und durch praktisch orientiert und greift zu einem Geburtshelfer der anderen Art. Kurzentschlossen bläst er seinem Neffen den Rauch seiner Zigarre in die Nase – und der kleine Pablo erwacht zum Leben. »Na also«, brummt Salvador und tut einen kräftigen Zug. José, den der erste Schrei seines Sohnes aus der schmerzlichen Gleichgültigkeit befreit hat, drückt seinem jüngeren Bruder dankbar die Hand.[9]
Das ist nicht das einzige Mal, dass José Ruiz Blasco – genannt Don José – auf seine Brüder angewiesen ist. Genau genommen ist er sogar das ewige Sorgenkind seiner Familie, die sehr darauf bedacht ist, gesellschaftlich zu glänzen: Don Salvador macht ihr da als angesehener Hafenarzt alle Ehre. Der älteste der zehn Brüder und Schwestern, ebenfalls ein Pablo, hat es sogar zum Domherrn von Málaga gebracht. Und José? José hält sich ausgerechnet für einen Maler! Ein Künstler? Da schüttelt die liebe Verwandtschaft peinlich berührt die Köpfe.[10] Man schämt sich für diesen Taugenichts, der lange Zeit unbekümmert in den Tag hinein gelebt hat. In diesem unsteten Lotterleben ist noch nicht einmal Platz für eine Ehefrau gewesen, von einem festen Job ganz zu schweigen. Was soll das denn? Na gut, Don José mag ja als Maler nicht wirklich untalentiert sein, aber zum Leben reicht die Begabung eben auch nicht.
Der gütige Domherr Pablo ist der Einzige gewesen, der als Mann des Glaubens auch an die Malerei seines Bruders glauben hat wollen. Er hat den eingefleischten Junggesellen José bei sich wohnen lassen und dafür gesorgt, dass er halbwegs über die Runden gekommen ist. Pablo, dem es im warmen Schoß der katholischen Kirche gut gegangen ist, hat ja auch die ledigen Schwestern ausgehalten und auf einen mehr oder weniger ist es nicht angekommen. Aber das ist mit einem Schlag Vergangenheit: Pablo stirbt allzu früh und auf einmal ist Don José der Älteste. Alle Sorgen der Familie lasten nun auf ihm. Die drängt jetzt umso vehementer darauf, dass er sich endlich einen anständigen Beruf sucht, heiratet und für einen Stammhalter sorgt. Schließlich ist er mit seinen vierzig Jahren nicht mehr der Jüngste, auch wenn er durchaus attraktiv wirkt: Hager, hochgewachsen und mit einem markanten roten Kinnbart macht Don José schon was her. Seine Schwestern tun sich also nicht schwer, eine geeignete Frau für ihn zu finden. Aber ganz einfach lässt er sich dann doch nicht verheiraten. Im letzten Moment, die Hochzeit ist schon so gut wie vollzogen, schlägt der Bräutigam wider Willen seiner Verwandtschaft noch einmal ein Schnippchen und entscheidet sich für Maria, die Cousine der Auserwählten.
Bei der leidigen Berufssuche nimmt er dagegen gerne die Hilfe seines gut vernetzten jüngeren Bruders Salvador in Anspruch. Der kontaktfreudige Mediziner vermittelt den mittellosen Künstler als Zeichenlehrer an die örtliche Kunstschule San Telmo und als Kurator an Málagas Museum, das fast immer geschlossen hat. Die meiste Zeit ist Don José damit beschäftigt, alten Plunder zu entstauben – große Sehenswürdigkeiten gibt es jedenfalls nicht zu pflegen.[11] Der Lohn ist wie das Ansehen der beiden Stellen: nicht der Rede wert. Zum Glück hat sein Vermieter ein Faible für verkrachte Künstlerexistenzen und akzeptiert hin und wieder ein Bild als Miete.[12]
Was und wie es Don José auf die Leinwand bringt, ist überraschend anders als sein bisheriges Leben: Bieder und spießbürgerlich kommen die wenigen Techniken und Motive daher, die er beherrscht. Don José ist ganz in der akademischen Tradition gefangen und malt immerzu Flieder und Tauben. Das ist klassische Wohnzimmerkunst: über dem Sofa ganz nett. Im eigenen Wohnzimmer regiert das liebe Federvieh. Don José züchtet selbst und seine gefiederten Modelle flattern vergnügt durch die kleine Mietwohnung. Nicht selten verleihen die unaufhörlich gurrenden Tauben seinen Bildern den letzten Farbklecks. Ganz so realistisch müsste es zwar nicht sein, aber möglichst echt sollen sie doch aussehen, die Tauben und der Flieder. Kein Jota dürfen sie vom klassizistischen Kunstverständnis abweichen, wie es an den altehrwürdigen Schulen gelehrt und bewahrt wird.
Das prägt – und zwar mehr als Don José recht sein kann. Denn sein Sohn Pablo schaut erst genau hin, um sich dann später umso entschiedener abzuwenden. Jedenfalls ist Pablito – so ruft die stolze Mutter ihren Kleinen[13] – von Anfang an wie magisch von der Malerei angezogen. Noch bevor er sprechen lernt, beherrscht er Formen und Linien. Mit einer Schere, die er im Nähkästchen seiner Mutter findet, schneidet er aus der Zeitung Pferde, Hähne, Hunde und fantasievolle Figuren aus. Doña Maria und ihre Schwägerinnen sind entzückt. Der spätere Herzensbrecher versteht früh, was Frauen wollen. Mit seiner kindlichen Kunst bringt er sie bald dazu, ihm alle Wünsche erfüllen: Wenn er Lust auf Süßigkeiten hat, kritzelt er flugs ein paar Spiralen auf Don Josés Skizzenblätter. Dann kaufen ihm die angetanen Frauen Zuckerkringel aus frittiertem Gebäck. Während er dann genüsslich an seiner Belohnung knabbert, tätschelt ihm die stolze Doña Maria zärtlich den Kopf: »Wenn du Soldat wirst, bringst du es zum General. Wenn du Mönch wirst, machen sie dich zum Papst!«[14]
Aber Pablo will weder ein Mann des Krieges noch ein Mann der Kirche werden. Schon das erste Wort, das er spricht, steht ganz im Zeichen seiner Bestimmung: »Piz!«, das heißt Stift. »Piz, Piz, Piz!«[15] Drollig, aber eben auch trotzig fordert er ein, was er will: Er will malen – und nur malen!
So ist es ein allmorgendliches Drama, ihn in die Schule zu bringen. Don José muss seinen plärrenden und tobenden Sohn mehr oder minder gewaltsam hinter sich herziehen. Mühsam schleift er ihn bis zur Schulpforte. Doch kaum, dass er Pablo dann endlich loslassen will, krallt der sich seinerseits eisern an der Hand des Vaters fest: »Warum kommst du nicht mit? Ich will nicht ganz allein hineingehen«, schluchzt Pablo. Dann kommt er auf eine Idee: Nur wenn er ein Faustpfand ergattert, kann er sich sicher sein, dass ihn sein Vater wieder abholen wird und nur so erträgt er den Vormittag: »Lass mir doch die Pinsel«, bettelt Pablo, »oder den Spazierstock. Gib mir das Täubchen …«[16] Ausgerechnet die Tontaube, die Don José oft und gerne als Modell verwendet. Eigentlich will er darauf nicht verzichten. Aber es hilft nichts, Pablo will die Taube ja gerade deswegen und er bleibt stur.
Natürlich verschwindet die Tontaube nicht brav in der Mappe, bis der Unterricht vorbei ist, sondern sie wird sorgsam auf dem Tisch in Stellung gebracht. Während seine Mitschüler Lesen und Schreiben lernen, übt sich Pablo im Taubenzeichnen. Wenn die anderen rechnen, schiebt er die ungeliebten Zahlen solange hin und her, bis sie der Taube auf dem Tisch ähneln. Dann erklärt er dem verdutzen Lehrer: »Das Auge der Taube ist so rund wie eine Null. Unter der Null eine Sechs; darunter eine Drei. Es gibt zwei Augen und auch zwei Flügel. Die beiden Füßchen stehen auf dem Tisch, auf dem Schlussstrich. Darunter ist das Ergebnis.«[17] Aber auch das hilft nicht immer: Die Sehnsucht nach der Freiheit des geborenen Künstlers, der keine Grenzen kennt und der sich auch nicht in eine Schulbank zwängen lässt, ist einfach stärker. Wenn ihn diese Sehnsucht packt, dann steht Pablo unvermittelt auf, läuft zu den großen Fenstern des Klassensaals, klettert auf die Fensterbank, beobachtet die Fußgänger und winkt ihnen freundlich zu. Seine Lehrer müssen über viel hinwegsehen. Pablo ist ja nicht etwa ein verzogener Bengel, der boshaft den Unterricht stört und seine Erzieher ärgert. Er tut sich nur unglaublich schwer mit allem, was nichts mit Zeichnen, Malen und Basteln zu tun hat.
Wenn er aber mit Pinsel und Farben, mit Tapeziermessern und Kleister, mit Kohlestiften und Radiergummi experimentieren darf, dann glänzen seine Augen – und nicht nur seine. Don José beobachtet voller Stolz, wie sein Sohn von Tag zu Tag raffinierter malt. Das ist eine der selten gewordenen Freuden im ansonsten trüben Leben des Vaters. Don José versinkt in einer tiefen Melancholie, als er Anfang der 1890er Jahre mit seiner Familie seine Heimatstadt verlassen muss, weil er sie dort nicht ernähren kann. La Coruña ist nicht halb so schön wie Málaga. Lustlos zwingt er sich jeden Tag aufs Neue dazu, zur Arbeit gehen. Wenigstens bezahlt ihn die Kunstschule etwas besser als das kleine Museum in Málaga. Sonst aber hat auch diese Schule kaum etwas zu bieten. Don Josés Lieblingsschüler ist und bleibt sein Sohn, der mittlerweile fast zehnjährige Pablo. Der väterliche Lehrer freut sich an der phänomenalen Auffassungsgabe seines Sohnes. Wie schnell Pablo sich doch darauf versteht, Licht- und Schatteneffekte auf das Zeichenpapier zu zaubern! Bald schon darf er sich an noch schwierigeren Aufgaben versuchen: Wenn eine der vielen Tauben stirbt, die sich auch in der neuen in der Wohnung tummeln, schneidet ihr Don José die Füße ab, nagelt sie in immer neuen Stellungen an ein Brett und lässt Pablo Detail um Detail abzeichnen.[18] Das macht er so genau, dass er bald darauf die Taubenfüße in den Bildern seines Vaters übernehmen darf. Don José ist entzückt und öffnet Pablo das Tor zur immer neuen Techniken der Malerei. Er lehrt ihn mit der Feder zu zeichnen und weiht ihn in die Kunst der Aquarell- und Pastellmalerei ein.
Je sicherer der Sohn Bleistift, Feder und Pinsel führt, desto ungewisser ist sich der Vater seines eigenen Talents. Ist nicht seine Arbeit als Ausbilder seine eigentliche Bestimmung? Don José geht hart mit sich ins Gericht und trifft eine einsame Entscheidung: Er, der als freier Maler gescheitert und als Zeichenlehrer frustriert ist, macht es sich zur Lebensaufgabe, seinem Sohn zu einer Künstlerkarriere zu verhelfen. Wenn er schon kein Großer sein kann, soll es sein Sohn schaffen. Und die richtig Großen fangen richtig klein an: Pablo ist gerade mal elf Jahre alt, als er als Schüler an der Kunstschule von La Coruña aufgenommen wird – und außerdem zum ersten Mal seine eigenen Bilder ausstellt: bei einem geschäftstüchtigen Schirmmacher, der dem Jungen dafür werbewirksam seinen Eingangsbereich überlässt: Wunderkinder ziehen Kundschaft an. Zu Hause inszeniert Don José eine dramatische Staffelei-Übergabe. In feierlichem Ernst reicht er Pablo seine eigene Palette und die Pinsel, versehen mit einer pathetischen Erklärung: »Ich werde nie wieder malen!«[19]