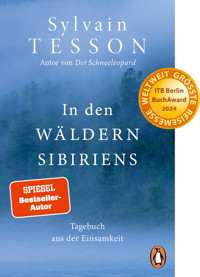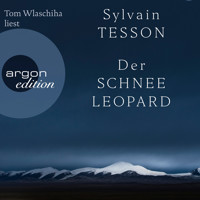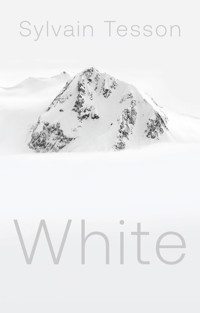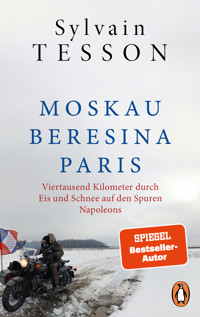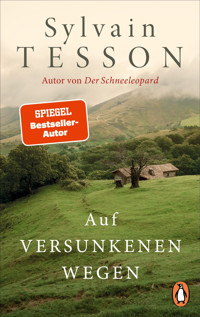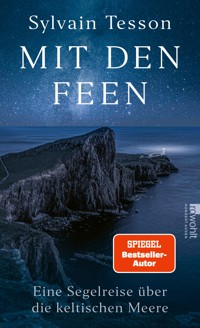
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine poetische Erkundung, ein waghalsiges Abenteuer, ein schillerndes Porträt der keltischen Meere und der wilden Lande, die sich ihnen entgegenrecken. Der Sommer bricht an, als Sylvain Tesson, Wanderer zwischen den Welten, zu einem großen maritimen Abenteuer aufbricht. Von den schroffen Felsvorsprüngen Galiciens entlang der wilden bretonischen Küstenlinie hinüber zu den weißen Felsen von Wales, dorthin, wo die grünen Abhänge Irlands sich dem Meer entgegenwellen, und weiter noch bis hinauf zu den mystischen Basalthöhlen der äußeren Hebriden und den wild umtosten Felsnadeln Schottlands. Sylvain Tesson pendelt in diesem Buch zwischen See und Land, zwischen Vergänglichkeit und dem, was überdauert, zwischen Geschichte und keltischem Mythos – immer auf der Suche nach den Feen, nach Momenten, in denen sich uns die Schönheit der Natur offenbart. Und er findet sie. In dem Widerschein der Sonne auf dem Meer, dem Rauschen des Windes in den Blättern einer Buche, im perlenden Tau auf dem Fell eines Tieres.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 182
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Sylvain Tesson
Mit den Feen
Eine Segelreise über die keltischen Meere
Über dieses Buch
Auf einer schwimmenden Bibliothek entlang der westlichen Küsten Europas
Der Sommer beginnt, als Sylvain Tesson zu einem großen maritimen Abenteuer aufbricht. Von den schroffen Felsvorsprüngen Galiciens entlang der wilden bretonischen Küstenlinie zu den weißen Felsen von Wales und dorthin, wo die grünen Abhänge Irlands sich dem Meer entgegenwellen. Weiter noch bis hinauf zu den mystischen Basalthöhlen der äußeren Hebriden und den wild umtosten Felsnadeln Schottlands. Sylvain Tesson pendelt auf dieser Reise zwischen See und Land, zwischen Vergänglichkeit und dem, was überdauert, zwischen Geschichte und keltischem Mythos – immer auf der Suche nach den Feen, nach Momenten, in denen sich ihm die Schönheit der Natur offenbart: dem Widerschein der Sonne auf dem Meer, dem Rauschen des Windes in den Blättern einer Buche, perlendem Tau auf dem Fell eines Tieres. Ein poetischer Reisebericht vom Meister des Nature Writings.
Vita
Sylvain Tesson, geboren 1972 in Paris, ist Schriftsteller, Geograf und ein leidenschaftlicher Reisender. An eine erste Expedition nach Island schlossen sich weitere an: mit dem Fahrrad um die Welt, zu Fuß durch den Himalaya und zu Pferd durch die Steppe Zentralasiens. Für seine Reisebeschreibungen und Essays wurde Sylvain Tesson mit dem Prix Goncourt de la nouvelle und zuletzt mit dem Prix Renaudot für «Der Schneeleopard» ausgezeichnet.
Nicola Denis, geboren 1972 im niedersächsischen Celle, lebt seit über zwanzig Jahren im Westen Frankreichs. Dort übersetzt sie neben Klassikern wie Alexandre Dumas oder Honoré de Balzac französische Gegenwartsautoren wie Jean-Noël Orengo, Olivier Guez, Philippe Lançon oder Éric Vuillard. 2021 erhielt sie den Prix lémanique de la traduction, 2023 den Eugen-Helmlé-Übersetzerpreis.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel «Avec les fées» bei Éditions des Équateurs/Humensis, Paris.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Oktober 2025
Copyright © 2025 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
«Avec les fées» Copyright © 2024 by Éditions des Équateurs/Humensis
Redaktion Bärbel Brands
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Adobe Stock
ISBN 978-3-644-02287-4
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Aber wir dürfen das Spiel, das wir spielen, nicht zu ernst nehmen.
Walter Scott, Ivanhoe
Ja, sie kehrten heim, und alles Schöne,
Alles Hohe nahmen sie mit fort.
Friedrich Schiller, Die Götter Griechenlands
Nehmt diese Gewissheit in euch auf: Alles, was ist, gleicht einem schlummernden Lied und wartet nur auf einen Blick, der rein ist, um wieder zu erwachen.
Joë Bousquet, Lettres à une jeune fille
Für KVO: Karyatide, Vestalin, Odaliske
Vorwort
Der Sommer brach an, als ich mich an der Atlantikküste auf die Suche nach den Feen begab. Ich glaube nicht an ihre Existenz. Es gibt keine Libellen-Mädchen, die im Ballettröckchen über Brunnen flattern. Sie sind der Welt abhandengekommen. Im 12. Jahrhundert lebten die Menschen umgeben von Visionen.
Ein blasser Belgier namens Maeterlinck sagte: «Sie sind recht wunderlich, die Menschen … seit dem Tod der Feen sehen sie überhaupt nicht mehr und wissen es nicht.»
Das Wort Fee bedeutet etwas anderes: eine Veredelung der Wirklichkeit, die sich durch die Einstellung des Blicks offenbart. Eine Bereitschaft, die Welt zu erfassen und ein Wunder in ihr zu erkennen. Der abermalige Widerschein der Sonne auf dem Meer, das Säuseln des Winds in den Blättern einer Buche, Blut im Schnee, perlender Tau auf einem Tierfell: Dort sind die Feen.
Wir betrachten die Welt mit Ehrfurcht, und sie erscheinen. Plötzlich ein Zeichen. Die aufleuchtende Schönheit einer Form. Ich gebe diesem Aufblitzen den Namen Fee. Gewiss – wenn wir uns am Rand einer westlichen Klippe befinden, dort, wo die Sonne, ermattet von allem Gesehenen, über dem wohlmeinenden Ozean sinkt, dürfen wir eher mit dem Erscheinen der Feen rechnen, weil die Landschaft so schmerzlich weit und durch ihre Schönheit bewahrt wird.
Vom spanischen Galicien bis zu den schottischen Shetlandinseln erstreckt sich ein Küstenstreifen, mit Stechginster überzogen, mit Gischt gesalzen und von den Möwen bewacht. Höhnisch lachen sie auf das schäumende Meer herab.
Abend für Abend erstarb die Sonne am Rand dieses Balkons. Die Historiker stritten darüber, ob man die Volksstämme, die auf jener Brüstung untergegangen waren, als Kelten bezeichnen durfte.
Da der Tag hier zu Ende ging, verband ich diesen Korridor aus Jod und Granit mit der Heimat der toten (der schönsten) Dinge. An diesen Ausläufern, wo Erde, Licht und Meer ineinandergreifen, mussten die Feen Zuflucht gesucht haben.
Die Felsvorsprünge Galiciens, der Bretagne, Cornwalls, Wales, der Isle of Man, Irlands und Schottlands bildeten einen Bogen. Über den Seeweg wollte ich die Brösel dieser Zerklüftung miteinander verbinden. In jener Krümmung durfte man sich gewiss sein, hin und wieder das Wunderbare zu erhaschen.
Im Hafen von Gijón erwartete mich ein fünfzehn Meter langes Segelboot. An Bord bereiteten zwei Freunde, Arnaud Humann und Benoît Lettéron, das Ablegen vor. Wir würden gen Norden segeln und all die Felsvorsprünge grüßen, wo die seit Langem Ansässigen jeden Abend Abschied von der Sonne nahmen.
Da es dunkel geworden war in der Welt der Banker und Maschinen, wollte ich mir drei Monate Zeit nehmen, um wieder zu sehen. Ich machte mich auf den Weg. Mit den Feen.
IIn Spanien
Eine Nacht des Wachens
Ich hatte einen Plan. Ich wollte auf einem Finis terrae biwakieren, bevor ich in See stechen würde. Eine Nachtwache am Ende der Welt. Anschließend würde ich an Bord gehen.
Ich liebe die Nächte vor dem Aufbruch. Man geht zu Bett, träumt und vermisst bereits das, was man verlassen wird.
«Ich sehe überall Feen», hatte der Dichter Paul Fort geschrieben. Was für ein Glück!, dachte ich als Kind. Davon träumte ich auch. Als Erwachsener gab ich es auf, weil ich einsah, dass man die Fee nicht treffen kann. Aber sie ruft sich selbst herbei, als Wesen jener Augenblicke, in denen das Getöse der Menschen und die Dummheit der Zahlen nachgeben.
Ich schlief im äußersten Westen Spaniens, in Galicien, am Castro de Baroña, auf einem in die Fluten ragenden Granitsporn. Im ersten Jahrhundert vor Christus lebten dort Menschen, hielten Wache vor dem Sonnenuntergang. Sie waren aus den Tiefen der Bronzezeit und Mitteleuropas gekommen. Sie hatten sich auf den Brüstungen des Okzidents niedergelassen und sich dort gehalten, während die Römer damit beschäftigt waren, ihr Reich zu verwalten. Ihre Fundamente hatten überdauert: Kreise auf einer Felsabflachung. Hier hatte man zur Sonne gebetet und hinter Festungsmauern Schmuck geschmiedet – damals, als der Andere die größte Gefahr darstellte.
Ich legte mich an eine Stützmauer oberhalb der Brandung. Zweitausend Jahre zuvor waren die gleichen Wellen an den gleichen Granit geprallt. Das Meer ist niemals müde. Ich spürte die Wogen in meinem Rücken beben. Wer hatte die erste Welle angestoßen?
Alles in dieser Welt hat sich verändert, nicht aber das Grollen des Meeres, die Weite des Himmels und die Wärme des Lichts auf der Haut. Es gehört zu den Freuden des Lebens, diese unvergänglichen Phänomene einzufangen: die Flammen des Feuers, den Gesang der Vögel, den Wind im Hafer, manchmal ein Lächeln hinter einer Haarsträhne.
Mich umgaben die Motive des atlantischen Westens: verwitterter Granit, Farne und Brombeersträucher, die den Wind zerrissen. Diese zugespitzte Natur war von etwas Jugendlichem erfüllt. Hin und wieder setzte das Lila des Heidekrauts etwas Geziertes in die Matrix aus Jod und Photon. Drei Monate lang würde ich die Heraldik dieses Teppichs nicht verlassen. Ein Hoch auf die Möwe und den Ginster!
Es wurde Nacht, ich blieb bis zwei Uhr wach und dachte an die weißen Arme meiner Freundin. Ich hatte mich aus ihnen losgerissen, aber ich lauschte dem Meer. Die Troubadoure des 12. Jahrhunderts wussten es: Wind und Wellen tragen uns die Erinnerung an die Geliebte zu. Ein Rat an alle mit gebrochenem Herzen: Schlaft an einem Ufer.
Am folgenden Tag weckte mich ein Jäger. Er patrouillierte entlang der Schutzböschung zum castro. Fünf prächtige Jagdhunde, Basset Hounds, scheuchten die Lerchen auf, störten die Uferschnepfen, verfolgten einen verzweifelten Hasen, kläfften, pinkelten, schnüffelten mit sabbernden Lefzen und peitschendem Schwanz. Ja, wirklich: des Menschen bester Freund.
Die Felsvorsprünge
Während der zweitägigen Fahrt Richtung Gijón hangelte ich mich von Kap zu Kap. Ein edles Vorhaben, sich auf den Weg ans Ende der Welt zu machen, um sich auf Felsen zu setzen: zuerst am Cabo da Nave, dem eigentlichen Finis terrae Spaniens, dann am Cabo Ortegal, dem nördlichen Kap der Halbinsel, wo der Atlantik in die Biskaya übergeht, und schließlich am Cabo de Penas in Asturien mit seinen quarzgeäderten kastanienbraunen Felsen. Innehalten und das Meer betrachten: die erste Lektion in einem Brevier der Romantik.
Die keltischen Völker der Donau und der schilfbewachsenen Ebenen, die im 5. Jahrhundert vor Christus von dem ural-steppischen Vorstoß nach Westen vertrieben worden waren, hatten sich auf die Felsvorsprünge zurückgezogen. Hier, in den Logen über dem Ozean, sahen sie die Sonne verenden. Und beteten zu ihr, weil man stets auf die Rückkehr des Ewigen hofft. Ihre Nachfahren trugen heute fahle Blicke. Die Iris ihrer Augen war verblasst. Die Definition des keltischen Geists: am Rand des Abgrunds ausharren.
Diese Menschen, Bewunderer der Dämmerung, waren zum Untergang verdammt gewesen. Es ist nur wenig über sie bekannt. Den Linguisten nach sollen sie ein geeintes Volk gebildet haben. Die Archäologen rekonstruierten Kapitel für Kapitel ihrer Bewegungen, indem sie Wendelringe und Bronzeklingen vorzeigten. Die Universität begeisterte sich für Hügelgräber. Alles andere: ein Konstrukt von Literaten, die vom Mondschein über den Sümpfen fasziniert waren. In der Existenz eines unbestimmten Volks, das an die Ränder der Welt geflohen und unter dem dreifachen Ansturm der römischen Ordnung, der Völkerwanderung und des christlichen Dogmas verschwunden war, fand die romantische Begeisterung einen idealen Gärstoff für ihre Spekulationen. Von den Kelten war viel die Rede, es wurde alles über sie gesagt, aber man wusste nichts.
Blieb eine Landschaft: das Meer und das Ende der Welt. Ein uralter Anblick, den es schon vor dreitausend Jahren gab.
Am Cabo da Nave zog ein Fischkutter im Konfettiwirbel der Möwen seine Netze hoch. Am Cabo Ortegal peitschte der Wind das Meer so heftig, dass der Atlantik ungestraft in die Biskaya überlief. Lichterschwärme flohen über das schwarze, von Windböen getrübte Wasser. Am asturischen Kap pflügte ein Traktor die Felder bis zum Klippenrand. Das Getreide wuchs im Angesicht des Meeres. Man würde die Ernte oberhalb der Boote einbringen. Der Wind legte sich, und ich fand einen den Ginster durchbrechenden Aufschluss zum Schlafen. Die Sonne wärmte den Feldspat.
Diese Stunden an der Biskaya, die Beine über dem Abgrund, über der fünfzig Meter weiter unten tosenden Brandung, inspirierten mich zu einer «Theorie der Felsvorsprünge». Sicher, eher eine Stammtisch-Geopsychologie, aber ich mochte diesen Stammtisch: den Rand einer Felswand vor dem Meer, die exakte Trigonometrie aus Jod, Photon und Stickstoff, eine Kreuzung aus Krake, Seestern und Meeresspinne.
Der Felsvorsprung birgt dreierlei Schätze: Verheißung, Erinnerung und Gegenwart.
Man steht an der Spitze eines westlichen Kaps, ungeduldig des Kommenden harrend (der Verheißung), glücklich über das, was man im Rücken hat (die Erinnerung), fest verwurzelt auf dem Felsen (die Gegenwart).
Davor das Meer. Der Himmel verschmilzt mit ihm. Die Menschen nennen diese Sublimierung «Horizont». Wir blicken auf Gas und träumen von Abenteuern. Die Vögel sind frei, sie kreischen – ironisch. Das Meer raunt: «Dort, jenseits des Blicks, speist eine unerschöpfliche Energie meine Bewegung, für die jede Welle den Beweis liefert.»
Dahinter erstreckt sich das Land mit seinen Kriegen und Festen und mit all jenen, denen wir den Rücken zugekehrt haben. Das ist das Buch der Menschen, dessen Erzählung manche Figuren an den Rand, sprich an den Strand gespült hat.
Darunter die Felswand. Sie verankert die Erde im Meer. Das kristalline oder magmatische Gestein (Schiefer, Basalt, Granit) trotzt der Brandung, dem Krieg der Zeit gegen den Raum. Die Welt wehrt sich gegen den Verschleiß. Der Felsvorsprung fängt den Schock ab. Manchmal reckt sich eine vergessene Felsnadel empor – vor sich die Ferne.
Die Völker der Felszungen – in Galicien, der Bretagne, Irland und Kaledonien – postieren sich mit der ganzen Macht ihrer Erinnerung vor der offenen See. Gefangen in der Geschichte, richten sie ihren Blick auf den Horizont.
Hinter ihnen erstreckt sich die (mit Toten übersäte) Erde. Die Gedanken nehmen Anlauf. Nichts vermag sie aufzuhalten. Vorn: ein Roman. Hinten: die Erzählung. Eine Heimat für offene Menschen, die sich nicht scheuen anzudocken.
Gut befestigt konnten die Halbinseln ablegen.
Ich riss mich los vom Kap. Was ist ein feenhafter Ort? Einer, den man nie verlassen möchte. Hier verhinderte die Topografie jeden weiteren Schritt. Das war die Gesetzmäßigkeit des Felsvorsprungs. Nur er zwingt die Armee zur Umkehr und den Wanderer in die Tiefe.
In Gijón machten Humann und Benoît das Boot seeklar. Wir mussten weiter. Ich würde nun an der keltischen Küste entlangfahren, der Kurve eines Enzephalogramms folgend. Von Asturien bis zum nördlichen Schottland erzählte die Küstenlinie von der Vermählung zwischen Meer, Himmel und Erde.
Das Segeln
Unser in Saint-Malo vertäutes Boot maß neunundvierzig Fuß. Ein weißes bretonisches Segelboot einfachster Bauart, das für die Hochseeschifffahrt ausgerüstet war. In einer Lagune wäre es nicht weiter aufgefallen. Türkisblau, Plastikweiß: die Farben der Langeweile. Zum Glück begaben wir uns auf Meere voller Seetang und Lummen. Das Traurige im Schönen schmerzt die Seele nie. Humann und Benoît hatten das Boot aus Saint-Malo überführt, das bretonische Finis terrae umrundet und die Abkürzung über die Biskaya nach Gijón genommen.
Die Brücke war breit, und der riesige Tisch in der Messe verwandelte unser Gefährt in ein mobiles Büro. Jeder von uns hatte eine eigene Kabine. Wenn man «zusammenleben» will, sollte man «für sich bleiben» können.
Eine steife Brise konnte das Boot mit acht oder zehn Knoten vorantreiben. Wir hatten Bücher an Bord geschafft. Genug, um es bis zu den Shetlandinseln und wieder zurück auszuhalten. Immer ist man versucht, sein Boot in eine schwimmende Bibliothek zu verwandeln. In der Überzeugung, die Überfahrten böten genug Zeit, um Jahre des Rückstands wettzumachen. Amundsen hatte bei seiner Reise zum Südpol Hunderte von Büchern auf die Fram mitgenommen. Doch schon beim ersten Wellenschlag denkt man nicht mehr daran, Kierkegaard zu lesen.
Ich hatte mir eine Bibliothek aus Einhörnern und Rittern zusammengestellt. Victor Hugo hatte ich wegen seiner Lieder der Straßen und Wälder eingepackt, Apollinaire und Aragon wegen der französischen Mysterien, der alten Saturnalien und der Mondreigen. Nietzsche, damit die Sonne fröhlich auf die Gischt brannte. Ich hatte die durch Michel Pastoureaus Analysen erhellten Romane der Artussage dabei. Schöne Lais und fröhliche Bänkellieder. Jaufré Rudel und Michel Zink: den Troubadour und den Gelehrten. Ich hatte die Studien über den Gral dabei – ein nie versiegender Quell. Niemand konnte den Gral definieren: Die Suche bestand im Verstehen. Marie de France reiste wegen der Schönheit der Damen mit. Die englische Dichtung passend zum Tee im Regenschauer: Keats, Shelley, Byron gaben einen Einblick in die britische Pathologie des frühen 19. Jahrhunderts. Hin und wieder mochte ich diese getrockneten Blumen für porzellanzarte Londonerinnen. Jene ängstlichen, vorbildlich erzogenen Dichter hatten zu einer keltischen, magischen und dunklen Legendenbildung beigetragen. Ich hatte Yeats dabei für den unverständlichen geistigen Bocage der Iren und Walter Scott für die schottischen Ankerplätze. Gedichte und Romane liefern den Schlüssel zu unseren Träumen, und sie sind Landkarten: bessere als der Guide Michelin. Ich hatte Simenon dabei, denn – schließlich soll man es nicht übertreiben – nach dem wilden Ritt durch das edle Dickicht freut man sich auch wieder an der klebrigen Vertrautheit der Bahnhöfe des Nordens. Selbstverständlich hatten wir in der Messe auch ein paar todlangweilige Geschichten der keltischen Zivilisation und etliche Studien über die bretonische Mythologie untergebracht. Im Allgemeinen verwandten die Historiker ein Drittel ihres Werks darauf, die Arbeiten ihrer Kollegen auseinanderzunehmen, bevor sie einräumten, dass das Keltentum vor allem eine Erfindung der Romantik war.
Wir waren gerüstet, um vor den Küsten des atlantischen Europas zu kreuzen, jenes durch das Wasser zerklüftete Land. Ehrlich gesagt erschien es uns in den folgenden Wochen sinnvoller, nach Klippen Ausschau zu halten, statt uns in die Bücher Jean Markales zu versenken.
Wir legten ab. Die Überquerung der Biskaya dauerte drei Tage. Wir steuerten Audierne an, genau im Norden. 360° – ein schönes Ziel im Leben. Richtung Norden war alles leichter. Das sich wölbende Meer war fischreich. Delfine streiften den Rumpf. Escortgirls – glatt, hell, schwungvoll. Und untreu: Sobald sich ein anderes Boot näherte, waren sie auf und davon.
Der Wind blies aus Nordost. Wir fuhren mit fünfundzwanzig Knoten und waren glücklich.
Segeln bedeutet, den Kurs, die Geschwindigkeit und die Krängung zu regulieren, um die Ataraxie zu erreichen. Im Idealfall genügen ein paar winzige Handgriffe. Wenn es für mehrere Sekunden gelingt, keinen Finger zu rühren, ist das ein Triumph. Das Boot schießt mit voller Fahrt dahin, perfekt ausbalanciert. Meer, Mensch und Maschine sind in Harmonie. Die Zeit steht still. Die Welt ist eine Harfe (eine keltische, of course).
Das Segeln erfüllte den Traum Heraklits! Energie aus der Verbindung von Gegensätzen gewinnen. Anfangs widerspricht sich alles: Das Gewicht drückt den Rumpf nach unten. Der Schub wiederum richtet ihn auf. Die Krängung nimmt zu, der Wind verliert an Kraft und gibt schließlich ganz nach. Das Meer bremst. Die Welle reißt mit. Der Bug schlägt auf die Wasseroberfläche. Plötzlich ist das Instru-ment gestimmt: Die Spannungen lösen sich. Für einen Moment harrt der Seefahrer still aus, glücklich über die Gleichung. An einer bestimmten Stelle des Boots etwas unterhalb der Brücke laufen die Kräfte zusammen. Diese Schnittstelle der Druck- und Schubkräfte bildet den perfekten Energiepunkt. Nur er ist belebt. Er bewegt die Masse. Ein feenhafter Augenblick, in dem die Vollkommenheit der Dinge jede weitere Bewegung untersagt. Wann erreichen wir nur diesen Punkt?
In dieser Nacht hatte ich Wache. Segensreiche Stunden zwischen ein und vier Uhr morgens. Der orangefarbene, weiche Mond sank hinter den Horizont. Die Sterne funkelten. Der Kosmos war erfunden worden, damit sich die Seeleute nicht verirrten. «Das betrachtete Meer ist eine Träumerei.» Meine Güte, Victor! Eine Träumerei, die es durch Peilungen und Manöver zu durchkreuzen galt.
Wenn sich alles fügt, ähnelt der wachende Mann – die Stange in der Hand, die Segel eingestellt – einer Skulptur. Nicht eine Bewegung, kein Wort: der Snobismus des Seefahrers. Das Segelschiff schießt dahin, «bei 35° am Wind». Die Sterne flackern. Ein einziger zählt: für die Ausrichtung. Das Kielwasser klingt sahneweich. Kaum ein Tau, das klackert. Der Seemann: «Ich bin allein, ich wache, mir sind Freunde anvertraut, die im Rumpf schlafen: Was für ein Vertrauen! Welcher Leichtsinn! Wie unrecht sie doch haben!» Hugo hingegen hatte recht, der Seemann beginnt zu träumen: Er hält sich für den «Hüter des Kosmos», den «Wächter des Universums» mit all seiner schlammigen Ausrüstung. Die Nächte auf dem Meer machen gesprächig.
Ich träumte viel. Warum waren die Feen meiner Kindheit verbrannt? Die Technik hatte die Welt erobert, die Massen wuchsen, der Handel gab den Ton an. Überall Geräusche, Vernunft, Kalkül, Wut. Die Feen waren vor dieser Verschwörung geflohen. Sie hatten sich in die Stille verkrochen.
Frühmorgens flog ein Überwachungsflugzeug drei Mal über uns hinweg. Das Dröhnen zerschmetterte meine Träume. Konnten die Beamten erkennen, dass wir außer der Liebe zum Wind nichts zu verzollen hatten?
Wir wurden nicht gefragt. Und Land war in Sicht.
IIIn der Bretagne
Möwe und Stechginster
Eine Mole, Häuser wie Zuckerwürfel, runde Felsen und ein bronzegrüner, mit Kreuzen gespickter Schild: Das war die Bretagne.
Wir legten in der Anse du Loc’h an, westlich von Primelin an der Südküste. Dreieinhalb Tage von Asturien entfernt. Ankern, Zu-Wasser-Lassen, Anlegen. Der Anker, das Motorboot, der Betondamm: tägliche Fingerübungen für die kommenden Monate. Ich ging von Bord, um auf dem Felsvorsprung zu biwakieren. Würden die Feen, wenn ich auf einem Balkon des Westens schliefe, wieder in Erscheinung treten?
Ich lief drei Stunden lang. Zwölf Kilometer bis zur Pointe du Raz. Die Gräser zitterten im Abend. «Das Leben ist Hafer, und der Wind durchquert ihn». Ein vollkommener Vers. Er besang die weiße Sanftheit. Ich wiederholte ihn, um mich anzutreiben. Das Gras ist von zarter Kraft. Die Welt brennt. Das Korn wächst auf der Asche. Unter der Erde werden wir es nähren.
Unterhalb des Weges leisteten die gepeinigten Steilfelsen Widerstand. Dem Meer wird der Mund wässrig, wenn es die Erde verschlingt. Das Wasser zerklüftete die Felsen, aber die Luft war eine Liebkosung. Die Bretagne: ein weicher Körper auf geschundenen Füßen. Die Zeit verstrich, ich lief. Der bretonische Weg, ein Band, das die Zeit durchtrennt. Die Heide malte lilafarbene Flecken ins Gold des Ginsters. Subtile Farbflächen von Renaissancemalern. Gelb, Grün und Violett. Ein paar glückselige Häuser genossen die letzten Strahlen. Dachfenster mit Blick aufs Meer, hinter den Hecken fette Autos. Liberale Mütter waren damit beschäftigt, Kinder in gestreiften Schlafanzügen ins Bett zu bringen.
Ich dachte an Hermann Hesses Knulp, den Landstreicher, der sorglose Tage auf Wanderschaft verbracht hatte. Ein Leben mit den Feen! Am Ende starb er, nachts, an einen Baum gelehnt. Von oben sah er die Lichter im Dorf angehen und dachte etwas wie: «Sie sind glücklich in ihren Häusern, und ich werde einsam sterben.» Auf welcher Seite des Fensters soll man sterben? Frei und einsam im Wald? Oder aber voller Verdruss im Kreise seiner lieben Kinder?
Ich erreichte das Semaphor, bevor es Nacht wurde. Solange man kann, sollte man in diesem Leben westwärts ziehen. Ich ging an der Statue der «Mutter Gottes der Schiffbrüchigen» vorüber. Was für ein Name! Sie könnte sich der gesamten Menschheit annehmen!