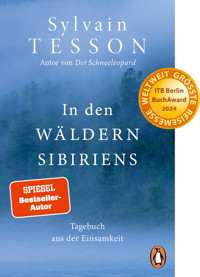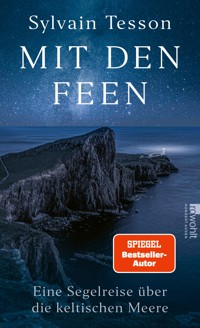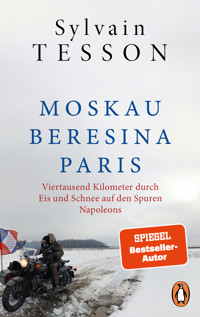9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Albrecht Knaus Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Vom Autor des Bestsellers »Der Schneeleopard«: 1300 Kilometer auf alten Wegen zu Fuß durch Frankreich auf der Suche nach Stille und Abgeschiedenheit in unberührter Landschaft
Verfilmt mit Oscar-Preisträger Jean Dujardin unter dem Titel »Auf dem Weg«.
Mitten in Europa existiert es noch: unberührtes verzaubertes Land. Das verborgene, urtümliche Frankreich durchwandert der Abenteurer Sylvain Tesson vier Monate lang, von den südlichen Alpen über das Zentralmassiv bis zu den sturmumtosten Klippen von La Hague.
Nach einem schlimmen Unfall wählt er das Laufen anstelle der Reha-Klinik, biwakiert im Wald und lässt sich von Steinkäuzen in den Schlaf singen, unterhält sich mit wortkargen Landbewohnern und bahnt sich durch dorniges Gestrüpp einen Weg zurück ins Leben.
Sylvain Tesson ist Gewinner des ITB BuchAward 2024 in der Kategorie »Lifetime Award« für sein bisheriges Werk, insbesondere für die Titel »In den Wäldern Sibiriens« und »Auf versunkenen Wegen«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Das Buch
Eine Einladung, sich aus dem Staub zu machen.
Mitten in Europa existiert es noch: unberührtes, verzaubertes Land. Sylvain Tesson durchwandert Frankreich, vier Monate lang, vom Mercantour bis in die Normandie. Nach einem schlimmen Unfall wählt er das Laufen anstelle der Reha-Klinik. Die Sehnsucht nach Stille und Abgeschiedenheit führt ihn durch verlassene Dörfer und Landschaften, auf vergessenen Pfaden und alten Wegen, die keiner mehr benutzt. Vielleicht nur die Wölfe.
»Bisher las man Tesson, um in die Ferne zu schweifen. Jetzt kann man mit ihm die eigene Heimat erkunden.« Paris Match
Der Autor
Sylvain Tesson, geboren 1972 in Paris, ist Schriftsteller, Filmemacher und ein großer Reisender. Er fuhr mit dem Fahrrad um die Welt und unternahm monatelange Expeditionen – durch den Himalaya, von Sibirien nach Indien zu Fuß und immer wieder nach Zentralasien. Für seine Reisebeschreibungen und Essays wurde er mit dem Prix Goncourt de la nouvelle und dem Prix Médicis ausgezeichnet. Zuletzt erschienen In den Wäldern Sibiriens und Napoleon und ich – Eine abenteuerliche Reise von Moskau nach Paris.
Sylvain Tesson
AUF VERSUNKENEN WEGEN
Aus dem Französischen vonHolger Fock und Sabine Müller
Knaus
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Das Original erschien 2016 unter dem Titel »Sur les chemins noirs« bei Éditions Gallimard, Paris.
Copyright der Originalausgabe © 2016 Éditions Gallimard, Paris
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2017 Albrecht Knaus Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt
Covermotiv: © Ebru Sidar / Arcangel
Fotos Vor- und Nachsatz: © Thomas Goisque
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-21729-7V004
www.knaus-verlag.de
für L.
Ich will nach draußen gehen; alter Kummer sollheute vergessen sein, denn die Luft ist kühl und ruhig,die Hügel sind hoch und erstrecken sich bis zum Himmel(…) und die Waldwiesen sind so still wie der Friedhof;mit dem Tau kann ich das Fieber von meiner Stirnwaschen, und dann werde ich nicht länger unglücklich sein.
THOMAS DE QUINCEYBekenntnisse eines englischen Opiumessers
Karte der »hyperländlichen« Regionen Frankreichs nach der vom Ministerium für Wohnen und Regionalentwicklung veröffentlichten Regierungsstudie zur Hyper-ruralité. Geografische Abgeschiedenheit, geringe Bevölkerungsdichte, fehlende Infrastruktur, ein geringes Angebot an Dienstleistungen und fehlende finanzielle Mittel – das sind die Kriterien, nach denen 250 »Lebensräume« (in der Karte dunkel abgebildet) als hyperländlich eingestuft wurden. © Inra UMR CESAER / M. Hilal.
Mein Wanderweg vom 24. August bis zum 8. November.
Inhalt
Vorwort
1. Misslungener Anfang
2. Von Ruinen und Brombeergestrüpp
3. Versunkene Pfade
4. Die dunklen Schatten
5. Meerwärts
Bibliografischer Hinweis
Vorwort
Es war ein hartes Jahr gewesen. Lange hatten die Götter unsere Familie begünstigt, uns mit ihrem Segen überschüttet. Vielleicht beugen sie sich über einige von uns wie Märchenfeen? Bis ihr Lächeln zur Grimasse erstarrt.
Wir ahnten nichts davon, aber wir genossen die Güte des Schicksals ganz ungeniert in vollen Zügen. Das enthob uns jeglicher Dankbarkeit, zwang uns jedoch zu einer Leichtigkeit, die auf Dauer ermüdete. Das Leben glich einem Gemälde von Bonnard. Sonne auf weißen Jacken, Schüsseln auf Tischtüchern, Fenster, die zum Obstgarten hin offen standen, wo Kinder herumtollten. Draußen rauschten die Apfelbäume: Es war die ideale Kulisse für einen kräftigen Keulenschlag.
Er ließ nicht lange auf sich warten. Meine Schwestern, meine Neffen, alle waren schon von einem jener Übel getroffen worden, von denen es in den mittelalterlichen Sagen heißt, sie schlichen sich durch die Stadtmauern: Ein Schatten kriecht durch die Gassen, gelangt ins Innere der Stadt, erobert den Wehrturm. Die Pest rückte an.
Meine Mutter starb, wie sie gelebt hatte, sie sprang plötzlich ab; und ich hatte mir im Rausch die Fresse demoliert, als ich auf einem Dach den Clown spielte. Ich war nachts von der Traufe gestürzt und hart auf dem Boden aufgeschlagen. Acht Meter hatten genügt, um mir die Rippen, die Wirbel, den Schädel zu brechen. Ich war auf einem Knochenhaufen gelandet. Ich bereute diesen Sturz lange, denn bis dahin hatte ich über ein körperliches Räderwerk verfügt, das es mir ermöglicht hatte, volle Kanne zu leben. Für mich glich ein edles Leben dem Armaturenbrett eines sibirischen Lastwagens: Alle Warnlichter blinken rot, aber der Motor bahnt sich seinen Weg und jeder Mahner, der so blöd ist, sich winkend in den Weg zu stellen, um vor dem Unglück zu warnen, wird plattgemacht. Meine strotzende Gesundheit? Sie führte zur Katastrophe, ich war auf acht Metern fünfzig Jahre gealtert.
Man hatte meine Knochen eingesammelt. Ich war ins Leben zurückgekehrt. Wäre ich gestorben, wäre mir nicht einmal die Gnade zuteilgeworden, meine Mutter im Himmel zu sehen. Hundert Milliarden Menschen sind auf die Welt gekommen, seit Homo sapiens zu dem geworden ist, was wir sind. Glaubt jemand ernsthaft, er könne in dem himmlischen Termitenhaufen voller Engelchen einen Angehörigen wiederfinden?
Im Krankenhaus meinte man es rundum gut mit mir. Das französische Gesundheitswesen hat die wunderbare Eigenschaft, dass es einen niemals zur Rechenschaft zieht. In einer antiken, auf ethischen Grundsätzen beruhenden Gesellschaft müsste man sich einem Schluckspecht nicht mit der gleichen Aufmerksamkeit widmen wie einem wirklich Bedürftigen. Doch man hatte mir nichts vorgeworfen, man hatte mich gerettet. Spitzenmedizin, die Fürsorglichkeit der Krankenschwestern, die Liebe meiner Nächsten, die Lektüre des alten Punks Villon, das alles hatte zu meiner Genesung beigetragen. Vor allem aber die Heiligkeit eines Wesens, das jeden Tag an mein Bett kam, als ob Männer meines Schlages tierische Treue verdienten. Durchs Fenster hatte mir ein Baum seine vibrierende Lebensfreude eingeflößt. Vier Monate später war ich draußen, hinkend, mit Schmerzen am ganzen Leib und dem Blut eines anderen in den Adern, mit eingedrücktem Schädel, einem Bauch, in dem sich nichts mehr bewegte, vernarbten Lungen, die Wirbelsäule voller Schrauben und mit schiefem Gesicht. Es würde nicht mehr so richtig abgehen in meinem Leben.
Jetzt musste ich den Eid erfüllen, den ich in jammervollen Nächten geleistet hatte. Eingegipst im Bett, hatte ich mir nahezu laut geschworen: »Wenn ich jemals hier rauskomme, laufe ich zu Fuß durch Frankreich.« Ich hatte mir vorgestellt, über steinige Pfade zu wandern! Hatte von Nächten unter freiem Himmel geträumt, davon, mir wie ein Landstreicher meinen Weg zu bahnen. Der Traum verflüchtigte sich jedes Mal, wenn die Tür aufging: Es war Zeit für den Brei.
Ein Arzt hatte mir gesagt: »Im nächsten Sommer können Sie einen Aufenthalt in einem Reha-Zentrum einplanen.« Ich wollte lieber auf Waldwegen erlangen, was mir angeblich nur Laufbänder geben konnten: Kraft.
Der nächste Sommer brach an, es war Zeit, meine Schuld zu begleichen. Wandernd würde ich meine Gedanken schweifen lassen und das Andenken an meine Mutter pflegen. Ihr Phantom würde mich begleiten, wenn ich monatelang über Stock und Stein trottete. Nicht auf irgendwelchen Pfaden: Ich wollte auf versteckten, von Hecken gesäumten Wegen durch das dornige Unterholz steigen und auf Saumpfaden zwischen verlassenen Dörfern spazieren. Es gab noch geografische Querverbindungen, vorausgesetzt, man las die Karte, nahm Umwege in Kauf und war bereit, sich durch die Büsche zu schlagen. Abseits der Straßen existierte ein Frankreich im Dunkeln, das geschützt war vor dem Getöse, verschont von den Maßnahmen zur Raumordnung, die dem Geheimnisvollen keinen Platz lassen. Ein ländlicher Raum der Stille, der Vogelbeere und der Schleiereule. Die Ärzte mit ihrem Politbüro-Vokabular empfahlen mir, mich zu »rehabilitieren«. Mich wieder in das berufliche und gesellschaftliche Leben einzugliedern. Ich machte mich erst einmal vom Acker.
Ich hätte ein Dutzend Gründe anführen können, warum ich durchs Land streifen wollte. Zum Beispiel, um mir einzuimpfen, dass ich zwanzig Jahre damit zugebracht hatte, die Welt zwischen Ulan-Bator und Valparaiso abzugrasen und dass es absurd war, Samarkand zu kennen, wo es doch das Indre-et-Loire gab. Der wahre Grund für diese Flucht über die Felder stand jedoch auf einem zusammengeknüllten Zettel, den ich tief unten in meinem Rucksack aufbewahrte.
1Misslungener Anfang
Im Zug
Warum fuhr der TGV mit solcher Geschwindigkeit? Wozu so schnell reisen? Die Absurdität, eine Landschaft mit 300 Stundenkilometern an sich vorbeifliegen zu sehen, durch die man anschließend monatelang zu Fuß wieder zurückwandert! Während die Geschwindigkeit die Landschaft verjagte, dachte ich an die Menschen, die ich liebte, und an sie zu denken fiel mir erheblich leichter, als ihnen meine Liebe zu zeigen. Tatsächlich zog ich es vor, an sie zu denken, statt sie zu besuchen. Sie wollten immer, »dass wir uns sehen«, als wäre das ein Gebot, wohingegen ich in Gedanken auf so schöne Weise bei ihnen sein konnte.
24. August, an der italienischen Grenze
Es war mein erster Tagesmarsch, ich startete am Bahnhof von Tende, wohin mich der Zug aus Nizza gebracht hatte. Mit schwachem Schritt stieg ich zum Pass hinauf. Strohgelbe Gräser streichelten die Abendluft. Ihre Verbeugungen waren ein erstes Bild von Zuneigung, von unverfälschter Schönheit. Nach diesen trostlosen Monaten stellten selbst die kleinen, in der Sonne tanzenden Mücken ein glückliches Vorzeichen dar. Ihre Wolke im goldwarmen Licht setzte ein Zeichen in der Abgeschiedenheit. Man hätte glauben können, sie bildeten einen Schriftzug. Wollten sie uns vielleicht sagen: »Hört auf mit eurem totalen Krieg gegen die Natur!«
Kiefern standen streng am Wegrand. Ihre Wurzeln umschlossen kleine Erdhügel – der Baum sieht oft so aus, als wisse er genau, was sein gutes Recht ist. Mit weitaus kühnerem Schritt als meinem kam mir ein Schäfer entgegen; knorrig tauchte er in einer Kurve auf, mit dem Tempo eines Helden von Giono. Ein Mann aus der Gegend. Ich sah noch immer aus wie ein Kerl aus einer anderen Welt.
»Tag, gehst du in die Stadt?«, fragte ich.
»Nein«, antwortete er.
»Ist die Herde da oben?«
»Nein.«
»Kommst du zum Schlafen herunter?«
»Nein.«
Ich würde mir abgewöhnen müssen, wie bei Städtern üblich ein Gespräch anbahnen zu wollen.
Der Col de Tende ist ein Bergsattel auf dem Gebirgskamm des Nationalparks Mercantour. Er trennt Italien von Frankreich. Ich hatte beschlossen, in der südöstlichen Ecke des Landes zu beginnen und bis zur Nordspitze der Halbinsel Cotentin zu wandern. Bei den Russen ist es Tradition, sich vor Antritt einer Reise einige Sekunden auf einen Stuhl, einen Koffer oder den ersten Stein am Weg zu setzen. Sie schaffen eine Leere in sich, denken an die Menschen, die sie verlassen, sorgen sich, ob sie den Gashahn zugedreht haben, die Leiche versteckt – was weiß ich. Ich setzte mich also hin wie ein Russkoff und lehnte den Rücken an eine kleine, hölzerne Kapelle, in der eine Jungfrau mit Blick auf die italienische Seite Andacht hielt. Dann stand ich entschlossen auf und machte mich auf den Weg.
Für meine beschädigten Augen sahen die Kühe an den Bergflanken aus wie runde Steine, die auf die Hänge gerollt waren. Die struppigen Wipfel der Schwarztannen erinnerten an die Hügel, die mit ihren Zinnen die Horizonte des blauen Yunnan in China säumen, wo ich mit zwanzig gewesen war. Doch ich verscheuchte diese Gedanken in der Abendluft. Dieser Wust von Ähnlichkeiten war mir eine Last.
Hatte ich mir nicht geschworen, mich einige Monate lang an Pessoas Gebot aus seinen heidnischen Gedichten zu halten:
Von der Pflanze sag’ ich: »Es ist eine Pflanze«,
Von mir sag’ ich: »Ich bin ich.«
Mehr sage ich nicht. Was gäbe es weiter zu sagen?
Oh, ich hatte den Verdacht, dass Pessoa, der Unruhige, seinem Vorhaben niemals treu gewesen war. Wie kann man glauben, dass es ihm gelungen wäre, sich mit der Welt zufriedenzugeben? Man schreibt solche Manifeste, und dann bringt man sein Leben damit zu, die eigenen Theorien zu verraten. In den Wochen dieser Wanderschaft wollte ich versuchen, den kristallenen Blick ohne die Gaze der Analyse und den Filter der Erinnerungen auf die Dinge zu lenken. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich gelernt, aus der Natur und den Lebewesen ein Notizblatt zu machen, auf dem ich meine Eindrücke festhielt. Jetzt war es höchste Zeit für mich zu lernen, die Sonne zu genießen, ohne Madame de Staël herbeizurufen, den Wind, ohne Hölderlin zu rezitieren, und den kühlen Wein, ohne Falstaff auf dem Grund des Glases plätschern zu hören. Kurz, zu leben wie einer dieser Hunde: Mit heraushängender Zunge genießen sie die Ruhe und sehen dabei aus, als würden sie gleich den Himmel, den Wald oder das Meer und sogar den hereinbrechenden Abend verschlingen. Das Vorhaben war, wohlgemerkt, zum Scheitern verurteilt. Ein Europäer kann nicht aus seiner Haut.
In zweitausend Meter Höhe erblickte ich eine flache, mit Gras dicht bewachsene Stelle bei einem Betonbunker. Ich zündete ein Feuer an. Das Holz war feucht, und ich blies so sehr in die Glut, dass sich in meinem eingedrückten Kopf alles drehte. Die Wärme lockte fette Spinnen aus ihren Verstecken; sie machten mir keine Angst mehr, ich hatte viele aus meinen Augenhöhlen fliehen sehen. Das Biwakzelt schützte mich wenig vor den nassen Wolken, die die Dunkelheit ausspuckte. Ich war eingeschüchtert, es war die erste Nacht, die ich seit meinem Sturz im Freien verbrachte. Ich spürte wieder den Boden unter mir – dieses Mal weniger brutal. Endlich kehrte ich in meinen geliebten Garten zurück: ein Wald unter dem Sternenhimmel. Die Luft war kühl, der Boden uneben, das Gelände abschüssig: Es fing gut an. Nächte im Freien müssen, vorausgesetzt, man findet Gefallen an ihnen und sie kommen nicht unverhofft, an der Tafel der Eroberungen als Krönung der Marschtage angezeigt werden. Sie nehmen den Deckel von uns, erweitern die Träume. Rief man jetzt nicht überall in Europas Städten nach Luft? Luft! Als ich ein Jahr zuvor im Krankenhaus lag, hatte ich davon geträumt, mich unter Tannen auszustrecken. Jetzt kehrte die Zeit des Biwakierens zurück.
25. August, im Roya-Tal
Die Nacht war merkwürdig gewesen. Es hatte gegen elf Uhr angefangen. Zwei- oder dreihundert Meter entfernt ertönte ein Schuss, dann ein zweiter, dann folgten Detonationen im Minutenabstand und hörten nicht auf. Manchmal schmolz der Abstand auf dreißig Sekunden. Wer schoss da in der Nacht? Ein verrückter orthodoxer Mönch, der etwas gegen die Dunkelheit hatte?
Während ich die ersten Schritte machte, dachte ich, dass ich ins normale Leben zurückkehren würde, wenn mir die Durchquerung Frankreichs gelänge. Sollte ich es nicht schaffen, würde ich meine Niederlage als Rückfall ansehen. Die Aussicht auf Genesung lag in weiter Ferne! So weit entfernt wie das Cotentin! Ich setzte auf die Bewegung, sie sollte mein Heil sein.
Am Morgen entdeckte ich in einer Mulde eine Schäferei. Eine faltenlose, rosige Frau mit den dicken Backen einer Flämin und nackten Bizepsen machte sich auf der Schwelle zu schaffen. Sie war einem Bild von Bruegel entsprungen und kam vom Melken.
»Ich habe heute Nacht Schüsse gehört«, sagte ich.
»Das ist eine mit Gas betriebene Schießanlage, um den Wolf zu vertreiben. Peng! Peng!«, meinte sie.
»Ach, ja?«
»Was willst du?«, fragte sie.
»Was es gibt.«
»Käse aus Kuhmilch. Trocken.«
»Dreihundert Gramm. Macht es den Wölfen Angst?«
»Möglich. Drei Euro.«
Die Dinge waren wirklich schiefgelaufen. Die Menschen hatten sich stark vermehrt, sie hatten sich in der Welt ausgebreitet, hatten den Boden zementiert, die Täler in Beschlag genommen, die Hochebenen besiedelt, die Götter getötet, die wilden Tiere niedergemetzelt. Sie hatten über Generationen hinweg ihre Kinder und Herden hochgezüchteter Wiederkäuer auf das Land losgelassen. Eines Tages vor dreißig Jahren kehrte der Wolf über die Abruzzen in den Nationalpark Mercantour zurück. Ein paar Klugscheißer hatten sich in den Kopf gesetzt, ihn zu schützen. Die Schäfer waren darüber wütend, denn die Anwesenheit eines Raubtiers zwang sie, ihre Schafe besser zu hüten. »Die Freunde des Wolfs schlafen in den Städten im Warmen«, hatten sich die Schafzüchter beklagt. Jetzt mussten auf den Almen Maschinen installiert werden, die Schüsse nachahmten, um die Wiederkäuer vor dem in seinen Lebensraum zurückgekehrten Raubtier zu schützen. Wenn ich ein Wolf wäre, würde ich denken: »Der Fortschritt? Eine Farce!«
26. August, Abstieg aus dem Nationalpark Mercantour
Es wurde bereits dunkel und ich schleppte mich weiter. Im Augenblick lief es nicht besonders gut. Drei Tage über Geröll, und mein Rücken war schon Kleinholz. »Was bringt es, diesen zerfledderten Leib bis in den Norden eines ruinierten Landes zu schleppen?«, fragte ich mich, während ich dabei zusah, wie zwei Gämsen, eine Mutter und ihr Sohn, in einem Felsenmeer herumtollten. Gab es außer mir noch viele, die Tiere beneideten? Das Kitz war mir hinter einem Fels vor die Beine gerannt. Es hatte ein oder zwei Sekunden gezögert. Im 18. Jahrhundert kamen auf den unbewohnten Inseln die wilden Tiere zu den ersten Entdeckern und fraßen ihnen aus der Hand, bevor sie zur Feier ihrer Begegnung mit dem Menschen die Muskete kennenlernten. Der kleine Gamsbock hatte allerdings einen heilsamen Befehl befolgt und auf dem Absatz kehrtgemacht, denn er hatte verstanden, dass ich kein empfehlenswerter Umgang war.
Ich hatte einen Wasserfall überquert, der in Kaskaden durch das Moos talwärts floss, war an einem grünen See entlanggegangen und wieder die Hänge hinaufgestiegen. Ich passierte nördlich den Mont Bégo, den die Geister der vorgeschichtlichen Zeit im Stich gelassen hatten, und die Lektüre von Knulp auf den Hügeln demoralisierte mich vollends. Hermann Hesse ließ seinen Vagabunden durch liebliche deutsche Landschaften spazieren, die der Herbst in mildes Licht tauchte. Gewiss, der gute Knulp starb zuletzt einsam, doch zumindest konnte er, bevor er den hohen Preis für seine Ästhetik der Verantwortungslosigkeit bezahlte, den Dorfbewohnern die Erhabenheit eines verbummelten Lebens demonstrieren. Wenn ich traumverloren wandern wollte, begleitet von wohltuenden Gedanken, bräuchte ich ein von Waldwegen durchzogenes Gelände, in dem von Zeit zu Zeit ein Gasthaus mit schäumenden Bierkrügen auf den Holztischen auftauchte.
Vom Pas de Colomb aus sah man in einer Talmulde die kleine Kirche der Madone de Fenestre. Stätten des Marienkults finden sich in Frankreich überall in Höhlen und an Quellen. Die Jungfrau hat alle ungewöhnlichen Formationen des Landschaftsbilds in Beschlag genommen. Ich kenne sogar eine »Notre-Dame des Falaises« (»Unsere-liebe-Frau-von-den-Klippen«) an den Flanken des Cap Canaille, zwischen Marseille und Toulon. Der Grund dafür ist die Weiternutzung der alten heidnischen Kultstätten durch den Katholizismus, eine Möglichkeit, mit dem Geist des Orts in Verbindung zu bleiben.
Ich ging ein wenig Schatten tanken unter den Gewölben der Kirche. An ihren Wänden hingen die Votivgaben von Alpinisten, die nach einem Absturz gerettet wurden. Das Seil hatte sie gehalten, doch es gefiel ihnen, an himmlische Hilfe zu glauben. Links vom Eingang stand eine neu errichtete Stele zur Erinnerung an Hervé Gourdel, den Bergführer und Sohn der Vésubie, dem fanatische Muslime ein Jahr zuvor in der Kabylei die Kehle durchgeschnitten hatten. Von meinem Krankenhausbett aus hatte ich großen Anteil an seinem Martyrium genommen. Ich hatte mir den Bergsteiger vorgestellt, in Fesseln, mit verhülltem Kopf, den Weisungen des Korans ausgeliefert. Ich hatte mich Gourdel brüderlich verbunden gefühlt. An diesem Abend kam die Erinnerung an ihn wieder hoch.
Eine Tafel an einer Säule in der Kirche erinnerte an den Tod von Templern durch Enthauptung. War es das Werk der Sarazenen gewesen? Sie hatten im 10. Jahrhundert an dieser Stelle bei der Verwüstung der Provence einen Altarraum zerstört.
Als ich mich an diesem Abend in mein Leintuch rollte, grüßte ich Gourdel, bevor sich die Gedanken in Träume verwandelten. Eine Kuh, die mit anderen Dingen beschäftigt war, muhte ihr eigenes Requiem in die Almnacht.
2Von Ruinen und Brombeergestrüpp
27. August, die Vésubie und die Tinée
Die Täler dehnten sich, die Dörfer zogen vorbei. Auf den Wegen über den Kalkstein der Haute-Provence rollten die Kiesel leichter weg. Eines Abends in Saint-Dalmas, als ich die Stützen knarren hörte, die man mir in den Rücken eingepflanzt hatte, steuerte ich eine Herberge an. Oh, wie gerne hätte ich in einer Zeit gelebt, in der dieser kleine Dialog möglich gewesen wäre:
»Haben Sie für mich ein Dach und Stroh?«
»Wir geben dir Brot und Wein, wenn du uns bei der Heuernte hilfst.«
Man musste sich wirklich sämtliche Knochen gebrochen haben, um von solchen Gesprächen zu träumen. Wir lebten nicht mehr in Knulps Zeiten. Armer Junge, dachte ich, als die Dame mit dem langen braunen Haar mir auf der Schwelle erklärte: »Wir hätten Ihnen gerne den Wandertarif gegeben, aber wir haben keine behördliche Genehmigung.« Ich würde einfallsreich sein müssen, um der Unterwerfung des Landes unter die Verwaltungsgesetze monatelang zu entgehen. Würde ich innerhalb der Landesgrenzen frei zugängliche Gebiete finden, die von der Politik der Planungsbehörden verschont geblieben waren?
Ein früherer Premierminister der Fünften Republik (Jean-Marc Ayrault in der sogenannten Anatole-France-Periode von 2012 bis 2014) hatte in seiner Regierungszeit einen Bericht über die Raumordnung der ländlichen Gebiete Frankreichs angefordert. Der Text war unter dem Mandat eines anderen Ministers (Manuel Valls in der Offenbach-Periode) und unter dem Titel Hyper-ruralité (»Hyperländlicher Raum«) veröffentlicht worden. Ein Trupp von Experten, also Spezialisten des Unüberprüfbaren, gelangte zu der Auffassung, dass etwa dreißig französische Départements extrem ländliche Strukturen aufwiesen. Für diese Experten war Ländlichkeit keine Gnade, sondern ein Fluch: Der Bericht beklagte die Zurückgebliebenheit dieser Landstriche, das fehlende elektronische Datennetz, die unzureichende Anbindung an das Verkehrsnetz, die geringe Dichte an städtischen Einrichtungen, das Fehlen großer Einkaufszentren und den erschwerten Zugang zu Ämtern und Behörden. Was wir armselige, romantische Dussel für einen Schlüssel zum Paradies auf Erden hielten – die Verwilderung, die Erhaltung der Natur, die Abgeschiedenheit –, wurde auf diesen Seiten zum Kriterium für die Unterentwicklung.
Der Bericht gab sich zuversichtlich, die Autoren waren vertrauensvolle Propheten: »Mut, Bürger vom Land! Wir kommen.« Bald würde dank des Staates ein warmer Regen der Modernität über dem Brachland niedergehen. Das Wifi würde aus Kuhbauern normgerechte Franzosen machen. Statt Über Felder und Strände könnte sich ein künftiger Flaubert, der diese weiten Landstriche bereiste, möglicherweise zu einem Über ZUP und ZAC aufschwingen (in der französischen Politik Abkürzungen für Zonen vorrangiger Urbanisierung: ZUP, und Zonen koordinierter Raumplanung: ZAC). Die Nutznießer dieser Raumplanung würden gute Soldaten, ersetzbare Menschen abgeben, die gegen »radikale Wählerstimmen«, wie der Bericht sie nannte, immun wären. Denn das war der Hintergedanke: eine psychische Konformität dieses unmöglichen Volks zu gewährleisten.
Zur Liste der Maßnahmen, die in dem Bericht erwähnt wurden, gehörten Dinge wie das Recht auf Verstetigung wirksamer Experimente und das Gebot, den Finanzausgleich zwischen den Gemeinden zu modernisieren und die Bildung neuer vertraglicher Allianzen anzuregen. Was war das für eine seltsame Sprache? Womit verdienten die Autoren solcher Sätze ihren Lebensunterhalt? Wussten sie, welche Freude es bereitete, sich nach einem Schluck Savoyer Wein den Mund am Revers der Jacke abzuwischen, welch ein Genuss es war, im Gras zu liegen, wenn der Umriss eines Vogels den Himmel aufheiterte?
Der Text war mit Karten illustriert. Die hyperländlichen Départements, zu deren Unterstützung die Regierung sich aufschwingen wollte (in ihren Worten: die Intelligenz des Staates im Dienst des hyperländlichen Raums – diese Troubadoure!), belegten eine großflächige schwarze Zone. Sie streifte die südlichen Alpen, zog sich hinauf zu den Vogesen und den Ardennen und erstreckte sich dabei über das gesamte Zentralmassiv und etliche benachbarte Départements aus der Region Haute-Loire. Einige Wochen später erfuhr ich: Vom Mercantour bis ins Lozère entsprachen diese Gebiete dem Weg des Wolfs nach seiner Rückkehr nach Frankreich. Nicht dumm, der Wolf! Seine Ruhe ging ihm über alles. Er griff den Menschen nicht nur nicht an, er versuchte, ihm aus dem Weg zu gehen.
Im Krankenhaus ans Schmerzenslager gefesselt, war es mir beim Betrachten der Karten leichtgefallen, mir eine Strecke auszudenken. »Die Natur liebt es, sich zu verbergen«, erklärte Heraklit rätselhaft, wie es sich gehört, im hundertdreiundzwanzigsten Fragment. Wie die unvollendeten Lebewesen hatte ich eine große Neigung zu den Rückzugsorten. Der »hyperländliche Raum« war meine Chance. Und so presste ich eine der Karten des Berichts an mein Herz wie das Foto einer Verlobten. Die Karte versprach, dass ein Ausbruch möglich war. Meine Route würde nicht die Gesamtheit der hyperländlichen Gegenden abbilden. Hätte ich das Zentralmassiv erst einmal hinter mich gebracht, würde ich Richtung Nordwesten abbiegen und auf den Ärmelkanal zusteuern. Auf den Klippen von La Hague würde ich Halt machen, dort, wo das Land ins Meer fiel und mich vor die Wahl stellte: Umkehr oder Engelssprung. Klippen empfand ich schon immer als schöne Grenzen.