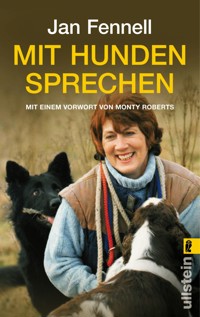
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Monty Roberts war ihr Vorbild, seine Arbeit mit Pferden ihre Quelle der Inspiration. Jan Fennell hat die Methoden des »Pferdeflüsterers« für Hunde adaptiert. Wie Roberts geht es ihr nicht darum, gewaltsam den Willen der Tiere zu brechen, sondern mit Blick auf die Instinkte und das Rollenverhalten der Vierbeiner mit ihnen zu kommunizieren. Unterhaltsam und anrührend beschreibt Englands erfolgreichste Hundetrainerin, wie sie arbeitet, »Problemhunde« therapiert und was die besondere Beziehung zwischen Mensch und Hund ausmacht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Das Buch
Als Nachkomme des Wolfes an die strengen Regeln des Rudels gewöhnt, ist der Hund sich und seinen Instinkten seit Beginn der Domestizierung treu geblieben. Die Anforderungen, die der Mensch an ihn stellt, sind allerdings häufig paradox und widernatürlich. Seine Degradierung zum Schoßtier, Accessoire oder Ergebnis verrückter Züchtungen hat für viele Missverständnisse in seiner Beziehung zum Menschen gesorgt. Jan Fennell, Englands erfolgreichste Hundetrainerin, beschreibt unterhaltsam und anrührend, wie sie Alternativen zur konventionellen Hundeerziehung entwarf und Schritt für Schritt lernte, sich mit Hunden zu verständigen. Sie hat die Methode des »Pferdeflüsterers« Monty Roberts für Hunde adaptiert. Wie Roberts geht es ihr nicht darum, den Willen der Tiere gewaltsam zu brechen, sondern mit Blick auf die Instinkte und das Rollenverhalten der Tiere mit ihnen zusammenzuarbeiten. Anhand vieler Beispiele von »Problemhunden«, Beißern und Kläffern, die Jan Fennell fast alle erfolgreich therapieren konnte, erklärt sie Verhalten und Psyche der Hunde. Eindrucksvoll vermittelt sie, wie sie mit den Tieren arbeitet und das »Besondere, das Mensch und Hund verbindet«, wieder sichtbar macht. Ihre Methode gilt als neuer Meilenstein der Hundeerziehung.
Die Autorin
Jan Fennell, Hundeliebhaberin seit frühester Kindheit, ist preisgekrönte Züchterin. Ihre Arbeit mit verstörten Hunden und ihre Beiträge für die BBC in Radio und Fernsehen haben ihr viel Bewunderung eingebracht. Inzwischen arbeitet sie ausschließlich als Hundetrainerin und lebt zusammen mit ihrem Partner und ihren Hunden in North Lincolnshire, England.
Von Jan Fennell sind in unserem Hause außerdem erschienen:
Mit Hunden leben Hunde verstehen Die sieben Leben eines Hundes
Besuchen Sie uns im Internet: www.ullstein-taschenbuch.de
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen,wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung,Speicherung oder Übertragungkönnen zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Ungekürzte Ausgabe im Ullstein Taschenbuch 1. Auflage August 2003 14. Auflage 2011
© für die deutsche Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2004 © 2003 für die deutsche Ausgabe by Ullstein Heyne List GmbH & Co. KG © 2001 für die deutsche Ausgabe by Econ Ullstein List Verlag GmbH & Co. KG/Ullstein Verlag © 2000 by Jan Fennell Titel der englischen Originalausgabe:
The Dog Listener. Learning the Language of Your Best Friend (HarperCollins Publishers, London) Umschlaggestaltung: HildenDesign, München (nach einer Vorlage von Petra Soeltzer, Düsseldorf) Titelabbildung: Steve Poole/Scope Features
eBook-Konvertierung: CPI – Ebner & Spiegel, Ulm
Printed in Germany
eBook ISBN 978-3-8437-0786-2
Für meinen Sohn Tony
Hinweis
Es erscheint mir wichtig, an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass meine Methode bei keinem Hund die Neigung zur Aggressivität beseitigen kann. Bestimmte Rassen hat man speziell zu Kampfhunden gezüchtet und mit meinen Empfehlungen wird man ihr potenziell wildes Naturell niemals ändern können. Was meine Methode jedoch zu leisten vermag, ist, Menschen in die Lage zu versetzen, mit ihrem Tier so umzugehen, dass sein aggressiver Instinkt niemals geweckt wird. Bitte lassen Sie größte Vorsicht walten, wenn Sie mit solchen Hunden arbeiten.
Inhalt
Vorwort von Monty Roberts
Einführung
1
Die verlorene Sprache
2
Ein Leben mit Hunden
3
Zuhören und lernen
4
Die Führung übernehmen
5
Der erste Test
6
Amichien Bonding: Die Führung im Rudel etablieren
7
Jedem sein eigenes Leben: Mit Trennungsängsten fertig werden
8
Böse und launisch: Vom Umgang mit nervöser Aggression
9
Frieden schaffen: Bissige Hunde
10
Die Bodyguards: Überbeschützende Hunde
11
Das Auf-und-ab-Spiel: Hunde, die hochspringen
12
Gedächtnislücken: Hunde, die ohne Leine weglaufen
13
Hund gegen Hund: Konfrontationen zwischen Artgenossen entschärfen
14
Das Unerwartete erwarten: Angst vor Geräuschen
15
Junge Hunde, alte Tricks: Welpen ihr Zuhause zeigen
16
Kleine Kobolde: Vom Umgang mit Problem-Welpen
17
Das Territorium markieren: Wenn Hunde ins Haus machen
18
Stellenangebot: Probleme mit der Rangordnung in einem erweiterten Rudel
19
Der Biss in die fütternde Hand: Schwierige Esser
20
Habe Hund, kann nicht verreisen: Chaos im Auto
21
Pfotenkauen und den eigenen Schwanz jagen: Wie man nervliche Wracks rettet
22
Der Jo-Jo-Effekt: Die Probleme von Hunden aus dem Tierheim lösen
23
Spielzeug statt Beute: Die Macht des Spiels
24
»Wie haben Sie das bloß geschafft, Lady?«
Dank
Bildnachweis
Vorwort
von Monty Roberts
Hunde haben in meinem Leben immer eine wichtige Rolle gespielt. Meine Frau Pat und unsere Familie haben im Laufe der Jahre einige Hunde gehabt, die liebevolle Gefährten und wichtige Familienmitglieder waren. Dennoch hat ein anderes wunderbares Geschöpf meinen Werdegang bestimmt. Ich habe mein Leben lang an der von mir entdeckten Methode zur Kommunikation mit Pferden gearbeitet – und diese oft verteidigen müssen.
Die Begeisterung, die Hundebesitzer für meine Ideen aufbrachten, war immer unübersehbar. Wo auch immer in der Welt ich hinkomme, überall gibt es viermal so viele Hundebesitzer und -trainer wie Pferdeausbilder. Fast jeder von ihnen könnte meine Methode überzeugend und im positiven Sinne kommentieren.
Wenn ich noch mal von vorne anfangen dürfte, würde ich mich mit Begeisterung der Herausforderung stellen, meine Ideen zu adaptieren und auf die Welt der Hunde zu übertragen. Tatsächlich habe ich aber mehr als genug mit meiner eigenen Disziplin zu tun und damit, dieses Wissen weiterzugeben. Voller Freude bin ich in den letzten Jahren allerdings auf eine begabte Hundetrainerin aufmerksam geworden, die sich – inspiriert von meiner Methode – dieser Aufgabe widmet.
Als ich zum ersten Mal mit der Arbeit von Jan Fennell in Berührung kam, wurde mir ganz warm ums Herz. Ich hatte das Glück, Jan in England persönlich zu treffen, und was sie mir berichtete, erinnerte mich an meine eigenen frühen Erfahrungen. Wie ich empfindet auch Jan die Art, wie der Mensch ein Tier, das er als seinen Freund bezeichnet, manchmal misshandelt, als großes Unrecht. Leidenschaftlich vertritt auch sie die Überzeugung, dass Gewalt in unserer Beziehung zu Tieren nichts verloren hat, und träumt von einer Welt, in der alle Spezies in Frieden miteinander leben.
Und so wie bei mir hat es auch bei Jan eine Weile gedauert, bis sie den Mut gefasst hat, ihre Geschichte zu erzählen. Ich habe mir lange Zeit gelassen, bis ich mein erstes Buch, Der mit den Pferden spricht, schrieb. Jan war ebenso zögerlich, bevor sie ihre Ideen in druckreife Form brachte. Heute vertraut sie auf ihre Erfahrung und ist bereit, ihre bemerkenswerte Arbeit mit einem größeren Publikum zu teilen.
Bei diesem Unterfangen wünsche ich ihr und ihren Ideen das Beste. Ich bin sicher, dass Jan Fennell auch Gegner auf den Plan rufen wird. Denn wenn meine Erfahrung mich eines gelehrt hat, dann die grenzenlose Fähigkeit der menschlichen Natur zur Negativität. Dabei sollte sich jeder von uns der Tatsache bewusst sein, dass uns zum Ausgleich für jedes Körnchen Negativität unter den Menschen viel Positives im Umgang mit Tieren erwartet. Zudem kommen auf jeden Pessimisten Hunderte von Leuten, die sich nach einer besseren Methode für das Zusammenleben mit dem besten Freund des Menschen sehnen.
Ich bin stolz darauf, dass die Beharrlichkeit, mit der ich meine Ideen vertreten habe, dazu beigetragen hat, diese Welt zu einem besseren Ort für Pferde – und hoffentlich auch für Menschen – zu machen. Ich hoffe, dass dieses Buch das Gleiche für eine andere, ganz besondere Kreatur erreicht, für den Hund.
Monty Roberts, Kalifornien, im März 2000
Einführung
Ich bin der festen Überzeugung, dass wir aus den Fehlern lernen, die wir im Laufe unseres Lebens machen. Und das muss ich auch sein, denn ich habe in meinen Beziehungen zu Menschen wie zu Hunden mehr als genug davon gemacht. Von all den Lektionen, die Letztere mich gelehrt haben, war keine so schmerzhaft wie jene im Winter des Jahres 1972. Es erscheint mir passend, mein Buch mit der Tragödie von Purdey zu beginnen. Wie Sie gleich sehen werden, ist ihre Geschichte untrennbar mit der meinen verbunden.
Zu jener Zeit war ich verheiratet und zog zwei kleine Kinder auf: meine Tochter Ellie, die im Februar desselben Jahres zur Welt gekommen war, und den damals zweieinhalb Jahre alten Tony. Wir lebten in London, hatten jedoch gerade beschlossen aufs Land zu ziehen, und zwar in ein kleines Dorf in Lincolnshire, im Herzen Englands. Wie so viele Menschen, die das Leben auf dem Lande fasziniert, freuten auch wir uns auf lange Spaziergänge und beschlossen einen Hund als Gefährten mitzunehmen. Wir wollten keinen Welpen kaufen, sondern lieber einen Hund retten. Uns gefiel die Vorstellung, einem Tier, das ein schweres Schicksal hinter sich hatte, ein neues Zuhause zu geben, und so begaben wir uns ins Tierheim. Dort sahen wir diese unheimlich süße, sechs Monate alte, schwarzweiße Mischung aus einem Border Collie und einem Whippet [englischer Rennhund, Anm. d. Ü.]. Wir nahmen sie mit nach Hause und nannten sie Purdey.
Purdey war nicht der erste Hund in meinem Leben. Das war Shane gewesen, ein prachtvoller, dreifarbiger Border Collie, den mir mein Vater geschenkt hatte, als ich dreizehn Jahre alt war und wir im Westen Londons, in Fulham, wohnten. Ich hatte Hunde schon immer geliebt und mir als kleines Mädchen sogar einen imaginären Hund namens Lady ausgedacht. Ich erinnere mich daran, dass meine Großmutter mir den Gefallen tat, sich mit mir und meiner nicht existierenden Freundin zu unterhalten. Ich glaube, dass ich Hunde damals schon so sah wie heute – als Wesen, die unerschütterlich lieben können und absolut loyal sind. Eigenschaften, die man bei Menschen nur ganz selten findet. Shanes Einzug in unsere Familie hatte diese Gefühle bei mir nur noch verstärkt.
Ich bildete Shane zusammen mit meinem Vater aus, und zwar nach der Methode, die Dad schon als Junge bei seinen Hunden angewandt hatte. Dad war ein sanftmütiger Mann, aber er war auch entschlossen, den Hund dazu zu bringen, zu tun, was er sagte. Wenn Shane etwas falsch machte, bekam er einen Klaps auf die Schnauze oder das Hinterteil. Weil ich selbst auch manchmal was hinten drauf bekam, fand ich das in Ordnung. Außerdem war Shane ein äußerst kluges Geschöpf und schien zu verstehen, was wir von ihm wollten. Ich kann mich bis heute daran erinnern, wie stolz ich war, mit ihm im Bus Nummer 74 nach Putney Heath und Wimbledon Common zu fahren. Shane saß die ganze Zeit über ohne Leine neben mir und benahm sich tadellos. Er war einfach ein toller Hund.
Wenn etwas funktioniert, hat man sich schnell daran gewöhnt. Man repariert nichts, was nicht kaputt ist, lautet ein beliebtes englisches Sprichwort. Als wir Purdey bekamen, beschloss ich deshalb die gleiche Methode wie bei Shane anzuwenden und ihr den Unterschied zwischen richtig und falsch mit einer Mischung aus Liebe, Zuneigung und – falls nötig – Gewalt beizubringen.
Zunächst schien dieses Verfahren auch bei Purdey zu funktionieren. Sie benahm sich gut und schien sich leicht in unsere Familie in London einzufugen. Die Schwierigkeiten begannen, als wir schließlich im September jenes Jahres nach Lincolnshire zogen. Unser neues Zuhause hätte kein schärferer Kontrast zum lärmenden, dicht bevölkerten London sein können. Es gab keine Straßenbeleuchtung, die Busse verkehrten nur zweimal wöchentlich, und um zum nächsten Laden zu kommen, bedurfte es einer Vier-Meilen-Wanderung. Ich erinnere mich, wie man mit mir, als ich noch ein Kleinkind war, zum ersten Mal ans Meer fuhr. Ich warf einen Blick darauf und rannte dann wieder den Hügel hinauf, nur fort davon. Als Dreijährige beschrieb ich meinen Eindruck mit den Worten »zu groß genug«, und wenn sie hätte sprechen können, wäre das sicher auch Purdeys Kommentar zu ihrem neuen Zuhause gewesen. Alles schien »zu groß genug« zu sein.
Bald nach unserer Ankunft begann Purdey mit einem Verhalten, das mir damals zwar seltsam, aber in keinster Weise Besorgnis erregend erschien. Sie rannte weg ins Gelände, blieb für Stunden verschwunden und kam dann zurück, nachdem sie irgendwo offenbar viel Spaß gehabt hatte. Sie war auch hyperaktiv und schien von der kleinsten Sache oder dem geringsten Geräusch irritiert. Sie folgte mir auf Schritt und Tritt, was ein wenig lästig ist, wenn man zwei kleine Kinder zu versorgen hat. Ich war nicht glücklich über ihr Streunen. Jeder Hundebesitzer ist schließlich dafür verantwortlich, dass sein Tier keinen Schaden verursacht und niemanden belästigt. Aber schließlich hatte ich mich für diesen Hund entschieden und war entschlossen, das durchzustehen. Ich schuldete ihr den Versuch, ihr zu helfen, zur Ruhe zu kommen. Und genau darauf hoffte ich, als die Ereignisse eine eigene Dynamik entwickelten.
Die erste Ahnung davon, dass etwas nicht in Ordnung sei, bekam ich, als ein einheimischer Bauer zu uns kam. Er sagte mir ganz unverblümt, dass er diesen Hund erschießen würde, wenn es uns nicht gelänge, besser auf ihn aufzupassen. Ich war natürlich am Boden zerstört, konnte ihn jedoch auch verstehen, denn er besaß Vieh. Purdey rannte offenbar zwischen den Tieren herum und versetzte sie in Angst und Schrecken. Also steckten wir sie in unseren riesigen, knapp zwei Quadratkilometer großen Garten, legten sie an eine Leine, die wir wiederum an der Wäscheleine befestigten, sodass sie nicht weit weglaufen konnte. Sie riss aber dennoch aus, sooft sie konnte.
Die Situation wurde an einem kalten Wintermorgen kurz vor Weihnachten noch schlimmer. Ich war gerade mit den Kindern heruntergekommen und absolvierte unser übliches Programm am Beginn eines Tages. Purdey sprang, wie sie es jeden Morgen als Erstes tat, wie verrückt herum. Ich erinnere mich, dass Ellie auf dem Boden herumkrabbelte, während Tony den kleinen Helfer spielte und Wäsche sortierte, die im Wohnzimmer lag. Ich war gerade auf dem Weg in die Küche, um die Fläschchen für die Kinder zu holen, als ich einen lauten Krach hörte. Ich werde nie vergessen, was ich sah, als ich mich umdrehte. Der Hund hatte Tony angesprungen und ihn gegen eine Scheibe der gläsernen Schiebetür geworfen. Überall waren Scherben. Von da an schien alles in Zeitlupe zu passieren. Ich erinnere mich, dass Tony mich mit diesem erstaunten, irgendwie eingefrorenen Ausdruck ansah, während Blut über sein kleines Gesicht strömte. Ich weiß noch, dass ich zu ihm rannte, ihn hochnahm und mir ein sauberes Frotteetuch vom Wäschestapel griff. Aus der Zeit als freiwillige Helferin in der St. John’s Ambulanz wusste ich, dass ich zuerst nach Glassplittern schauen musste. Glücklicherweise waren da keine, und ich presste das Handtuch so fest wie möglich auf sein Gesicht, um die Blutung zu stillen. Dann schloss ich ihn fest in die Arme und suchte nach Ellie, die wundersamerweise ganz still in diesem Meer aus zerbrochenem Glas saß. Ich klemmte sie unter meinen freien Arm, lag auf den Knien und rief um Hilfe. Die ganze Zeit über raste Purdey wie eine Wahnsinnige durch die Gegend, bellte und sprang in die Luft, als ob sie sich ein fantastisches Spiel ausgedacht hätte.
Das war der Albtraum aller Eltern. Als endlich Hilfe eintraf, waren die Freunde und Verwandten sich einig. Tonys Verletzungen waren schrecklich und würden lebenslang Narben hinterlassen. »Dieser Hund ist böse, ein missratenes Tier«, sagten sie. Ich fühlte mich jedoch nach wie vor für Purdey verantwortlich und wollte ihr noch eine Chance geben. Sie brachte sich von Zeit zu Zeit immer mal wieder in Schwierigkeiten, aber wenigstens ein paar Monate lang war es relativ ruhig.
Doch an einem sonnigen Wintermorgen im Februar, kurz vor Ellies erstem Geburtstag, befand ich mich in einer anderen Ecke des Hauses, während Ellie unter den Augen meiner Mutter auf dem Fußboden spielte. In dem Moment, als ich meine Mutter schreien hörte, wusste ich schon, dass etwas passiert war. Als ich ins Wohnzimmer kam, rief meine Mutter: »Der Hund hat sie gebissen. Ellie hat nichts getan und der Hund hat sie gebissen. Er ist durchgedreht.« Ich wollte das nicht glauben. Aber als ich dieses hässliche kleine Loch über Ellies Auge sah, blieb mir gar nichts anderes übrig. In meinem Kopf drehte sich alles. Warum war das geschehen? Was hatte Ellie getan? Wo hatte meine Hundeerziehung versagt? Aber ich wusste auch, dass jetzt keine Zeit mehr für Fragen blieb.
Sobald mein Vater die Neuigkeit erfahren hatte, kam er mich besuchen. Als kleines Mädchen hatte ich ihn von einem seiner Lieblingshunde, einem Altenglischen Schäferhund-Mischling namens Gyp, erzählen hören und davon, wie dieser Hund durchgedreht war. Meine Großmutter hatte versucht ihn vom Sofa zu vertreiben, und er hatte nach ihr geschnappt. In den Augen meines Großvaters war ein Hund verloren, wenn er sich gegen die Hand wendete, die ihn fütterte, also wurde Gyp beseitigt. Mein Vater musste mir das nicht explizit sagen. »Du weißt, was du zu tun hast, mein Mädchen. Wenn sie einmal so weit gegangen sind, gibt es kein Zurück mehr«, sagte er traurig. »Verlier keine Zeit, tu es einfach.« Als mein Mann an jenem Abend nach Hause kam, fragte er: »Wo ist der Hund?« – »Sie ist tot«, antwortete ich. Ich hatte sie am selben Nachmittag zum Tierarzt gebracht und einschläfern lassen.
Lange Zeit glaubte ein Teil von mir, mit Purdey das Richtige getan zu haben. Doch zugleich hatte ich immer das Gefühl, ihr gegenüber versagt zu haben. Als wäre es mein Fehler gewesen, nicht ihrer. Noch als ich sie einschläfern ließ, kam es mir vor, als hätte ich sie im Stich gelassen. Ich habe fast zwanzig Jahre gebraucht, um mir meinen Verdacht zu bestätigen. Heute weiß ich, dass Purdeys Verhalten allein von meiner Unfähigkeit, diesen Hund zu verstehen, hervorgerufen wurde. Ich war nicht in der Lage gewesen, mit ihr zu kommunizieren, ihr zu zeigen, was ich tatsächlich von ihr erwartete. Kurz gesagt: Sie war ein Hund, ein Mitglied der Kaniden, nicht der menschlichen Rasse, trotzdem habe ich ihr gegenüber die menschliche Sprache benutzt.
In den letzten zehn Jahren habe ich gelernt, der Sprache der Hunde zu lauschen und sie zu verstehen. Weil dieses Verständnis ständig wuchs, war es mir dann möglich, mit Hunden zu kommunizieren, um ihnen – und ihren Besitzern – beim Lösen ihrer Probleme zu helfen. In vielen Fällen hat mein Eingreifen einen Hund vor dem Einschläfern wegen einer scheinbar nicht zu behebenden Verhaltensstörung gerettet. Die Freude, die ich jedes Mal verspürte, wenn ich auf diese Weise das Leben eines Hundes rettete, war ungeheuer. Aber ich würde lügen, wenn ich nicht zugeben könnte, dass sie auch jedes Mal mit dem Bedauern verbunden ist, diese Grundsätze nicht rechtzeitig gelernt zu haben, um Purdey zu retten.
Ziel dieses Buches ist es, das Wissen, das ich mir erworben habe, weiterzugeben. Ich möchte Ihnen erklären, wie ich zu der Methode gekommen bin, die ich heute anwende. Im Folgenden werde ich Ihnen zeigen, wie Sie diese Sprache selbst lernen können. Wie mit allen Sprachen muss man sich auch mit ihr ernsthaft auseinander setzen. Wer sie nicht mit Engagement, sondern nur halbherzig lernt, wird damit nichts anderes erreichen als Verwirrung zwischen sich und dem Hund, mit dem er doch kommunizieren will. Lernen Sie sie deshalb gewissenhaft, dann kann ich Ihnen versichern, dass Ihr Tier Sie mit Kooperationsbereitschaft, Loyalität und Liebe belohnen wird.
KAPITEL 1
Die verlorene Sprache
»In seinem eigenen Haus ist der Hund ein Löwe.«
Persisches Sprichwort
Die Menschheit hat im Laufe ihrer Geschichte viele Geheimnisse, die sie einmal kannte, vergessen. Die wahre Natur unserer Beziehung zum Hund ist eines davon. Wie so viele Millionen Menschen auf der ganzen Welt hatte ich schon immer das Gefühl, dass es zwischen diesen beiden Spezies eine besondere Affinität gibt. Diese geht über bloße Bewunderung für die Sportlichkeit, die Klugheit und das Aussehen des Hundes hinaus. Es gibt da ein unzertrennliches Band, etwas Besonderes, das uns verbindet – und das wohl schon seit frühester Zeit.
Lange gründete dieses Gefühl bei mir auf kaum mehr als einem Instinkt, einer Art Glauben, wenn Sie so wollen. Heute jedoch ist die Beziehung des Menschen zum Hund ein sich ständig weiterentwickelndes, absolut fesselndes wissenschaftliches Thema. Die ernsthafte Beschäftigung mit dieser Frage hat nicht nur bewiesen, dass der Hund der beste Freund des Menschen ist, sondern auch sein ältester.
Gemäß den aktuellsten Forschungsberichte, die ich gelesen habe, begann die Verflechtung der Geschichten beider Spezies schon 100000 v.Chr. Damals ging der moderne Mensch, der Homo sapiens, in Afrika und dem Nahen Osten aus seinen Neandertaler-Vorfahren hervor. Um diese Zeit herum begann auch der Wolf, Canis lupus, sich zum Hund, Canis familiaris, zu entwickeln. Es gibt kaum Zweifel daran, dass diese beiden Ereignisse miteinander verknüpft waren und dass diese Verbindung den frühesten Domestizierungsversuch des Menschen darstellt. Natürlich bezogen unsere Vorfahren auch andere Tierarten in ihre Gemeinschaft mit ein, vor allem natürlich Kühe, Schafe, Schweine und Ziegen. Der Hund jedoch war nicht nur der erste, sondern auch der bei weitem erfolgreichste Neuzugang zu unserer Großfamilie.
Es gibt zwingende Beweise für die Vermutung, dass unsere Vorväter ihre Hunde mehr als alles andere in ihrem Leben schätzten. Eine der bewegendsten Sendungen, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, war eine Dokumentation über die Ausgrabungen bei Ein Mallah im Norden Israels. Dort, in dieser verdorrten und leblosen Gegend, fand man die 12000 Jahre alten Knochen eines jungen Hundes, die unterhalb der linken Hand eines ebenso alten menschlichen Skeletts lagen. Die beiden waren zusammen bestattet worden. Eindeutig hatte der Mann sich gewünscht, sein Hund möge die letzte Ruhestätte mit ihm teilen. Ähnliche Funde aus den Jahren um 8500 v. Chr. hat man in Amerika, genauer gesagt in Koster, Illinois, gemacht.
Die Vermutung, dass es eine einzigartige Nähe zwischen Mensch und Hund gibt, wird auch durch die Arbeit von Soziologen über Gemeinschaften in Peru und Paraguay gestützt. Noch heute ist es dort üblich, dass verwaiste Welpen von einer Frau großgezogen werden. Sie säugt den Hund, bis er sich selbst versorgen kann. Niemand weiß, wie alt diese Tradition schon ist. Wir können bislang nur Vermutungen darüber anstellen, wie eng die Beziehung der Vorfahren dieser Menschen zu ihren Hunden gewesen sein muss.
Ich bin mir sicher, dass uns noch viele Entdeckungen und viele weit reichende Erkenntnisse erwarten. Doch selbst mit dem Wissen, das wir heute schon besitzen, sollte uns das Ausmaß der Empathie dieser beiden Spezies füreinander nicht wundern. Machen doch die ungeheuren Ähnlichkeiten der beiden Arten sie zu natürlichen Partnern.
Die zahlreichen Studien auf diesem Gebiet belegen, dass sowohl der Wolf wie auch der Mensch der Steinzeit von den gleichen Instinkten getrieben wurde und in vergleichbaren sozialen Strukturen lebte. Einfach ausgedrückt: beide waren Jäger und lebten in Verbänden oder Rudeln mit einer klaren Hierarchie. Eine der größten Ähnlichkeiten der beiden war ihr angeborener Egoismus. Die Reaktion eines Hundes – wie auch des Menschen – auf jegliche Situation ist: »Was schaut dabei für mich heraus?« In diesem Fall ist leicht zu erkennen, dass die sich entwickelnde Beziehung beiden Spezies immensen Nutzen brachte.
Nachdem sich der immer weniger misstrauische und zunehmend Vertrauen fassende Wölf in seiner neuen Umgebung an der Seite der Menschen eingelebt hatte, kam er in den Genuss höher entwickelter Jagdtechniken wie Fallenstellen oder das Abschießen von Pfeilen mit steinernen Spitzen. Bei Nacht konnte er sich am Feuer der Menschen wärmen und fressen, was diese weggeworfen hatten. Es verwundert kaum, dass die damit beginnende Domestizierung so schnell vonstatten ging. Indem er den Wolf in seinen häuslichen Alltag integrierte, profitierte der Mensch von dessen überlegenen Instinkten. Etwas früher in seiner Entwicklung hatte sein extrem großer Riecher dem Neandertaler einen ausgezeichneten Geruchssinn beschert; seine Nachfahren erkannten, dass sie durch die Beteiligung des frisch domestizierten Wolfes an der Jagd diese verlorene Fähigkeit erneut nutzen konnten. Der Hund wurde zum entscheidenden Bestandteil der Jagd, weil er die Beute aufscheuchen, isolieren und falls nötig auch töten konnte. Zusätzlich zu alldem genoss der Mensch natürlich seine Gesellschaft und den Schutz, den der Hund für das Lager bedeutete.
Die beiden Spezies verstanden einander instinktiv und vollkommen. Schon in ihren eigenen Rudeln war Menschen wie Hunden bewusst, dass ihre Existenz vom Überleben ihrer Gemeinschaft abhing. Jeder innerhalb der Gruppe hatte eine Aufgabe zu erfüllen und fügte sich. Es war nur natürlich, dass dieselben Regeln auch für das erweiterte Rudel galten. Während sich also die Menschen auf Aufgaben wie das Sammeln von Brennholz und Beeren, das Instandhalten der Behausungen und das Zubereiten der Nahrung konzentrierten, bestand die Hauptaufgabe der Hunde darin, mit den Jägern loszuziehen und ihnen als Nase, Augen und Ohren zu dienen. Eine ähnliche Rolle hatten sie auch innerhalb des Lagers, wo sie die erste Verteidigungslinie bildeten, indem sie die Menschen warnten, wenn Angreifer sich näherten, und diese abwehrten. Der Grad der Verständigung zwischen Mensch und Hund erreichte seinen Höhepunkt.
In den Jahrhunderten, die seither vergangen sind, ist das Band jedoch zerrissen. Es ist leicht zu sehen, wann die beiden Spezies getrennte Wege gingen. In den Jahrhunderten, seit der Mensch die dominierende Macht auf der Erde geworden ist, hat er den Hund – und viele andere Tiere – ausschließlich nach den Anforderungen seiner Gesellschaft geformt. Die Menschen begriffen schnell, dass sie die Fähigkeiten ihrer Hunde anpassen, verbessern und spezifizieren konnten, indem sie sie bewusst zu Zuchtzwecken zusammenführten. Schon im Jahre 7000 v. Chr. fielen beispielsweise im fruchtbaren Mesopotamien jemandem die eindrucksvollen jagdlichen Fähigkeiten des arabischen Wüstenwolfs auf, eines leichteren und schnelleren Verwandten der Wölfe des Nordens. Langsam entwickelte sich der Wolf zum Hund, der in der Lage war, in diesem extremen Klima seine Beute zu jagen und zu fangen, und – was noch viel wichtiger war – er hielt sich dabei an die Kommandos eines Menschen. Diese Hunderasse, die inzwischen Saluki, Persischer Greyhound oder Gazellenhund genannt wird, ist bis heute unverändert und mit gewisser Wahrscheinlichkeit das erste Beispiel eines reinrassigen Hundes. Im alten Ägypten züchtete man den Pharaohund für die Jagd, in Russland den Borzoi speziell für die Bärenjagd. In Polynesien und Mittelamerika entstanden sogar eigene Rassen zum Verzehr.
Dieser Prozess hat sich über die Jahre fortgesetzt und wurde gefördert durch die Bereitschaft des Hundes, sich von unserer Spezies prägen zu lassen. In England beispielsweise hat die Jagdkultur der ländlichen Aristokratie eine Reihe von Hunderassen hervorgebracht, die auf die Erfüllung bestimmter Aufgaben spezialisiert sind. Auf einem Landsitz des 19. Jahrhunderts gehörte in eine typische Meute ein Springerspaniel, der im wahrsten Sinne des Wortes das Wild aus der Deckung aufscheuchte (engl. to spring), ein Pointer oder Setter, um Wildgeflügel zu lokalisieren, und ein Retriever, um das tote oder verletzte Wild dem Abrichter zu apportieren.
Auch andere Rassen hielten an der historischen Bindung zwischen Mensch und Hund sogar noch enger fest. Das wird nirgendwo deutlicher als beim Einsatz der ersten Blindenhunde. Das geschah gegen Ende des Ersten Weltkriegs in einem großen Sanatorium in der Nähe von Potsdam. Dort bemerkte ein Arzt, der die Kriegsversehrten betreute, zufällig, dass sein Deutscher Schäferhund blinde Patienten aufhielt, sobald diese auf eine Treppe zugingen. Der Arzt erkannte, dass der Hund sie vor Gefahr bewahren wollte. Er begann Hunde speziell unter dem Aspekt zu trainieren, dass sie ihren natürlichen Hütetrieb benutzten, um blinden Menschen zu helfen. Der Blindenhund ist vielleicht das eindeutigste Vermächtnis zu jener frühesten Gemeinschaft zwischen Mensch und Hund. Hier stellt der Hund ein Sinnesorgan zur Verfügung, das der Mensch verloren hat. Leider ist dies ein seltenes Beispiel für Kooperation in der heutigen Welt.
In jüngerer Zeit hat sich unsere Beziehung weiter verändert – wie ich finde, oft zum Nachteil des Hundes. Unsere früheren Partner im Überlebenskampf sind zu Gefährten und Accessoires in einem geworden. Die Entwicklung der so genannten Schoßhunde illustriert das perfekt. Diese Rassen wurden vermutlich in den buddhistischen Tempeln des Himalaja gezüchtet. Dort sorgten die heiligen Männer dafür, dass die robusten tibetischen Spaniel kleiner und kleiner wurden. Dann benutzten sie die Hunde als eine Art Wärmflasche, d. h. sie ließen sie auf den Schoß springen und unter ihre Gewänder kriechen, um sich gegen die Kälte zu schützen.
Zur Zeit Karls II. war diese Idee bis nach England vorgedrungen, wo der englische Toy-Spaniel aus immer kleineren und kleineren Settern gezüchtet wurde. Schon bald wurden diese kleinen Jagdhunde von ihren reichen Besitzern verwöhnt und mit Spielzeughund-Rassen aus dem Osten gekreuzt. Die Zuchtgeschichte der Tiere ist bis heute am auffällig flachen Gesicht der King-Charles-Spaniels abzulesen. In meinen Augen war dies ein Wendepunkt in der Geschichte der Beziehung zwischen Mensch und Hund. Für den Hund hatte sich nichts geändert, aber für seinen früheren Partner war das Verhältnis ein völlig neues. Der Hund hatte abgesehen von Dekorationszwecken keine Funktion mehr. Das war ein Vorgeschmack dessen, was noch kommen sollte.
Heute sind Beispiele für die alte Beziehung, die Mensch und Tier erfreute, äußerst selten. Arbeitshunde, etwa Jagdhunde, Polizeihunde oder Hofhunde und natürlich die Blindenhunde kommen mir da in den Sinn. Aber sie sind die absolute Ausnahme. Im Allgemeinen leben wir heute in einer Kultur und Gesellschaft, in der an den Platz des Hundes kein Gedanke verschwendet wird. Die alte Allianz ist vergessen. Aus Vertrautheit ist Verachtung geworden und die instinktive Verständigung der beiden Spezies untereinander ging verloren.





























