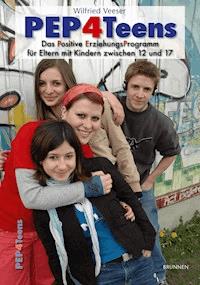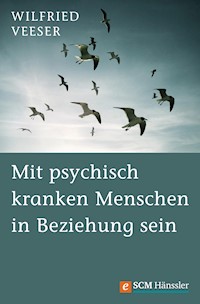
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SCM Hänssler
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Maria ist nur noch am Putzen, das nervt den Ehemann. Die ständige Selbstumkreisung Dieters macht manche im Hauskreis hilflos. Immer wieder steckt hinter seltsamem Verhalten ein psychisches Problem. Doch wie können Angehörige, Freunde, der Hauskreis, die Gemeinde sinnvoll damit umgehen? Wilfried Veeser schreibt mit vielen Beispielen aus seiner Praxis von den Herausforderungen unterschiedlicher psychischer Krankheiten für das Umfeld. Er gibt hilfreiche Tipps, doch macht auch Mut, die nötigen Grenzen zu ziehen und für das eigene Wohlergehen zu sorgen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 329
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieses E-Book darf ausschließlich auf einem Endgerät (Computer, E-Reader) des jeweiligen Kunden verwendet werden, der das E-Book selbst, im von uns autorisierten E-Book Shop, gekauft hat. Jede Weitergabe an andere Personen entspricht nicht mehr der von uns erlaubten Nutzung, ist strafbar und schadet dem Autor und dem Verlagswesen.
ISBN 978-3-7751-7176-2 (E-Book)
ISBN 978-3-7751-5442-0 (lieferbare Buchausgabe)
Datenkonvertierung E-Book:
CPI – Ebner & Spiegel, Ulm
© der deutschen Ausgabe 2013
SCM Hänssler im SCM-Verlag GmbH & Co. KG . 71088 Holzgerlingen
Internet: www.scm-haenssler.de . E-Mail: [email protected]
Soweit nicht anders angegeben, sind die Bibelverse folgender Ausgabe entnommen:
Lutherbibel, revidierter Text 1984, durchgesehene Ausgabe in neuer Rechtschreibung 2006, © 1999 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Weiter wurden verwendet:
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 by SCM R.Brockhaus im SCM-Verlag GmbH & Co. KG, Witten.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 1980 Katholische Bibelanstalt, Stuttgart.
Umschlaggestaltung: Kathrin Retter, Weil im Schönbuch
Titelbild: shutterstock.com
Satz: typoscript GmbH, Walddorfhäslach
Abbildungen: Kathrin Retter, Weil im Schönbuch
Inhalt
Inhalt
Geleitwort von Dr. med. Samuel Pfeifer
Vorwort
1. Einleitung
2. Informationen
2.1 Definitionen
2.1.1 Was ist »psychisch krank« oder eine »psychische Störung«?
2.1.2 Was ist eine psychische Behinderung?
2.1.3 Was ist Seelsorge?
2.1.4 Was ist Lebensberatung?
2.1.5 Was ist Psychologie?
2.1.6 Was ist Psychotherapie?
2.1.7 Was ist Psychiatrie?
2.1.8 Was ist eine Lebenskrise?
2.1.9 Zur Unterscheidung von Seelsorge, Beratung und Psychotherapie/Psychiatrie
2.2 Was sind psychische Störungen? Eine kurze Übersicht
2.2.1 Diagnostik im Wandel
2.2.2 Neurotisches und psychotisches Verhalten
2.2.3 Kurze Beschreibung ausgewählter psychischer Störungen
2.2.4 Das Gehirn ist beteiligt
2.3 Medikamente und ihre Wirkung
2.4 Was Angehörige berichten
3. Theologische und biblische Klärungen
3.1 Problemanzeige: Sind psychische Störungen dämonisch?
3.1.1 Okkulte Bindungen – eine biblische Sicht
3.1.2 Christus macht frei
3.1.3 Der fragwürdige Umgang mit Bibeltexten
3.2 Leben zwischen Heil und Heilung
3.2.1 Gott kann heilen
3.2.2 Vom unerhörten Gebet: Auch Gottes Sohn musste Gehorsam lernen
3.2.3 Warum, Gott?
3.2.4 Die Klage
3.2.5 Mit Spannungen leben lernen
3.2.6 Schuld und Schuldgefühle
3.3 Wie Gott heilt – Hilfen aus Gottes Schöpfung
3.3.1 Schöpfung und die ihr innewohnende weisheitliche Lebensordnung
3.3.2 Medizin, Psychologie, Soziologie, Pädagogik als Weisheitswissenschaften
3.3.3 Die Frage nach dem »gläubigen« Arzt oder Psychotherapeuten
3.3.4 Die weisheitlichen Ordnungen in psychotherapeutischen Interventionen
3.3.5 Wie heilt Gott? Ein Fazit
4. Die Aufgabe für Angehörige
4.1 Veränderungen
4.1.1 Schleichender Beginn
4.1.2 Die große Rücksichtnahme
4.1.3 Abgrenzung und Hilflosigkeit im Umfeld
4.1.4 Psychische Probleme zeigen sich im Verhalten
4.1.5 Angefochtener Glaube
4.1.6 Krankheitseinsicht ist oft nur begrenzt vorhanden
4.1.7 Unterscheiden lernen
4.2 Die Herausforderung: Beziehung halten
4.2.1 Die Entscheidung, zu dem Betroffenen zu stehen
4.2.2 Mut, für sich selbst zu sorgen
4.2.3 Geduld entwickeln
4.2.4 Sich Hoffnung bewahren
4.3 Sich »normal« verhalten – aber mit viel sozialer Kompetenz
4.3.1 Sich die innere Erlaubnis geben
4.3.2 Mit sozialer Kompetenz die Beziehung gestalten
4.4 Psychohygiene: für sich selbst sorgen!
5. Die Aufgabe für die Gemeinde
5.1 Die seelsorgerlichen Herausforderungen in den ersten Gemeinden
5.2 Die Gemeinde als »Großfamilie« und ihre Potenziale
5.2.1 Der Verlust der Großfamilie
5.2.2 Die Potenziale der Gemeinde
5.2.3 Eine theologisch wichtige Grundentscheidung
5.2.4 Paradigmenwechsel und das Anstoßen von Lernprozessen
5.3 Prävention und »Gesundheitshelfer«
5.3.1 Grenzen des Gesundheitssystems – Betroffene brauchen stabile Netzwerke
5.3.2 Menschen in der Gemeinde informieren und kompetent machen
5.3.3 Angestrebte Effekte einer Fortbildung
5.4 Konkrete Schritte aller Beteiligten
5.4.1 Das Gemeinschaftsteam
5.4.2 Das Care-Team – Erfahrungen mit praktisch gelebter Gemeinschaft
5.4.3 Fortbildung der Menschenkenntnis
5.4.4 Lebenswissen vermitteln durch Erwachsenenbildung
6. Konkrete Verhaltensweisen im Umgang mit psychisch kranken Menschen
6.1 Allgemeine Verhaltensweisen
6.2 Spezielle Verhaltensweisen
6.2.1 Fürbitte
6.2.2 Abgrenzung
6.2.3 Ein Klinikaufenthalt
6.2.4 Suizidgefährdung, Suizidandrohung und vollendeter Suizid
6.2.5 Depressionen
6.2.6 Angststörungen
6.2.7 Zwangserkrankungen
6.2.8 Schwere – z. B. psychotische – Erkrankungen
6.2.9 Eine Alkoholerkrankung
Schlusswort
Anhang
Ergänzende Abbildungen
Bildnachweis
Literaturverzeichnis
Hilfreiche Internetadressen zu psychischen Störungen
Hilfen bei Alkoholabhängigkeit
Gefragte Themen in der Erwachsenenbildung (2013)
Schriftliche Vereinbarung für das Care-Team
Bildungsintiative für Seelsorge und Lebensberatung
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
Geleitwort von Dr. med. Samuel Pfeifer
»Die Stärke eines Volkes misst sich am Wohl der Schwachen!« Dieser Satz aus der Einleitung zur Schweizerischen Bundesverfassung könnte vielleicht auch so formuliert werden: »Die Stärke einer christlichen Gemeinde misst sich daran, wie sie für die Schwachen in ihrer Mitte sorgt!«
Doch wie soll das aussehen? Was ist zu beachten? Leitlinien für die Notfall-Seelsorge und Anleitung zur akuten Betreuung von traumatisierten Menschen gibt es einige. Doch immer wieder habe ich mich gefragt: »Wo sind die Menschen, die Angebote machen für die Zeit danach?« Welche Rolle kann eine christliche Gemeinde übernehmen, um Menschen in ihrer Schwachheit zu begleiten? Wie können Menschen mit ihren seelischen Nöten in das Leben der Gemeinschaft integriert werden? Und welche Hilfe kann man ihren Angehörigen geben?
Das vorliegende Buch schließt eine Lücke. »Menschen, die Leid erleben, brauchen Menschen, die mit ihnen dieses Leid aushalten. Doch diese Menschen sind rar.« Wie recht hat Wilfried Veeser mit dieser Aussage! Oftmals sind Menschen mit Behinderungen und psychischen Problemen in christlichen Gemeinden ganz unrealistischen Erwartungen ausgesetzt. Da ist die Frage nach den Ursachen, ja vielleicht sogar der eigenen Schuld. Andere hoffen auf Heilung, letztlich mit dem Ziel, dass die Schwachen wieder zurückkehren ins Idealbild der Starken. Und eine dritte Gruppe erwartet wenigstens einen Sinn und eine tiefe Glaubenserfahrung im Leiden – auch das ist nicht immer so leicht zu erreichen.
Manchmal wundern wir uns, dass es in christlichen Gemeinden so viele Menschen gibt, die an sich selbst und ihren psychischen Nöten leiden. Ist vielleicht sogar ein falscher Glaubensstil schuld?! Doch wer die Bibel liest, dem fällt auf, wie bereits Jesus innerlich tief berührt wurde vom Leid der Menschen. Sie waren »wie Schafe ohne Hirten«. Und Jesus war es, der nicht die Starken in seine Nachfolge rief, sondern ausgerechnet diejenigen, die »mühselig und beladen« sind. So dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir diese beladenen Menschen auch in unseren Gemeinden treffen. Christliche Gemeinde ist der Ort, wo sie den »Frieden für ihre Seelen« erwarten, den Jesus ihnen verheißt.
Doch da sind so viele offene Fragen. Und diese werden im vorliegenden Buch in gründlicher Weise angesprochen, theologisch, psychologisch und medizinisch. Dabei geht es nicht darum, die Fragen einfach zuzupflastern mit billigen Antworten. Oft hängt die Klage »Warum, o Gott?« unbeantwortet im Raum, und das darf so sein. Schon im Alten Testament finden wir die Klagepsalmen, in denen sich das Moll des Seufzens nicht so einfach zu einem Schlussakkord in Dur auflöst. Als Theologe entwirft Wilfried Veeser zuerst einmal eine differenzierte und didaktisch detailliert aufgebaute theologische Grundlage des Umgangs mit dem Leiden.
Dabei bleibt er aber nicht stehen. Vielmehr gibt er ganz praktische Hilfestellungen, für die Betroffenen und für ihre Angehörigen. Sie leiden oft stumm an ihren Schuldgefühlen sowie an Gefühlen der Trauer und der Ohnmacht. Gerade für Angehörige enthält das Buch viele wertvolle Ressourcen. Und da ist noch eine weitere Gruppe, die er anspricht: das Betreuungsteam einer Gemeinde, noch längst nicht selbstverständlich. Veeser macht den Gemeinden Mut, »betroffene Menschen zusammen mit ihren Angehörigen wertschätzend zu bejahen und sie – wo möglich – ›ganz normal‹ ins Gemeindeleben einzubeziehen. Unreflektierte Ausgrenzung widerspricht dem Gebot der Nächstenliebe.«
Dabei soll eine Gemeinde aber nicht zur Selbsthilfegruppe werden. Denn es gibt auch Grenzen des Engagements, die genauso offen angesprochen werden. Gerade Angehörige dürfen diese Grenzen zum Ausdruck bringen und bewusst auf sich selbst achten, um dann wieder neue Energie zu tanken für die Begleitung.
Familie und Gemeinde bilden allerdings nur einen Teil des Netzwerkes, das einen Menschen im Leiden trägt. Veesers Fazit: »Je schwerer es einen Menschen trifft, desto körpernaher muss man ihm helfen.« Die Zusammenarbeit mit dem Facharzt, der Einsatz von Medikamenten und im Bedarfsfall auch ein Aufenthalt in einer Fachklinik ist von unentbehrlicher Bedeutung für eine ganzheitliche Betreuung. Es wäre völlig falsch, hier einen Keil zwischen »christlich« und »unchristlich« zu konstruieren. Gott ist mit der einzelnen Person, im dunklen Tal des Leidens und auch im helfenden Umfeld, das die Medizin unserer Zeit anbieten kann. Und wenn auch keine direkte Heilung oder Glaubenshilfe möglich ist, so kann die Gemeinde auch durch Fürbitte und praktische Unterstützung Anteil nehmen.
Nach einem solchen Aufenthalt kann Gemeinde wieder zur »Großfamilie« werden, die stützt und trägt. Sie kann der Ort sein, wo man etwas miteinander unternimmt und nicht allein ist. Aber sie ist auch der Ort, wo die Verkündigung Leitlinien für den Umgang mit Schwachheit gibt, und damit Geduld im Leiden, die die Hoffnung nicht aus dem Auge verliert. »Gemeinden, die sich bewusst der Herausforderung stellen, Menschen mit psychischen Schwierigkeiten zu integrieren, müssen lernen, auf jede Form frommer Gesetzlichkeit zu verzichten und sich ›gnadenlos‹ auf die Seite der Gnade zu schlagen und diese dem betroffenen Menschen nachhaltig zuzusprechen.«
Wie dies aussehen kann, hat Wilfried Veeser in zahlreichen Interviews und praktischen Beispielen erläutert – und gerade das macht das vorliegende Buch so wertvoll. Ich wünsche diesem Buch eine weite Verbreitung, nicht nur in jeder pastoralen Bibliothek, sondern darüber hinaus bei all denen, die dazu beitragen wollen, Menschen in ihrer Schwachheit zu tragen und zu ermutigen.
Dr. med. Samuel Pfeifer,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie
Leitender Arzt der Klinik Sonnenhalde,
Kompetenzbereich Psychiatrie, Spiritualität und Ethik
Riehen, Ende Juni 2013
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
Vorwort
Laut Auskunft des Robert Koch-Institutes Berlin sind jedes Jahr ca. 33,3 % der Bevölkerung von mindestens einer psychischen Störung betroffen.1 Dies löst enorme volkswirtschaftliche Kosten aus. Allein für das Jahr 2008 werden die Krankheitskosten für Depressionen mit 5,2 Milliarden Euro angegeben.2 Viele Betroffene erfahren keine oder nur unzureichende Hilfe. Symptome werden aus Scham oder Angst unterdrückt. Selten spricht man offen darüber, so man überhaupt jemanden findet, der Verständnis für diese Situation aufbringt.
In dem vorliegenden Buch geht es um Beziehung und Begegnung. Gerade mit den Menschen, die nicht im Mainstream der Gesunden dieser Gesellschaft und der christlichen Gemeinden stehen. Wenn man nicht hinschaut, vergisst man schnell, dass auch diese Menschen, die eher am Rande stehen, Menschen sind, die unseren ganzen Respekt und Wertschätzung verdienen. Keiner sucht sich dieses »Schicksal« aus, welches die Betroffenen, ihre Angehörigen und Freunde tragen müssen.
Wer jedoch auf einmal selbst betroffen ist oder von betroffenen Mitarbeitern erfährt, die wegen einer Depression für mehrere Wochen ausfallen, verändert die eigene Wahrnehmung. Der kann leichter akzeptieren, dass es psychisch Kranke gibt, psychiatrische Hilfe notwendig sein kann und auch christliche Gemeinden für die Begleitung von Betroffenen offen sein sollten.
Es gibt aber auch die andere Reaktion. Nicht Einsicht und Umdenken, sondern Abwehr und Rückzug. Dann verändert sich die Sprache, es fällt vielleicht der Begriff »Klapse« oder man bezeichnet Medikamente für psychisch Kranke eher abfällig als »Chemie«, die man hoffentlich nicht »fressen« muss.
Wenn Betroffene sich aus Scham oder aufgrund von mangelndem Verständnis zurückziehen, ist dies im Grunde eine Schande für die Gesunden. Gehört man zu den Angehörigen dieser Betroffenen, macht sich Ratlosigkeit breit.
Dass man zumindest für die Betroffenen betet, ist aus christlicher Perspektive selbstverständlich. Doch es braucht eben auch Beziehung und Begegnung, Wissen, seelsorgerliche und kommunikative Kompetenzen, Einfühlsamkeit – kurz: Liebe. Nur durch sie kann man Betroffene annehmen, wie sie sind, und die Spannungen, die sich aus ihrem Verhalten ergeben, zulassen. Und diejenigen, die psychisch Erkrankte begleiten, benötigen die Fähigkeit, für sich selbst zu sorgen (Psychohygiene) und sich qualifiziert abzugrenzen, als Angehörige und in der Gemeinde. Nur so erwächst immer wieder von Neuem die Kraft, die Betroffenen gut zu begleiten.
Es ist wichtig zu unterscheiden: Nicht die betroffenen Menschen sind das Problem, sondern ihr Verhalten. Nicht sie machen Mühe, sondern die Krankheit. Nicht sie sind schuld, sondern die psychische Störung fordert die Beteiligten auf, verlässlich aneinander festzuhalten und so lange es geht, die Auswirkungen der Krankheit zu begrenzen und miteinander diese Ausnahmesituationen zu bestehen. Dafür setzt sich das Buch ein.
Ich danke allen Interviewpartnern, die als Angehörige und Betroffene ihr Herz geöffnet haben. Sie berichteten aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Vieles durfte ich von ihnen lernen!
Ein besonderer Dank gilt den Mitgliedern des zitierten Care-Teams, die ebenso ihre Mut machenden Erfahrungen beigesteuert haben.
Danken möchte ich auch allen, die zum Gelingen dieses Buches beigetragen haben: Für anregende und fachliche Gespräche mit meinen Kolleginnen in der Bildungsinitiative, Cornelia Stracke, Diplomsozialarbeiterin, Beraterin und Supervisorin, und Monika Riwar, Theologin, Beraterin und Supervisorin in der Schweiz. Für wichtige Impulse aus manchem Gespräch mit meinem Kollegen in der Bildungsinitiative, Dr. med. Matthias Samlow, Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie. Ebenso gilt mein Dank Beate Seitz, Diplomsozialpädagogin, und Erika Ritzhaupt für ihre Unterstützung bei den Interviews.
Für Korrekturen, inhaltliche Inputs und die Teilhabe an ihren Erfahrungen zum Thema danke ich meiner lieben Frau Dorothea und meinen Kindern Sieglind, Kerstin, Meike (der frischgebackenen Diplompsychologin) und Jens, meinem Kollegen und Freund in der Schweiz, Heinz Nedok, sowie der inhaltlich sehr engagierten Cheflektorin des Verlags SCM Hänssler, Uta Müller.
Schließlich bin ich Samuel Pfeifer als ausgewiesenem Fachmann und langjährigem Chefarzt der Riehener Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie (Riehen, Schweiz) für sein Geleitwort zu diesem Buch außerordentlich dankbar. Es ist uns ein großes Anliegen, dass soziale Gruppen insgesamt und ganz besonders christliche Gemeinden durch die Hinweise in diesem Buch ermutigt werden, psychisch kranken Menschen Rückhalt zu geben, für sie ein Stück Lebensraum zu schaffen und mit ihnen konstruktiv in Beziehung zu sein.
Kirchheim unter Teck im Mai 2013
Wilfried Veeser
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
1. Einleitung
Psychische Störungen kommen viel häufiger vor, als man gemeinhin denkt. Und es gibt das Phänomen, dass sie nach wie vor in der Gesellschaft wenig akzeptiert werden. Das eingegipste Bein nach dem Unfall auf der Skipiste ist salonfähig. Man sammelt sogar Autogramme darauf. Eine Depression ist weniger attraktiv.
Peter ist 22 Jahre alt und seit ca. fünf Jahren psychisch krank. Er leidet an einer schweren Depression. Peter musste schon zwei Ausbildungen abbrechen und brachte bereits einen Aufenthalt in der Psychiatrie sowie acht Wochen in einer psychotherapeutischen Rehabilitationsklinik hinter sich. Im Moment besucht er ambulant eine psychotherapeutische Behandlung. Seine Eltern sind sehr besorgt und verbittert. Sie können nicht verstehen, warum es für Peter keine wirkliche Hilfe gibt. Und der Hinweis des Hausarztes, dass Peter womöglich ein weiterer Aufenthalt in der Tagesklinik bevorstehen könnte, belastet sie sehr.
Kathy ist 45 Jahre alt und war schon immer etwas »ängstlich«, wie ihr Mann sagt. Doch seit ca. einem Jahr haben sich ihre Panikzustände so verschlimmert, dass sie kaum noch das Haus verlässt. Allein die Vorstellung, einkaufen zu gehen oder sich mit Freunden in einem Café zu treffen, lösen diese Ängste aus. Ihr Mann weiß sich nicht mehr zu helfen. Zum Glück war Kathy bereit, jetzt wenigstens einen Facharzt aufzusuchen.
Seit der Geburt ihres dritten und letzten Kindes vor einem Jahr hat sich Johanna sehr verändert. Immer wieder entwickelt sie Vorstellungen und Verhaltensweisen, welche laut Hausarzt einer Psychose entsprechen. Er schreibt eine Überweisung in eine psychiatrische Klinik. Erwin, Johannas Mann, hat jetzt große Sorgen, was da alles auf seine Frau und auf die ganze Familie zukommen könnte. Er sei »ziemlich durch den Wind«, wie er sagt, und fragt in seiner Gemeinde nach einem Berater, der ihm hier vielleicht weiterhelfen kann.
Voller Entsetzen berichten Paul und Annette, dass sich ihre 14-jährige Tochter offenbar regelmäßig ritzt. Bisher gingen sie davon aus, dass Julia bestens im Teenager-Kreis integriert sei. Doch nachdem sie von der Leiterin dieses Kreises gefragt wurden, ob ihnen am Verhalten ihrer Tochter etwas aufgefallen sei, schaute Annette aufmerksamer auf das Verhalten ihrer Tochter. Und tatsächlich. Sie sah plötzlich die kleinen Narben am linken Arm und eine frische Verletzung am rechten.
Immer wieder machen Betroffene und ihre Angehörigen dieselbe Erfahrung, auch in christlichen Gemeinden. Eine psychische Erkrankung wird wenig akzeptiert. Sie löst vielmehr Unverständnis und Hilflosigkeit aus. Immer noch werden in manchen christlichen Gemeinden psychische Störungen »dämonisiert«, d. h., unmittelbar der Wirkung des Teufels zugeschrieben. Die Not der Betroffenen wird dadurch nicht weniger, im Gegenteil. Betroffene werden stigmatisiert und manchmal trifft dies sogar ihre Angehörigen.
Dass es auch anders geht, zeigen andere christliche Gemeinden. Sie haben sogenannte »Gemeinschaftsteams« und »Care-Teams« entwickelt, durch die sie ihren betroffenen Mitgliedern und deren Angehörigen gezielt Hilfe durch beziehungsorientierte Begleitung anbieten. Sobald sich verunsicherte Menschen ihren Fragen stellen und sich z. B. durch Literatur und Fortbildungen informieren, wird es für sie leichter und geht es entspannter zu. Dann gelingt es, Betroffene in das Miteinander einer Gemeinde, einer Gemeinschaft, einer Familie oder eines Hauskreises zu integrieren. Dies ermöglicht ihnen, am gemeinsamen Leben zu partizipieren.
Dieses Buch nimmt zwar psychisch kranke Menschen und ihre Angehörigen besonders in den Blick, doch eine ähnliche Unsicherheit findet sich auch im Umfeld von chronisch kranken Menschen, einsamen, alten, behinderten, gescheiterten, geschiedenen Menschen und all jenen, die nicht zum christlichen Ideal oder zum Mainstream der Gemeinde passen. Sie haben es schwer, sich in einer christlichen Gemeinde zu beheimaten oder beheimatet zu bleiben.
Einzelne Menschen überwinden ihre Unsicherheit und wenden sich psychisch erkrankten Menschen zu, unterstützen sie und wollen plausible Gesprächspartner für sie sein. Für diesen Einsatz finden sie nicht immer einen tragenden Rückhalt in ihrer eigenen Gemeinde.
Beziehungsorientierte Gemeindearbeit wird schnell bejaht, solange man mit den längst vertrauten Menschen in Beziehung bleiben kann und sich Fremden nicht zuwenden muss. Das große Herzeleid von Angehörigen, die psychisch kranke Menschen in der Klinik oder zu Hause haben, wird oft erst dann spürbar, wenn man selbst vom Beobachter zum Betroffenen wird. Dabei könnte Gemeinde eine Art »Großfamilie« sein, die diese Beziehungsorientierung im Miteinander schafft.
Dieses Buch will zeigen, wo Vorbehalte gegenüber psychisch kranken Menschen und ihren Angehörigen bestehen und wie sich eine christliche Gemeinde konstruktiv zu einer beziehungsorientierten Gemeinde entwickeln kann.
Wenn ein Mensch an einer psychischen Beeinträchtigung, Störung oder Behinderung leidet, verändert sich sein Verhalten. Waren bisher Fröhlichkeit, Eigenständigkeit und Fleiß markante Kennzeichen dieses Menschen, werden nun aufgrund der psychischen Störung z. B. Traurigkeit, Unsicherheit oder Antriebslosigkeit spürbar. Das irritiert Angehörige, Kollegen, Nachbarn oder Freunde im Verein.
Und wenn ein Betroffener in die akute Phase z. B. einer Schizophrenie gerät und plötzlich bedrohliche Stimmen hört, Dinge sieht, die die anderen nicht wahrnehmen, sonderbare Gedankengänge an den Tag legt oder sich überall verfolgt, beobachtet oder belauscht fühlt, sind Angehörige und andere Nahestehende stark verunsichert. Erlebt man dies aus nächster Nähe, macht es betroffen.
Das vorliegende Buch will Angehörigen für den Umgang mit psychisch Erkrankten Orientierung geben und Gemeinden Ideen vorlegen, wie sie Betroffene besser in ihr Miteinander integrieren können. Sind die eigenen Bilder von psychischen Störungen bisher eher angstbesetzt oder bedrohlich, ist dies vermutlich nicht einfach. Umso wichtiger ist die Bereitschaft, den vorliegenden Informationen offen zu begegnen.
[Zum Inhaltsverzeichnis]
2. Informationen
Wer mit dem Thema »Psychische Erkrankungen« in Berührung kommt, begegnet unterschiedlichen Begriffen. Für manche, die in meiner Praxis Hilfe suchen, ist zunächst unklar, was Psychologen, Psychotherapeuten, Psychiater, Berater oder Heilpraktiker eigentlich sind und worin deren berufliche Tätigkeit besteht. Daher sollen an dieser Stelle zunächst die zentralen Begriffe vorgestellt und geklärt werden, die für das weitere Verständnis wichtig sind. Ebenso soll ein besseres Verständnis für die jeweilige Tätigkeit geweckt werden.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!