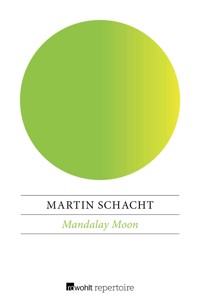9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Berlin-Mitte Wo einstmals fahlfarbene Kunststoffautos durch graue Straßen knatterten, tummelt sich heute auf engem Raum ein buntes Völkchen: Modemacher, Partypeople, Groß- und Kleinkünstler, Touristen, Werbeleute und höhere Töchter – sie alle treffen sich in der neuen Mitte, immer auf der Jagd nach einem schicken Job, der ultimativen Schlangenlederhose, nach wahrer Liebe, dem Sinn des Lebens und nach einem Platz auf der Gästeliste. Geschichten aus der deutschen Hauptstadt, in deren Herzen sich vieles findet, nur kein vernünftiger Supermarkt. «Sie kann sich an spektakuläre und vor allem exklusive Abende hier erinnern. Wie damals, als die Klofrau Naomi an den Haaren aus dem Klo gezogen hat, weil sie Drogen nehmen wollte, ohne für die Toilettennutzung zu zahlen. Die B-Gäste klapperten beim Rausgehen, weil alle Geschirr und Besteck eingesteckt hatten. Das ist Berlin.»
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 272
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Martin Schacht
Mittendrin
Berlinroman
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Wo einstmals fahlfarbene Kunststoffautos durch graue Straßen knatterten, tummelt sich heute auf engem Raum ein buntes Völkchen: Modemacher, Partypeople, Groß- und Kleinkünstler, Touristen, Werbeleute und höhere Töchter – sie alle treffen sich in der neuen Mitte, immer auf der Jagd nach einem schicken Job, der ultimativen Schlangenlederhose, nach wahrer Liebe, dem Sinn des Lebens und nach einem Platz auf der Gästeliste. Geschichten aus der neuen deutschen Hauptstadt, in deren Herzen sich vieles findet, nur kein vernünftiger Supermarkt.
«Sie kann sich an spektakuläre und vor allem exklusive Abende hier erinnern. Wie damals, als die Klofrau Naomi an den Haaren aus dem Klo gezogen hat, weil sie Drogen nehmen wollte, ohne für die Toilettennutzung zu zahlen. Die B-Gäste klapperten beim Rausgehen, weil alle Geschirr und Besteck eingesteckt hatten. Das ist Berlin.»
Über Martin Schacht
Martin Schacht, geboren 1965 fernab von Berlin, ist u.a. als Skandal-Journalist, TV-Astrologe, Stylist und Ghostwriter hervorgetreten.
Inhaltsübersicht
Ähnlichkeiten mit lebenden Personen gibt es nicht.
Kapitel 1 Landei
Wer in eine fremde Stadt zieht, ist entweder verzweifelt oder davon überzeugt, dass dieser Ort auf ihn wartet und etwas zu bieten hat, das er woanders nicht bekommt. Man packt seine Siebensachen in der Hoffnung, dass sich anderswo der Schleier hebt und den Blick auf die Zukunft, das Leben und seinen Sinn im Allgemeinen freigibt. Es gibt viele Wege, mit dem Leben nicht fertig zu werden, aber der langweiligste ist sicher, gar nichts zu tun.
Felix hat sich in der Nähe einer S-Bahn-Station absetzen lassen. Ab heute wird alles anders, denkt er, und was immer Berlin für ihn bereithält: Irgendetwas wird sich schon ergeben, da ist er sich sicher. Die Fahrt von Hamburg in einem alten Golf hat sich dank eines mehrstündigen Staus fast fünf Stunden hingezogen und schien kein Ende zu nehmen, zumal der Typ von der Mitfahrzentrale fast ununterbrochen redete. Felix nimmt seinen Rucksack aus dem Kofferraum, streckt seine verspannten Glieder und versucht sich zu orientieren. Er steht an einer sechsspurigen, schnurgeraden Straße mit breitem Mittelstreifen, auf dem Autos parken. Zu beiden Seiten erstreckt sich eine weitläufige Grünanlage. Rechts kann man die Siegessäule sehen, links hinter der S-Bahn-Brücke eine Art Säulentor, zu dessen Füßen sich voluminöse Sandsteinfiguren rekeln.
Felix hat seinen Zivildienst bei einem Austauschprojekt in Australien geleistet und ist anschließend ein paar Monate durch Asien getravelt. Die letzten Wochen hat er auf einer thailändischen Insel verbracht und wenig mehr getan, als im lauwarmen Wasser zu dümpeln.
Obwohl es noch zu früh ist, sich fürs Wintersemester zu immatrikulieren, verspürt er nach den fast zwei Jahren im Ausland eine gewisse Unruhe. Nichts hat sich wirklich verändert, und dass alles so weitergegangen ist, wie er es sich vorgestellt hat, kommt ihm geradezu unheimlich vor. Seine alten Freunde sind schon aus Hamburg fortgezogen, um zu studieren, manche arbeiten, und mit anderen hat er sich nichts mehr zu sagen. Höchste Zeit, die Zelte anderswo aufzuschlagen.
Irgendwie kommt die Gegend ihm bekannt vor. Felix hat eine Art Déjà-vu und versucht sich zu erinnern, ob er schon einmal hier gewesen ist, doch es hat keinen Sinn. Sein letzter Besuch in Berlin ist fast zehn Jahre her, da war er dreizehn, und er hat bemerkt, dass seit der Pubertät für ihn alles anders aussieht – einschließlich der Sandsteinfiguren. Damals wäre ihm sicher nicht aufgefallen, dass sie enorme Oberweiten haben. Er probiert es von einer Telefonzelle aus noch einmal auf der Handynummer von Tom, doch wie schon seit Tagen ertönt nur eine gleichgültige Ansagestimme: «Teilnehmer ist vorübergehend nicht erreichbar.»
Entweder das Ding ist abgestellt, oder Tom hat schon wieder eine neue Nummer. Felix kann sich allerdings keinen plausiblen Grund vorstellen, warum man alle paar Wochen eine neue Handynummer braucht. So oft kann man die Dinger nicht verlieren. Noch vor ein paar Tagen hat er mit Tom gesprochen und gesagt, dass er heute ankommt.
Straße des 17. Juni steht auf einem Straßenschild, als er in Richtung S-Bahn schlendert, und der Stationsname Tiergarten verschafft ihm schließlich ein Aha-Erlebnis. Er kennt diese Ecke aus dem Fernsehen, aus Berichten über die Loveparade. Aber die Loveparade findet im Juli statt, und mit Leuten, Sonne und Gedröhn wirkt alles sehr viel freundlicher.
Felix löst eine Karte und nimmt den nächsten Zug in Richtung Erkner. Zwar hat er die Kräne und Baugruben rund um den Reichstag oder das Kanzleramt oft genug auf Bildern gesehen, doch in natura ist ihre schiere Größe erschlagend. Selbst auf die Entfernung kann man in der Reichtstagskuppel die Besucher als kleine schwarze Punkte erkennen, die vor dem Hintergrund des Himmels herumkrabbeln. Dass Berlin ausgerechnet auf ihn gewartet haben soll, erscheint ihm plötzlich gar nicht mehr so selbstverständlich, und er ist froh über die fünfhundert Euro, die ihm notfalls über den ersten Monat helfen werden. Bis dahin sollten sich ein Job und ein Zimmer gefunden haben. Wenn er bloß Tom erreichen würde! Die einzige andere Person, die er hier kennt, wegen eines Schlafplatzes anzurufen erscheint ihm nicht wirklich angebracht. Er wird einfach ein bisschen herumlaufen und es später noch einmal probieren. Irgendwann muss Tom das Ding doch mal anschalten.
Am Hackeschen Markt steigt Felix aus. Als er aus dem S-Bahnhof tritt und sich umsieht, erblickt er den Fernsehturm, der so hoch ist, dass man die Spitze nur sehen kann, wenn man den Kopf verrenkt. Die Sonne zaubert ein Lichtkreuz auf die silbrig glänzende Kugel; zu DDR-Zeiten haben sie das höchste Bauwerk der Republik deshalb hämisch die Rache des Papstes oder Kreuz-Jesu-Turm genannt. Felix folgt den Schienen der Tram und kauft sich ein Stück Pizza, das er, an ein Baugerüst gelehnt, verspeist. Zu beiden Seiten der Straße gibt es kleine Läden mit Klamotten, Accessoires und Souvenirs. Den ziellos schweifenden Blicken der Passanten nach zu schließen, sind die meisten Touristen wie er selbst. Die anderen, die die Schaufenster ignorieren und geschickt die Lücken zwischen den gaffenden Grüppchen nutzen, um sich irgendwo durchzuquetschen, das sind offenbar die Einheimischen. Felix schließt sich dem trägen Strom an und biegt in eine Seitenstraße, ohne genau zu wissen, wohin er eigentlich will. Er stoppt an einer Galerie mit schwarz abgeklebten Fenstern. Durch einen Sehschlitz kann man eine Ausstellung mit eigentümlichen Objekten sehen. Von der Decke hängt kopfüber eine Art gehäkelter Gospelchor mit aufgestickten Augen und Mündern, der zuckt und singt, wenn man einen Schalter am Fenster betätigt. Die Puppen erinnern ihn an die Aua-Puppen, die seine Großmutter für ihn gebastelt hat, als er klein war. Ihren Namen hatten sie daher, dass er immer ihre weichen Arme und Beine knautschte und verknotete und dazu «Aua! Aua!» rief. Er hat Jahre nicht mehr an die Aua-Puppen gedacht und auch nicht an seine Großmutter.
Felix gerät immer mehr in eine Art Abenteuerlaune, je länger er durch die engen Straßen streift. Ganz egal, ob er Tom nun erreicht oder nicht – es wird nicht so schwer sein, in all diesen Kneipen, Restaurants und Bars eine Übernachtung zu finden. Außerdem kann er den Rucksack am Bahnhof einschließen und die Clubs auschecken. Und selbst wenn sich nichts ergibt: Es wäre nicht das erste Mal, dass er eine Nacht durchgemacht hat.
Bei einem Milchkaffee studiert er die herumliegenden Flyer und macht sich anschließend wieder auf den Weg zum S-Bahnhof. Ganz automatisch sieht er dabei nach den Straßenschildern, und plötzlich durchfährt ihn ein kleiner Schreck, so als würde jemand, den man die ganze Zeit heimlich zu treffen gehofft hat, unerwartet auftauchen. Vielleicht, überlegt er, ist es kein Zufall, dass er ausgerechnet in der Gärtnerstraße gelandet ist. Er hat den Zettel mit der neuen Adresse in den letzten Tagen mehr als einmal in der Hand gehalten. Am Ende der Straße ist ein Sportplatz, auf dem ein Fußballspiel stattfindet. Da drüben ist Nummer sechzehn. Das leere Namensschild muss es sein. Felix zögert kurz und streckt dann die Hand zum Klingelknopf.
Kapitel 2 Eigener Herd
Wie mit dem Makler vereinbart, hat Stella bei dem Hausmeisterehepaar die Schlüssel abgeholt und steigt jetzt in den dritten Stock hinauf. Irgendwie ist sie froh darüber, dass keiner von den beiden mitkommt, denn sie will diesen ersten Moment in der Wohnung, die jetzt offiziell ihre ist, für sich allein haben. Das Schlüsselbund hat drei Schlüssel, einen großen, der irgendwie gebraucht aussieht, einen von diesen neumodischen mit Noppen anstelle eines Bartes und einen, der nach Keller aussieht. Sie probiert es mit dem gebrauchten und behält Recht. Der Schlüssel passt. Sie öffnet die Tür und geht auf einem schmalen Streifen Sonnenlicht, der vom Fenster bis in den Flur fällt, zum Balkon, dreht sich um und nimmt mit einem Blick alles in Besitz. Es sind genau fünfzehn Schritte von der Eingangstür bis zum Balkon. Stella achtet auf solche Kleinigkeiten; ihr ist auch gleich aufgefallen, dass die Treppe zum zweiten Stock eine Stufe weniger hat als die anderen.
Der Balkon ist dreckig: Federn, Körner, Vogelscheiße. Offenbar haben Tauben hier gebrütet. Über dem Abfluss klebt eingetrockneter organischer Schleim, und in einer Ecke kümmert eine halb vertrocknete Yucca-Palme vor sich hin. Stella beschließt, sie zu behalten und gesund zu pflegen, um etwas Gutes zu tun und das Schicksal zu bestechen. Manchmal kauft sie auch Obdachlosenzeitungen oder gibt Pennern Geld nach dem Motto: Okay, Vorsehung, du altes Luder! Wenn ich das und das tue, hilfst du mir und machst, dass das und das passiert. Viel lieber ist ihr allerdings, wenn das Schicksal in Vorleistung geht: Hallo Schicksal, wenn ich den Job bekomme, spende ich zehn Prozent meines ersten Monatsgehalts an Ärzte ohne Grenzen. Das wäre doch für alle Beteiligten ein guter Deal.
Sie entscheidet, das Problem der Balkonreinigung zu vertagen, geht wieder hinein und mustert die Zimmer. Dabei hat sie alle erkennbaren Mängel und Vorzüge bereits mit dem Makler erörtert.
Die Wohnung ist ein Schlauch, hoch und mit zugekleistertem Stuck an der Decke – ganz klar, dass man sie geteilt hat. Alles ist mit weiß gestrichener Raufaser tapeziert, der Eingang offenbar ein ehemaliger Dienstbotenaufgang in den Seitenflügel. Unwillkürlich muss Stella an eine reiche Familie mit einer Kaltmamsell denken. Was war eigentlich eine Kaltmamsell? Und haben die reichen Leute nicht eher im Westen gewohnt? Egal.
Alle Zimmer gehen vom Flur nach rechts ab. Zuerst kommt das Bad, einfach, mit schlichten weißen Kacheln und einer neuen Wanne, danach die Küche und hintereinander die beiden Zimmer. Für einen ordentlichen Boden hat es anscheinend nicht gereicht. Das beigefarbene Linoleum verbreitet den Charme einer Krankenhaustoilette, aber Stella hat schon Löcher gesehen, gegen die diese Ausstattung hier direkt aus der Elle Décoration zu kommen scheint. Bis auf das Balkonzimmer zur Straße haben alle Räume Ausblick auf eine Brandmauer, die sich hinter einer Häuserlücke erhebt und komischerweise ein einziges Fenster besitzt, das wie eine Schießscharte auf Höhe des dritten Stocks prangt.
Was soll’s, denkt Stella, Hauptsache, eine eigene Wohnung. Günstig ist sie auch – und das in Mitte. Sie wird sich wohl fühlen hier. Das Bett und die paar Möbel, die noch bei ihren Eltern auf dem Dachboden stehen, kommen nächste Woche, und alles andere kann sie nach und nach anschaffen. Später will sie ihre Taschen aus dem Studentenwohnheim abholen, in dem sie sich für ihre Probezeit einquartiert hat. Doch erst einmal wird sie einkaufen gehen, vielleicht in der Markthalle in der Ackerstraße oder dem Bioladen, den sie auf dem Weg gesehen hat. In der Tucholskystraße gibt es einen Italiener, bei dem man mittags nett sitzen kann.
Stella betrachtet leicht angewidert die Tür des hellblauen Resopal-Hängeschranks, den ihre Vormieter in der Küche zurückgelassen haben. Der Kühlschrank ist okay, mit Sagrotan ist da was zu machen, aber dieser Schrank! Die Oberfläche sieht nach Fettfingern aus und nach öligem Schmierschmutz, wie er sich beim Kochen ohne Dunstabzugshaube festsetzt und dem nur mit ätzenden Chemikalien beizukommen ist. Sie wird ihn wegwerfen. In Erwartung von schwarzen Käfern oder auffliegenden Lebensmittelmotten öffnet sie mit einem Ruck die Schiebetür, doch im Schrank ist nichts außer Krümeln und ein paar Plastiktüten. Stella nimmt eine Tüte, steckt ihre Schlüssel und das Portemonnaie ein und zieht mit einem wohligen Gefühl die Wohnungstür hinter sich zu.
Für April ist es überraschend mild, feucht und ein wenig diesig. Stella öffnet ihren Mantel und schlendert die Linienstraße hinab, vorbei an einem aufgemotzten Backsteinbau mit der Aufschrift Preußische Pfandleihanstalt, der neben ein paar Agenturen ein brasilianisches Restaurant und eine Jazzkneipe beherbergt. Sie hat sich überlegt, etwas Neues auszuprobieren und es mit vegetarischem Fleischersatz zu versuchen. Angesichts von BSE und MKS sicher keine verkehrte Idee.
Kapitel 3 Kindergeburtstag
«Salz», sagt Daniel und sieht Hanno erwartungsvoll an, «wir nehmen Salz.»
«Wie?», meint Hanno zögerlich. Er versteht überhaupt nichts. Er sitzt da, die Arme vor dem Bauch verschränkt, und atmet schwer. Er ist zu schnell gegangen. Warum eigentlich? Sie hätten auch auf ihn gewartet. «Salz?»
Hanno John ist über eins fünfundachtzig groß und hat etliche Kilo zu viel auf den Rippen. Genau genommen ist er dick, was ihn in einer Branche, in der Menschen mit einem Body-Mass-Index über neunzehn an sofortige Liposuction denken, zu einer unübersehbaren Erscheinung macht. Seine barocke Figur verleiht ihm zusammen mit den rötlich blonden Löckchen und den babyblauen Augen das Aussehen einer riesigen Putte. Oder vielleicht eher einer Art bayrischem Killerwal, denkt Alexander. Er ertappt Daniel dabei, wie er unter dem Tisch versucht, einen Fleck auf seinem Schuh mit dem Hosenbein abzuwischen, und versetzt ihm einen kurzen Tritt. Er soll sich gefälligst konzentrieren.
«Na ja», erklärt Alexander geduldig, «Der Berg ist doch – wie der Name schon sagt – ein Bergfilm. Und auf Bergen gibt es Schnee. Und Salz kann, je nachdem, in welchem Zustand man es verarbeitet, aussehen wie Eis, Glas, Schnee, Kristalle oder alles Mögliche. Es gibt Salz in Platten, Brocken, als Pulver und in Klumpen. Wir schütten einfach die ganze Kirche mit Salz voll. Dazu nehmen wir die Plexiglas-Tresen von der FTA, die wir damals auch für die Disney-Party ausgeliehen haben.»
Innerlich stöhnt Alexander auf. Dass die Leute von den Agenturen nicht für fünf Pfennig Phantasie haben! Dabei hätte es eigentlich Hannos Aufgabe – oder die seiner debil-hübschen Angestellten – sein sollen, sich ein Motto für diesen Premieren-Event zu überlegen. Schließlich wird seine Agentur dafür bezahlt. Daniel und Alexander sind doch eigentlich nur für den Partyservice angeheuert worden. Das ist jetzt schon der dritte Vorschlag für die Berg-Party, aber der Kunde ist anscheinend extrem schwierig. Und überhaupt: Wieso kümmert Hanno sich plötzlich selbst darum? Sie haben die Salzidee vor weniger als einer Woche ausführlich seiner Assistentin erläutert, die ganz begeistert wirkte. Allerdings war die so grün hinter den Ohren, dass sie sich vermutlich über jeden Vorschlag gefreut hätte, der vom Ansatz her über das Niveau eines Kindergeburtstags hinausging.
«Ich meine», setzt Hanno erneut an, «vielleicht regnet es ja. Dann würde sich Salz womöglich auflösen. Und wie viel brauchen wir eigentlich davon?»
«Sechs Tonnen», sagt Daniel wie aus der Pistole geschossen, «ich habe alles durchgerechnet.»
Er zieht einen Folder aus der schwarzen Prada-Nylon-Aktentasche, der neben ein paar eindrucksvollen Location-Skizzen einen sechsstelligen Kostenvoranschlag für Deko und Catering enthält und den er Hanno lässig präsentiert. Hanno blättert mit wichtiger Miene darin herum und steckt sich eine Zigarette an, um Zeit zu gewinnen. Er ist nicht wirklich überzeugt. «Das Konzept ist der Knaller», sagt Alexander in beschwörendem Tonfall, «und sein Geld wert. Wir machen hier doch keinen Kindergeburtstag.»
Hanno winkt dem Kellner und bestellt drei Espresso. «Ihr auch, nicht?» Er faltet die Hände wieder päpstlich vor seinem Bauch und sieht von einem zum anderen. «Gut, ich werde es vorschlagen. Aber wir liegen immer noch dreißigtausend Euro über dem Budget.»
Unvorsichtigerweise hat er sich bei einer ersten Besprechung mit dem Mann vom Filmverleih zu einer groben Kalkulation hinreißen lassen, da er den Auftrag unbedingt haben wollte. Und jetzt versucht der Kunde böswilligerweise, ihn darauf festzunageln.
«You get what you pay for. Letztlich hat man nur Ärger, wenn man am falschen Ende spart.» Alexander zuckt mit den Schultern. «Das musst du denen klar machen.»
«Hmm.» Schaudernd stellt Hanno sich vor, wie Mark Wahlberg und Uma Thurman knöcheltief durch eine Kirche voller Salzlake waten. Wie sich dieser Sud auf teure Stoffe, Ferragamo-Pumps und mittelalterliche Betbänke auswirken mag? Man könnte natürlich Bergschuhe verteilen. Vielleicht, wenn man eine Cross-Promotion-Aktion mit einem Trekking-Ausrüster einfädeln würde. Abendkleider und maßgefertigte Bergschuhe für die Ehrengäste, eigentlich eine großartige Idee. Aber warum in einer Kirche? Gibt es da einen Zusammenhang? Er muss darüber nachdenken und steht auf, wobei er fast eine Tasse umwirft.
Daniel und Alexander sehen sich kurz an, verdrehen entnervt die Augen und folgen ihm. «Es denkt», zischelt Alexander. Sie haben so viele Veranstaltungen mit Hanno gemacht, dass für sie jede Phase des Entscheidungsprozesses einem vorgegebenen Muster zu folgen scheint. Tatsächlich fährt Hannos massiger Körper jetzt herum, und sein Zeigefinger schnellt auf die beiden zu.
«Grotte! Eine Kirche hat doch was von einer Grotte. Und in Bergen gibt es Grotten. Außen Bergkapelle, innen Grotte, mit Kristallen, getaucht in geheimnisvolles Licht, wie in diesem Bergfilm mit der, na …»
«Leni Riefenstahl», ergänzt Alexander beflissen, «Das blaue Licht, 1930.»
Dass Schwule so was wissen, verblüfft Hanno immer wieder. Wenigstens kann man sich bei ihnen darauf verlassen, dass sie verstehen, was er meint. Und sie wissen, was ihm steht. Das ist auch nicht einfach. Er muss mal wieder mit ihnen shoppen gehen.
«Genau», sagt Hanno zufrieden, «Riefenstahl ist ganz aktuell. Und große Laser-Projektionen von Nordlichtern.»
Als er sich wieder umdreht, stößt er beinahe mit Stella zusammen, die gehofft hat, sich unbemerkt an ihm vorbeimogeln zu können. Sie bedenkt Alexander und Daniel mit einem gequälten Lächeln, bevor sie in den hinteren Teil des Restaurants entwischt.
«Ist das nicht deine Assistentin?», fragt Daniel. «Die mit dem American Hair?»
«Haar?», fragt Hanno konsterniert. «Was für Haar?»
«Na, du weißt schon», meint Alexander, macht einen Schmollmund und streicht sich eine imaginäre Strähne aus dem Gesicht, «American Hair, wie diese Frauen in den Serien. Die haben immer so dickes, tuffig aufgeföhntes Haar, das sie dauernd schütteln müssen.»
Stimmt, denkt Hanno. Stella hat ausgesprochen schönes Haar. Und nicht nur das. Sie ist überhaupt sehr attraktiv.
«War meine Assistentin», bestätigt er kurz.
«Was hat sie denn falsch gemacht?», will Daniel wissen.
«Wie euch hinlänglich bekannt ist, sollte sie sich um den Berg kümmern.» Hanno macht eine Kunstpause, während sie das Restaurant verlassen. «Es ging wieder mal um den Etat. Sie hat dem Haffmann vom Verleih bei einem Meeting gesagt, mit seinen Vorgaben könne man maximal einen Kindergeburtstag ausrichten. So was sollte man einem Kunden nie sagen, erst recht nicht einem schwierigen. Er hat sich furchtbar aufgeregt und will sie bei diesem Projekt nicht mehr sehen. Haffmann ist ja nicht gerade für seinen Humor bekannt.»
Daniel ist ein bisschen empört: «Und deshalb hast du sie gefeuert? Findest du das nicht übertrieben?»
Alexander fügt maliziös hinzu: «Ich hatte immer das Gefühl, sie mag dich. Sie war so bemüht.»
Die drei bleiben an der Straßenecke stehen, um sich zu verabschieden. Hanno zuckt resigniert mit den Schultern und macht ein betrübtes Gesicht. «Ihre Probezeit war ohnehin abgelaufen.» Er sieht Alexander scharf an. «Kindergeburtstag! Von wem sie das wohl hat?» Dann schiebt er in Richtung Auguststraße ab und grummelt, gerade laut genug, dass die beiden ihn hören können: «Aber mit mir kann man’s ja machen.»
Kapitel 4 Haarige Zeiten
Ihr Arbeitszimmer sieht aus, als hätte ein Wahnsinniger die gesamten Teilnehmer einer Friseurmesse beraubt, skalpiert und seine Trophäen, nach Farben und Haarlängen sortiert, auf verschiedene Haufen geworfen. Auf einer Konsole, die eine komplette Wandlänge einnimmt, stehen, säuberlich aufgereiht, Styroporköpfe mit Perücken und Haarteilen, deren Bearbeitungszustand die Hand eines Meisters verrät. Drei Wände sind komplett verspiegelt, damit sie sich von allen Seiten kontrollieren kann, die vierte nimmt bis zur Decke ein Einbauschrank ein. Alles ist in gleißendes Licht getaucht. In dieser Szenerie steht, einen Arm in die Hüfte gestemmt, einen Joint in der anderen Hand und in einem leicht verschlissenen Morgenmantel, Vera Magun. Um den Kopf herum wirkt sie merkwürdig nackt.
Vera hat den Ton des Fernsehers abgestellt und verfolgt nebenbei, was sich auf dem Bildschirm abspielt. Eigentlich sieht sie sich die Gala zu Ehren von Diana Ross nur deshalb an, um zu überprüfen, wie die rüstige Soul-Diva aussieht und was sie anhat. Im Moment schmalzt Diana stumm ihre Gratulantin Mariah Carey an. Beide tragen das gleiche superkurze silberne Minikleid und tun, als seien sie allerbeste Freundinnen. Dianas Gesicht sieht zwar leicht verzogen aus, aber für Ende fünfzig sensationell. Jetzt kommt auch noch RuPaul auf die Bühne gestelzt und gesellt sich zu den beiden. Die drei tanzen synchron zu einer Video-Einspielung im Hintergrund, und Vera schließt aus ihren Gesten, dass sie Stop! In The Name Of Love, einen alten Supremes-Hit, trällern. Sie selbst hat die Nummer oft genug gemacht. Jetzt beugen sie sich gemeinsam über ein Mikrophon. Aus der Kameraperspektive von schräg oben sieht man nur noch Haare und High Heels. Diana Ross trägt tatsächlich eine noch größere Perücke als RuPaul. Das ist wirklich ein Kunststück. Vera schaltet den Fernseher aus. Sie hat genug gesehen.
Lolito leistet schon erstklassige Arbeit, denkt sie, aber dass sie all diese Perücken wegschmeißen soll, tut ihr fast körperlich weh. Erst einmal besitzen sie zusammen den Anschaffungswert eines Reihenhauses, zum anderen hängt sie an den Dingern. Sie hebt einen fusseligen schwarzen Mopp auf, kämmt ihn kurz in Form und platziert ihn vor dem Spiegel auf ihrem Kopf. Dann kneift sie die Augen zusammen, bis sie kaum noch etwas sieht, und mit etwas Phantasie kann man eine Kleopatrafrisur erahnen.
Dazu hat sie damals ein schulterfreies Kleid aus drapiertem Goldlamé getragen, das Thierry Mugler für sie entworfen hatte. Das war ein paar Tage nach der Modenschau, bei der sie für ihn gelaufen war, und direkt nach ihrem Auftritt im Olympia. Thierry gab im La Coupole ein privates Dinner für sie, und der ganze Laden applaudierte wie verrückt, als sie hereinkam. Tout Paris war da, und Grace Jones wurde später wieder einmal ausfallend. An dem Abend hat sie Lolito kennen gelernt. Er hat einfach gefragt, ob er einmal ihre Haare machen dürfe, und dabei ist es geblieben. Das goldene Kleid ist ihr Markenzeichen geworden, und sie hat es mehrfach günstig nachschneidern lassen. Wann war das? 1983, zwanzig Jahre ist das nun fast her.
Vera nimmt den Mopp ab und feuert ihn ärgerlich zurück auf den Haufen. Vielleicht hätte sie damals in Paris bleiben sollen, aber sie hat keine Lust gehabt, sich dauernd mit Ingrid Caven oder – später und schlimmer noch – mit Ute Lemper vergleichen zu lassen.
Mit gemischten Gefühlen betrachtet sie den Haarberg. Die Pharaonen haben Pyramiden hinterlassen, alles, was von ihr übrig bleiben wird, ist ein Haufen Perücken. Vera kichert bei der Vorstellung, bis sie husten muss, und drückt energisch den Joint aus.
Lolito hat natürlich Recht, das Zeug muss weg, auch wenn sie sich schwer damit tut. Die Idee, die Perücken zugunsten von Sexarbeiterinnen aus dem Osten der Huren-Selbsthilfeorganisation Hydra zu stiften, ist an sich nicht schlecht. Hauptsache, niemand erfährt, dass sie von ihr sind. Das würde nur den Gerüchten Auftrieb geben, sie habe kein einziges echtes Haar auf dem Kopf.
Dabei trägt sie privat nie Perücken. Nicht, dass sie es jemals wirklich nötig gehabt hätte, aber die langweiligen, glatten und farblosen Flusen auf ihrem Kopf, die mittlerweile auch noch grau werden, haben sie schon immer gestört. Millionen von Frauen haben solche Haare, aber Millionen von Frauen sind auch nicht Vera Magun. Zudem ist es verdammt praktisch, sich einfach einen Hut aufzusetzen, der nicht nach wenigen Minuten in sich zusammenfällt, wenn man auf der Bühne steht oder sonst etwas Offizielles vorhat. Aber vielleicht sind ihre natürlichen Haare kein Handicap, sondern ein Segen. Vera ist überzeugt, dass Menschen mit schönem Haar den ganzen Tag vor dem Spiegel verbringen und ihre Mähne bürsten. Ehrgeiz brauchen sie nicht zu entwickeln, da die Natur sie ja mit der wünschenswertesten Eigenschaft schlechthin ausgestattet hat. Jedenfalls ist sie sich sicher: Wenn sie schönes Haar gehabt hätte, wäre sie niemals Vera Magun geworden.
Kritisch betrachtet sie ihr ungeschminktes Gesicht im Spiegel. Zeit, sich in das Ding zu verwandeln. Vera hat sich immer als Figur gesehen, als etwas, das sie bei Bedarf an- und abschaltet. Zwar ist sie das Ding, aber das Ding ist nur ein Teil von ihr. Das Ding ist etwas, das sie ganz kühl analysieren kann, wie Broker Aktienkurse. In knapp drei Stunden wird der Wagen kommen, der das Ding ins Studio bringen soll. Sie hat dieser kleinen Schwuchtel von dem Lokalsender schon zweimal eine Absage erteilt, beim dritten Mal würde sie zickig werden. Es gibt kaum etwas Gefährlicheres als Schwule, die sich auf den Schlips getreten fühlen. Was ist der Unterschied zwischen Tunten und Tumoren? Antwort: Tumore sind manchmal gutartig.
Vera muss kichern, so alt der Witz auch ist. Sie beginnt, ihre Schminkutensilien mit einer Präzision zurechtzulegen, als ginge es um einen komplizierten neurochirurgischen Eingriff. Es klingelt. Vera drückt auf den Summer, lehnt die Tür an und stülpt sich nach kurzem Überlegen eine Art halblange Duschfrisur mit Stirnfransen über. Armando ist offenbar ausnahmsweise pünktlich mit seiner Lieferung und wird gleich wieder verschwinden. Später ist sie noch eingeladen, und sie hat vor, schlagfertig und witzig zu sein. Dabei kann eine kleine Erfrischung nicht schaden. Als sie in den Flur tritt, kann sie gerade rechtzeitig die Tür des Arbeitszimmers hinter sich zuziehen.
«Mein Gott, Felix!», entfährt es ihr. «Was machst du denn hier?»
Kapitel 5 Eigentum strengt an
Benannt nach einem bedeutenden Veterinärmediziner der Kaiser-Wilhelm-Universität, hat die Gärtnerstraße Kaiserreich, Weimarer Republik, Nazis und die DDR überlebt, ohne dass jemand ernsthaft auf die Idee gekommen wäre, sie einer jener Umbenennungen zu unterziehen, die aus der Lothringer Straße eine Wilhelm-Pieck-Straße und seit ein paar Jahren die Torstraße gemacht hat. Die von den Grünen und der Jüdischen Gemeinde kurz ins Gespräch gebrachte Namensänderung zu Ehren eines Widerstandskämpfers ist nach parteiübergreifenden Anwohnerprotesten vom Tisch, und Stimmen, die dahinter eine politisch motivierte Intrige hätten vermuten können, sind durch das Anbringen einer bronzenen Gedenktafel am Geburtshaus des Widerstandskämpfers zum Verstummen gebracht worden.
Das Leben eines Architekten besteht aus Bauvorschriften, Traufhöhen und Kompromissen, überlegt Fiona, und es hat mit Kreativität kaum etwas zu tun. Ganz zu schweigen davon, dass man als Hausbesitzer zusätzlich eine Krämerseele und so viel Diplomatie benötigt, dass es an Selbstverleugnung grenzt. Es sollte nicht heißen Eigentum verpflichtet, sondern Eigentum strengt an. Vor zehn Jahren hätte sie jeden für verrückt erklärt, der ihr prophezeit hätte, dass sie heute manchmal den Tag verflucht, an dem sie das lukrative Angebot der Fundus-Gruppe abgelehnt hat.
Ausgerechnet sie, die nie an ein Bauvorhaben dieser Größenordnung herangekommen wäre, hat nach der Wende eine Häuserzeile in Berlin Mitte geerbt, und es ist ihr gelungen, die Rückübertragung innerhalb weniger Jahre zu regeln. Das Projekt Gärtnerstraße ist ihr Traum, auch heute noch – trotz der Hausbesetzer, mit denen sie sich bis zur Räumung zwei Jahre herumgequält hat, trotz Mietern, die nicht umgesetzt werden wollen, Zahlungsverzügen, Anwohnervereinen, Wasserschäden, Kreditlinien und des Bezirksamts. Bei all dem Ärger, den sie mit ihren paar Häusern hat, fragt sie sich manchmal, wie die Jagdfelds die Pläne durchbekommen haben, aus dem Tacheles ein Shoppingcenter mit Luxusapartments zu machen. Aber die sind eben Profis.
Als sie hinabsieht, entdeckt sie den Feind. Die Invasionstruppen hinterlassen klebrig glänzende Ausscheidungen und haben schon den Bereich unter den Knospen und an den jungen und noch weichen Trieben erobert. Fiona setzt die Blattläuse, die sich unter den Blättern ihrer Teerosen verstecken, einem tödlichen chemischen Nebel aus. Nicht mit mir, würde sie ihnen am liebsten laut zurufen, aber die Viecher hören ja nicht auf gut gemeinte Ermahnungen. Mit cäsarenhaft vorgeschobenem Kinn überlässt sie die Läuse ihrem grausigen Schicksal und blickt über ihr Reich.
Die Gärtnerstraße ist eine kurze Sackgasse, die an einem Sportplatz endet. Auffällig ist neben dem ruinösen Zustand des Straßenbelags, für dessen Erneuerung das Bezirksamt kein Geld hat, vor allem eine offensichtliche Zweiteilung. Während die eine Seite von einer durchrenovierten Häuserzeile dominiert wird, deren stuckverzierte Fassaden in dezenten Beige- und Ockertönen gehalten sind, wirkt die andere vergleichsweise schäbig. Dabei sind die Häuser dort von der Bausubstanz ähnlich. Manche sind einfach heruntergekommen, andere mit grauem Rohputz verkleidet, den auf Gehweghöhe uninspirierte Graffiti zuwuchern. Der Unterschied zwischen den Straßenseiten hängt mit der Grenze des Sanierungsgebiets zusammen, das mit der Gärtnerstraße endet. Die südliche Seite gehört zur Spandauer Vorstadt und muss den strengen Auflagen des Denkmalschutzes genügen, während auf der kaum fünf Meter entfernten Nordseite so ungefähr jede bauliche Scheußlichkeit durchgeht.
Und was erlaubt ist, wird auch gemacht, denkt Fiona: Plastikfenster, schnell übertünchte Fassaden und lieblose, billige Renovierungen. Der Sportplatz ist in Flutlicht getaucht und die Zuschauer grölen. Nachdem sie auch die Blumen auf der hinteren Dachterrasse inspiziert hat, wirft Fiona einen letzten Blick auf das Fußballspiel und geht hinein.
Mierek ist zwei Stunden zu spät und macht keinerlei Anstalten, sich zu beeilen. Fiona hühnert aufgeregt um ihn herum, während er das Bad feudelt. Sie ist für ihre Verhältnisse ungewohnt elegant zurechtgemacht und hat ihre kurzen grauen Locken mit Pomade streng zurückgekämmt, was ihrem langen Gesicht mit den dunkel umrandeten Augen etwas Majestätisches verleiht. In ihrem schwarzen langen Rock aus gecrashter Seide und einem grobmaschigen, ebenfalls schwarzen Schlabberpulli wirkt sie wie eine Fledermaus in Angora.
«Gäste in Berlin iemmerr zu spät», beruhigt Mierek sie und setzt seine Arbeit äußerst gemächlich im großen Zimmer fort, «miendestens halbe Stunde.»