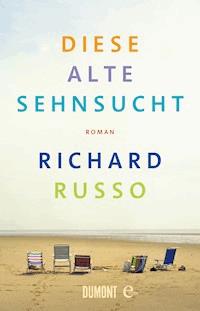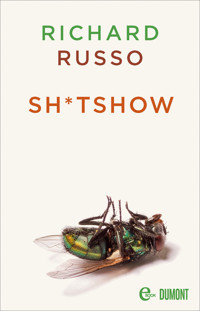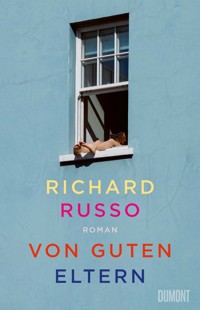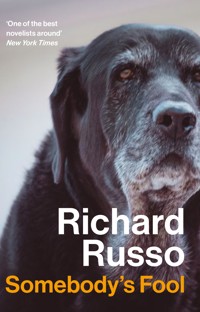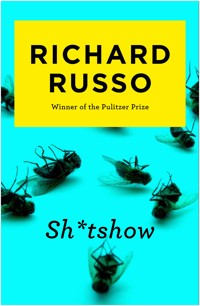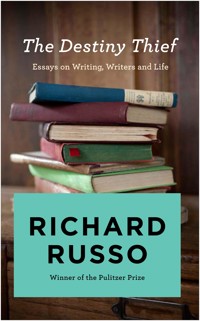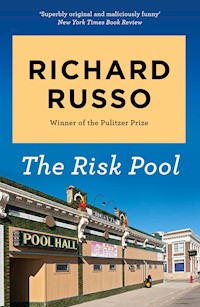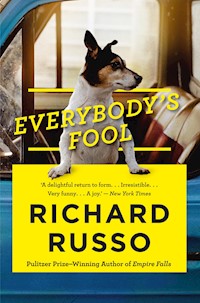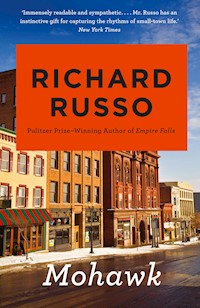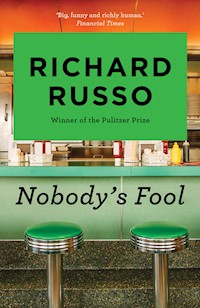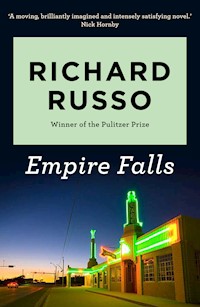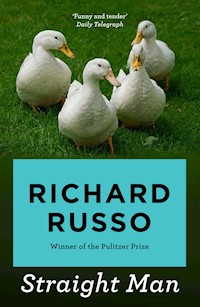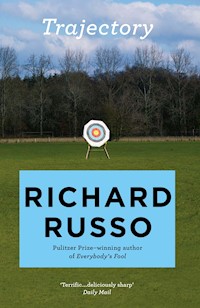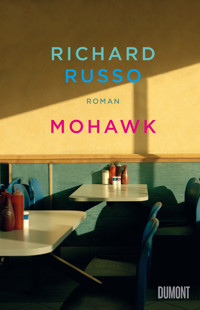
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Stadt Mohawk verdankte ihren Aufstieg einst der Lederindustrie und hat teuer dafür bezahlt: Die Krebsrate ist hier um ein Vielfaches höher als im Rest Amerikas, das Leder nicht mehr gefragt, die Stadt vergessen. Es sind die späten Sechziger, doch die wenigsten Menschen haben teil an den großen Veränderungen dieser Zeit. Wer hier lebt, hat keine extravaganten Träume, sondern will einfach nur das Beste für die Familie und eine anständige Arbeit. Anne Grouse geht es ähnlich. Und auch wenn sie mal andere Pläne hatte – mittlerweile sieht sie sich an die Stadt gefesselt. Nicht nur befindet sie sich in einem aussichtslosen Kampf mit ihrer Mutter um die Pflege ihres kranken Vaters, sie muss sich auch um ihren Sohn Randall kümmern, der Schwierigkeiten in der Schule hat. Zu allem Überfluss droht außerdem die Fehde zwischen ihrer Familie und den mächtigen Gaffneys wieder aufzuleben. Von ihrem Ex-Mann, einem leidenschaftlichen Zocker, kann sie keine besondere Unterstützung erwarten. Heimlich träumt sie vom Mann ihrer Cousine, aber Träume kann man sich in Mohawk kaum leisten. Richard Russo hat mit ›Mohawk‹ eine kluge Gesellschaftsanalyse vorgelegt, voller Empathie und Humor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 650
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Mohawk, eine Kleinstadt in Upstate New York, verdankte ihren Aufstieg einst der Lederindustrie und hat später teuer dafür bezahlt: Die Krebsrate ist hier um ein Vielfaches höher als im Rest Amerikas, das Leder nicht mehr gefragt, die Stadt vergessen. Es sind die späten Sechziger, doch die wenigsten Menschen haben teil an den großen Veränderungen dieser Zeit. Wer hier lebt, hat keine extravaganten Träume, sondern will einfach nur das Beste für die Familie und eine anständige Arbeit. Anne Grouse geht es ähnlich. Und auch wenn sie mal andere Pläne hatte – mittlerweile sieht sie sich an die Stadt gefesselt. Nicht nur befindet sie sich in einem aussichtslosen Kampf mit ihrer Mutter um die Pflege ihres kranken Vaters, sie muss sich auch um ihren Sohn Randall kümmern, der Schwierigkeiten in der Schule hat. Zu allem Überfluss droht außerdem die Fehde zwischen ihrer Familie und den mächtigen Gaffneys wieder aufzuleben. Von ihrem Ex-Mann, einem leidenschaftlichen Zocker, kann sie keine besondere Unterstützung erwarten. Heimlich träumt sie vom Mann ihrer Cousine, aber Träume kann man sich in Mohawk kaum leisten.
Richard Russo hat mit seinem Debütroman ›Mohawk‹ ein Porträt der amerikanischen Kleinstadt und eine kluge Gesellschaftsanalyse vorgelegt: scharf beobachtet, voller Empathie und Humor.
Autorenfoto: © Elena Seibert
Richard Russo studierte Philosophie und Creative Writing und lehrte an verschiedenen amerikanischen Universitäten. Für ›Diese gottverdammten Träume‹ (DuMont 2016) erhielt er 2002 den Pulitzer-Preis. Bei DuMont erschienen außerdem ›Diese alte Sehnsucht‹ (2010), ›Ein grundzufriedener Mann‹ und ›Ein Mann der Tat‹ (beide 2017) sowie der Erzählband ›Immergleiche Wege‹ (2018), der SPIEGEL-Bestseller ›Jenseits der Erwartungen‹, ›Sh*tshow‹ (beide 2020) und zuletzt ›Mittelalte Männer‹ (2021).
Monika Köpfer war viele Jahre als Lektorin tätig und übersetzt heute aus dem Englischen, Italienischen und Französischen. Zu den von ihr übersetzten Autor*innen zählen u.a. Mohsin Hamid, J.L.
Richard Russo
Mohawk
Roman
Aus dem Englischen von Monika Köpfer
›Moby-Dick oder der Wal‹ von Hermann Melville wurde zitiert nach: ›Moby-Dick oder der Wal‹ von Hermann Melville. Aus dem Englischen von Matthias Jendis. Carl Hanser Verlag, München 2001.
Die englische Originalausgabe erschien 1986 unter dem Titel ›Mohawk‹ bei Vintage Books, Random House Inc., New York.
Copyright © 1986 by Richard Russo
eBook 2023
© 2023 für die deutsche Ausgabe: DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Übersetzung: Monika Köpfer
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagabbildung: © Niall McDiarmid
Satz: Angelika Kudella, Köln
eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN eBook 978-3-8321-8280-9
www.dumont-buchverlag.de
Für Barbara, Emily und Kate.
Und für Dick LeVarn
»Doch der Glaube sucht sich, wie der Schakal, seine Nahrung zwischen den Gräbern und zieht gerade aus diesen tödlichen Zweifeln seine lebensspendende Hoffnung.«
Herman Melville, Moby-Dick
ERSTER TEIL
1. Kapitel
Der Hintereingang des Mohawk Grill befindet sich in einer Seitengasse, an die auch die Junior High grenzt. Als Harry drinnen den Riegel zurückschiebt und die schwere Tür nach außen schwingen lässt, wartet Wild Bill bereits nervös im grauen Zwielicht der Morgendämmerung. Unmöglich zu sagen, wie lange er zuvor auf und ab getigert ist und auf das dumpfe Riegelgeräusch gewartet hat, aber er wirkt heute noch zerknautschter als sonst. Abwartend steht Wild Bill da und vergräbt die Hände tiefer in den Taschen, während Harry ihn neugierig mustert und sich fragt, ob Bill in der vergangenen Nacht in irgendwelchen Schwierigkeiten gesteckt hat. Eher nicht, beschließt Harry. Bill sieht zwar etwas derangiert aus, so wie immer, seine schwarze, bügelfaltenlose Hose ist bedeckt vom Staub der Gasse, ein Zipfel seines fadenscheinigen grün-karierten Hemds hängt heraus, aber seine Erscheinung ist nicht auffälliger als sonst. Harry ist froh, denn er ist spät dran heute Morgen und hat keine Zeit, Wild Bill einer Reinigung zu unterziehen.
Als Harry zur Seite tritt, saust Bill an ihm vorbei in das Diner und klettert auf den Barhocker am Ende des Resopaltresens. Harry hakt die schwere Tür an der Außenmauer ein, damit der Lieferant durch die Hintertür hereinkann und um das Lokal ein bisschen durchzulüften. Auch ein paar Fliegen werden von der Straße hereinkommen, aber sich zu guter Letzt an den Klebestreifen wiederfinden, die von der Decke baumeln. Harry stößt die großen Fenster vorn im Diner auf und sorgt so für einen kühlen Durchzug, der Wild Bills schütteres Haar zu Berge stehen lässt. Bill ist Mitte dreißig, aber sein feines Babyhaar fällt ihm längst büschelweise aus, und er sieht so alt aus wie Harry, der auf die fünfzig zugeht.
»Hungrig?«, fragt Harry.
Wild Bill nickt und betrachtet schmachtend den Grill, von dem die zerlassene Butter spritzt. Harry schnappt sich eine große Packung rosa Würstchen und wirft mehrere Dutzend davon auf den Grill, sodass sie die gesamte Oberfläche bedecken, dann trennt er sie mit dem Spatelrand und ordnet sie zu beeindruckenden Schlachtreihen an. »Wird ’n Weilchen dauern«, sagt er.
Jetzt wirkt Wild Bill schon ein bisschen weniger besorgt. Die Fettspritzer haben etwas Beruhigendes, und er sieht hypnotisiert zu, wie die miteinander verbundenen Würstchen zu brutzeln und zu hüpfen beginnen. Fettpfützen bilden sich, die langsam zu der Rinne am Rand des Grills wandern. Wenn er könnte, würde Wild Bill sie an der Flucht hindern, denn er liebt den Geschmack von heißem Wurstfett. Irgendwann einmal, wenn er daran denkt, wird Harry Wild Bills Rühreier darin braten, ehe er den Grill reinigt. Aber Rühreier kriegt Bill nur, wenn er Geld hat, und das ist nicht oft der Fall. Bill hat abgesehen von ein paar Fünf-Cent-Münzen nur selten Geld in der Tasche, aber seit zehn Jahren trudelt jeden Monatsersten ein Umschlag mit einem frischen Zehn-Dollar-Schein im Mohawk Grill ein, zusammen mit einem Zettel, auf dem schlicht und einfach steht: »Für William Gaffney«. Woher er kommt, ist das einzige echte Geheimnis in Harrys Leben. Zuerst dachte er, das Geld stamme von dem Vater des Jungen, doch das war, bevor er Rory Gaffney kennenlernte. Harry hat inzwischen so ziemlich jeden kennengelernt, der auch Wild Bill kennt, und ist aus jeweils unterschiedlichen Gründen zu dem Schluss gekommen, dass es nicht von ihnen kommt. Das Geld taucht einfach auf. Wenn es aufgebraucht ist, kann Harry Wild Bill allenfalls mit einem Kaffee und einer Karamellschnecke vom Vortag durchfüttern, aber seine Großzügigkeit hat ihre Grenzen, und er gibt selten kostenlos Essen weg, das nicht ohnehin in die Mülltonne wandern würde. Einmal, an Weihnachten vor zwei Jahren, hatte Harry den Blues, und um die Depression wieder loszuwerden, bereitete er Wild Bill ein riesiges Frühstück zu – Saft, Eier, Schinken, Pfannkuchen, selbst gemachte Pommes frites, Toast, Fruchtgelee und Ahornsirup –, und der junge Mann schlang es mit großen Augen und voller Dankbarkeit hinunter, ehe er auf die Seitengasse hinausstürzte und sich übergab. Seitdem achtet Harry darauf, diesen Fehler nicht noch mal zu machen.
»Ich hätte gern, dass du heute Morgen die Müllsäcke rausbringst«, sagt Harry, während er die Würstchen wendet.
Wie ein Hund, der nur auf ein Missgeschick wartet, verfolgt Wild Bill jede einzelne Drehung.
»Hast du gehört?«
Wild Bill zuckt erschrocken zusammen und sieht Harry an.
»Ich habe gesagt, ich hätte gern, dass du den Müll rausschaffst. Dann kriegst du ein paar Toasts.«
»’etz?«
»Ja, jetzt.«
Wild Bill verlässt nur ungern seinen Beobachtungsposten – er liebt es, den Würstchen beim Braten zuzusehen –, aber er gleitet gehorsam vom Barhocker und geht in den Hinterraum, wo Harry mehrere Müllsäcke aufeinandergestapelt hat. Die Fliegen haben sie bereits entdeckt und attackieren das Plastik heftig. Wild Bill entsorgt jeden Sack einzeln im Müllcontainer und kehrt in dem Moment zu seinem Barhocker zurück, als zwei goldbraune Brotscheiben aus dem Toaster hochspringen. Harry streicht sparsam Butter auf eine und legt sie auf die Untertasse vor Wild Bill. Er ist versucht zu fragen, ob dieser in der vergangenen Nacht in eine Schlägerei geraten ist, besinnt sich aber anders. Wäre es der Fall, wären die üblichen Anzeichen zu sehen, denn er ist kein großer Kämpfer. Normalerweise verpasst derjenige, der den Streit vom Zaun bricht, Bill eine dicke Lippe und schämt sich dann ein bisschen, denn statt wütend zu werden, steht Bill immer einfach nur mit hängenden Armen da und wirkt, als würde er gleich losheulen.
»Du hast doch nicht etwa eine Freundin gefunden, oder?«
Bill schüttelt den Kopf, hört jedoch auf, Toast zu kauen, und sieht Harry an, der sich fragt, ob Bill vielleicht lügt, falls er überhaupt zum Lügen fähig ist.
»Ich habe deinem Onkel versprochen, ihm zu sagen, wenn du dich in Schwierigkeiten bringst«, sagt Harry warnend.
Wild Bill hat sich wieder seinem Toast zugewandt, den er mit übertriebener Konzentration kaut, als fürchtete er, einen Fehler zu machen. Es klopft an die Vordertür des Diners, und Harry geht hin, um sie aufzuschließen. Im Eingang liegt der aufgerollte Mohawk Republican, und Harry kehrt, nachdem er nachgesehen hat, ob er am Vortag nicht vielleicht doch auf die richtige Zahl getippt hat, mit der Zeitung zum Tresen zurück. Der Republican kennt seine Leserschaft, die dreistellige Nummer der Lokallotterie steht daher direkt in der linken oberen Ecke über der Titelschlagzeile, die an diesem Tag in etwas fetterer Schrifttype als sonst verkündet: GERBEREIEN OFFENBAR SCHULD AN DER UNGEWÖHNLICH HOHEN KREBSRATE. Harry überfliegt den ersten Absatz; dort steht, dass laut einer Universitätsstudie das Risiko für Menschen im County Mohawk, sich Krebs, Leukämie etwa, und verschiedene andere schwere Krankheiten zuzuziehen, dreimal höher ist als für Bewohner der restlichen Landesteile. Menschen, die in Gerbereien und Lederfabriken arbeiten oder in der Nähe des Cayuga Creek wohnen, in den die Gerbereien Morelock, Hunter und Cayuga angeblich ihre giftigen Abwasser verklappen, haben sogar ein zehn bis zwanzigfach höheres Risiko, an den auf Seite B-6 aufgelisteten Leiden zu erkranken. Die Sprecher der Gerbereien leugnen, dass in den letzten zwei Jahrzehnten irgendeine Verklappung stattgefunden hat, und behaupten, dass es sich bei den jüngsten Studienergebnissen vermutlich um eine statistische Anomalie handelt.
Harry lässt die Zeitung auf dem Tresen liegen, für alle, die sich für die Ergebnisse der letzten Pferderennen am Freitag interessieren. Als die Würstchen fertig sind, befördert er sie mit dem Spatel vom Grill in eine Edelstahlwanne. Wenn später nach und nach die Bestellungen eingehen, wird er die entsprechende Menge Würstchen nochmals für eine Minute auf den Grill geben. Was nicht beim Frühstück verzehrt wird, wird er später am Tag für Sandwiches verwenden. Er kann bis auf eine Würstchenreihe genau voraussagen, wie viele an einem Tag weggehen. Im Diner gibt es nur wenige Überraschungen, und dafür ist er dankbar. Mit dem langen Grillspatel schiebt er die Fettlache in Richtung Abflussrinne und bedeckt dann die glänzende Oberfläche sorgfältig mit Reihen von Speckstreifen.
»Hey!«, sagt er zu Wild Bill, der eifrig mit dem Daumen Toastkrümel von der Untertasse aufpickt. »Du trinkst doch hoffentlich nie aus dem Bach, oder?«
Wild Bild schüttelt den Kopf.
Harry zuckt die Achseln. War nur so ein Gedanke. Aber es würde so manches erklären. Harry hat noch nicht in Mohawk gewohnt, als Wild Bill ein Junge war, aber es gibt Leute, die sagen, er sei als Kind ganz normal gewesen, mehr oder weniger jedenfalls. Der Speck beginnt zu brutzeln. Harry muss mächtig rülpsen und wischt sich die Hände an der Schürze über dem Bauch ab. Er fühlt sich so wie immer am Samstagmorgen nach einer durchzechten Nacht. Er ist, ohne sich aufs Ohr zu legen, gleich ins Diner gekommen, und vom süßlichen Geruch des gebratenen Specks dreht sich ihm der Magen um. Wobei ihm im Moment nicht sein Magen Sorgen bereitet. Im Laufe des Abends hat er einer Frau einen Heiratsantrag gemacht. Wenn er getrunken hat, ist Harry in punkto Frauen nicht wählerisch, und irgendwie mündet es immer in einem Heiratsantrag. Die Frauen, bei denen Harry freitagabends landet, sagen ausnahmslos Ja, und Harry bleibt dann nichts anderes übrig, als wortbrüchig zu werden. Gottlob wissen die Frauen immer, dass er eigentlich keinerlei Heiratsabsichten hat, sodass nie verletzte Gefühle im Spiel sind. Sie sagen Ja, weil es sowieso aussichtslos ist, wie so vieles in ihrem Leben, aber dennoch einen Versuch wert. Sie wissen, Harry braucht keine Frau, dass er aber besser dran wäre, wenn er es ernst meinte und sich eine nähme. Es gab einmal eine Zeit, als sie vielleicht eine bessere Partie als Harry hätten machen können, aber das liegt einige Präsidenten zurück. Der Kalender an der Wand hinter dem Grill stammt aus dem Jahr 1966, also dem Vorjahr. Wer immer Harry diesen Kalender geschenkt hat, hat ihm dieses Jahr keinen neuen geschenkt. Die Monate sind, was die Anzahl der Tage betrifft, die gleichen, und Harry macht es nichts aus, wenn die Wochentage nicht stimmen.
»Lass dich bloß nicht mit Frauen ein«, brummt er.
»Hä?«
»Niemals.«
Harry bemerkt, wie Bill die Karamellschnecken vom Vortag unter der Glaskuppel mustert. Er reicht Bill eine und wirft den Rest in den Mülleimer. Der Bäckereilieferant wird jede Minute hier sein. Harry wendet die Speckstreifen.
Von der Wand, hinter der die Treppe liegt, ist Getrappel zu hören, was bedeutet, dass das nächtliche Pokern im zweiten Stock zu Ende ist. Das wiederum bedeutet, dass Harry frühe Kundschaft ins Haus steht. Als die Vordertür aufgeht und mehrere Männer hereinkommen, macht Wild Bill Anstalten zu gehen, aber Harry legt ihm die Hand auf die Schulter, und Bill klettert auf den Barhocker zurück. Normalerweise möchte Harry ihn nicht dahaben, wenn zahlende Kundschaft eintrudelt, aber diese Kerle sind nicht zimperlich. Im Moment können sie kaum die Augen offen halten. Nachdem sie sich in der Mitte des Tresens auf Hockern niedergelassen haben, bestellen zwei der rotäugigen Männer Frühstück – Schinkensteaks, Eier, Bratkartoffeln, Toast, Kaffee – und die anderen beiden nur Kaffee. Harry muss nicht erst fragen, wer gewonnen hat. In der Regel gewinnt John, der Rechtsanwalt, und spart seine Gewinne an, bis er, gewöhnlich zweimal im Jahr, nach Las Vegas fährt. Dann gewinnt in der Regel Las Vegas. Einer der Nichtesser zieht das Blatt mit den Statistiken für die heutigen Pferderennen hervor. Der andere langt nach Harrys Mohawk Republican und schlägt den Sportteil auf. »Welche Zahlen haben gestern gewonnen?«, fragt jemand.
»Vier-zwei-eins«, brummt Harry.
»Ich habe in den letzten drei Jahren keine einzige Richtige gehabt.«
»Na und? Fast genauso lange bin ich nicht flachgelegt worden.«
»Wenn du mir sagst, welche Nummer als Nächstes dran ist, kann ich dafür sorgen, dass du flachgelegt wirst«, sagt John, der als Frauenheld gilt. Als Einziger sieht er nach der langen Arbeitsnacht noch einigermaßen frisch aus.
»Jeder kann flachgelegt werden«, stimmt ihm ein anderer zu.
»Einige von uns stehen auf Mädels.«
Ein gespielter Streit bricht los. Wild Bill beobachtet die Männer, die vorgetäuschten Feindseligkeiten machen ihm ein bisschen Angst. Einer der Männer nickt ihm zu.
»’ssten«, sagt Bill.
»Ja«, sagt der Mann und sieht Harry an. »Müssten, Harry.«
»Genau«, stimmen die anderen ein. »Müssten, Harry.«
»Verschwinde.« Nun, da Bill angesichts dieses kumpelhaften Frotzelns glücklich grinst, ärgert er sich, dass er ihn vorhin, als er gehen wollte, nicht hat ziehen lassen. Manchmal wünscht er sich, Wild Bill würde einfach irgendwohin verschwinden und nie wieder zurückkommen. Er ist, gelinde gesagt, eine Last. Und trotzdem mag er es nicht, wenn sich die Leute über ihn lustig machen.
»Wie lange dauert es, ein paar Spiegeleier zu braten?«, will der Rechtsanwalt wissen. »Sie müssten inzwischen doch fertig sein.«
»Müssten«, sagen die anderen wie aus einem Munde.
Der Mann mit dem aufgeschlagenen Sportteil lehnt sich auf dem Barhocker zurück und späht auf die Straße hinaus. »Bleib bloß weg von meinem Wagen, du fetter Arsch.« Officer Gaffney betrachtet die drei rechtswidrig am Randstein parkenden Autos. Laut jüngster Verordnung ist das Parken in der Main Street verboten. »Wenn ich einen Strafzettel krieg, kann es sein, dass ich vorübergehend unzurechnungsfähig werde.«
»Ich übernehme deine Verteidigung«, sagt John.
»Den Prozess könntest selbst du gewinnen«, meint ein anderer.
Harry macht sich nicht einmal die Mühe, hinauszuschauen. Er kennt Officer Gaffney und weiß, dass kein Strafzettel ausgestellt wird, ehe er nicht herausgefunden hat, wem die Autos gehören. Gaffney trinkt gern einen Kaffee im Diner, und er lässt Harrys Kundschaft in Ruhe.
Die Tür geht auf, und er kommt schwungvollen Schritts herein, ein massiger, aber sanftmütig aussehender Mann. Selbst die Jungs, die in der Main Street mit ihren Fahrrädern über die Gehsteige rasen, haben keine Angst vor ihm. Wenn er den Verkehr an der Ampel an den Four Corners überwacht, machen sie hinter seinem Rücken Mätzchen auf ihren Fahrrädern, und bis er sich umdreht, haben sie sich längst aus dem Staub gemacht. Nur Officer Gaffney selbst nimmt sich ernst. Er hat seine .38er tiefer um die rechte Hüfte geschnallt, als es erlaubt ist. »Jungs!« Er nickt den Männern zu und nimmt am anderen Ende des Tresens gegenüber Wild Bill auf einem Barhocker Platz.
»’ssten«, sagt einer.
Wild Bild ist jetzt wieder sichtlich nervös, er rutscht auf seinem Barhocker herum und lässt den Polizisten nicht aus den Augen. Uniformen flößen ihm Unbehagen ein, selbst wenn ein ihm vertrauter Mensch darinsteckt. Mit Uniformen hat Wild Bill bislang wenig Glück gehabt.
»Wem gehört der Merc?«, fragt Officer Gaffney. Er gibt zwei gestrichene Teelöffel voll Zucker in den dampfenden Kaffee, den Harry vor ihn hinstellt.
»Murphy«, sagt der Anwalt und sticht in seine Spiegeleier, bis sie von einer gelben Soße überzogen sind. »Er kommt bestimmt gleich runter, falls er sich nicht umbringt.«
»Du hättest ihm wenigstens ein Frühstück spendieren können«, sagt einer der Kaffeetrinker.
»Hab’s ihm angeboten. Er meinte, er ist nicht hungrig.«
»Ich hoffe, seine Kinder sind es auch nicht. Jedenfalls nicht diese Woche.«
»Diesen Monat.«
»Er ist nicht der Einzige, der baden gegangen ist«, wirft einer der anderen Kaffeetrinker ein – der abwesende Murphy soll nicht das ganze Mitgefühl einheimsen.
»Ja, hast du seinen Gesichtsausdruck gesehen, als er gegen diese Asse im Full House verloren hat?«
John gluckst vor sich hin, während er seine triefenden Spiegeleier verschlingt. »Scheiße«, sagt er anerkennend.
Als Wild Bill wie ein gescholtener Hund von seinem Barhocker rutscht und sich durch die Hintertür davonschleicht, versucht Harry nicht, ihn aufzuhalten. Der Mann, der in den Sportteil vertieft war, hat die Zeitung wieder zusammengefaltet. »Wetten, er trinkt Wasser aus dem Cayuga?«, sagt er. Alle bis auf Harry lachen.
»Was zum Teufel hatte dieses ’ssten‹ zu bedeuten?«
»Es bedeutet ›grüßt euch‹«, sagt Harry.
»Hm? Woher weißt du das?«, fragt John. »Hast du’s im Schwachkopf-Lexikon nachgeschlagen?«
»Es bedeutet ›grüßt euch‹, glaub mir«, sagt Harry.
»Du kannst seine Zeche übernehmen, Gaff«, sagt der Anwalt, ohne von seinem Frühstück aufzuschauen. »Du bist schließlich sein Onkel.«
Officer Gaffney wird puterrot. Auch wenn Wild Bill und er ungefähr gleich alt aussehen, ist er tatsächlich sein Onkel. Nicht viele Menschen in Mohawk kennen Wild Bills Nachnamen, daher muss er nur selten zugeben, mit ihm verwandt zu sein. Jetzt wissen es alle.
»Eine gewisse Familienähnlichkeit ist durchaus vorhanden«, wirft jemand ein.
»Sag brav ›ssten‹, Gaff.«
»Klappe!«, donnert Harry so laut, dass alle, einschließlich des Polizisten, erschrocken zurückweichen. Harrys ohnehin rotes Gesicht ist noch röter geworden, und er fuchtelt mit seinem langen, schmalen Grillspatel herum wie mit einem Schwert. Auf jemanden, der zufällig von der Straße hereinspaziert käme, würde Harry eher komisch als bedrohlich wirken, aber alle, die in Wurfweite des Spatels sind, nehmen ihn klugerweise ernst.
Schließlich sorgt der Anwalt dafür, dass sich die Anspannung löst. »Du musst dich gestern Nacht wieder verheiratet haben. Danach bist du immer angepisst. Wenn du willst, annulliere ich bis Mittag die Ehe, es sei denn, sie wurde vollzogen.«
»Vollzogen? Harry?«
Alle lachen, und Harry lässt seine Waffe sinken. Es macht ihm nichts aus, wenn sie sich über ihn lustig machen, aber er ist immer noch wütend. »Er ist nur ein armer Schwachkopf. Könnt ihr ihn nicht einfach in Ruhe lassen?«
»Klar, Harry. ’ssten wir wohl.«
Nachdem die Männer bezahlt haben und gegangen sind, haben Harry und Officer Gaffney das Lokal für sich. Es ist immer noch früh am Morgen. Während Harry einen kleinen Eimer Fertigbratkartoffeln auf den Grill schüttet, überfliegt der Polizist die Titelseite des Republican. Wahrscheinlich kriegt Harry Wild Bill vor Montagmorgen nicht mehr zu sehen, und das ist gut so. Er fragt sich, wo er wohl hingegangen ist, womit er seine Tage und Nächte verbringt. Als der Polizist die Zeitung hinlegt, sind die Bratkartoffeln unten schön braun, sehen aber kalt und unappetitlich aus. Die Autos, die vor dem Lokal parkten, sind bis auf den Mercury alle weg.
»Ist dieser Typ, dieser Murphy, einer deiner Gäste?«
Harry verneint.
Officer Gaffney bezahlt seinen Kaffee und geht wieder hi naus. Harry sieht, wie er sich über den Mercury beugt und auf der Motorhaube einen Strafzettel ausstellt. Harry wendet die Bratkartoffeln und lässt den Blick durch sein Diner schweifen. Er bereut nicht sonderlich viel, was sein Leben angeht, noch sehnt er sich nach vielem, was er nicht hat. Jetzt wünschte er, er hätte Wild Bill ein paar Rühreier im Wurstfett gebraten, aber das ist das Einzige, was ihm in puncto Bedauern momentan so einfällt.
2. Kapitel
»Bestimmt ist alles in Ordnung mit dem Haus«, sagte MrsGrouse, während ihre Tochter Anne den Wagen um die Ecke lenkte und in die Oak Street einbog. Die ältere Frau trug noch ihre Sonntagssachen, ein gegürtetes cremefarbenes Kleid, das sie mit behandschuhten Fingern über den Knien glatt strich. MrsGrouse fuhr nicht gern Auto und tat es grundsätzlich nur zum Kirchgang oder um ihre ältere Schwester Milly zu besuchen, und dorthin waren sie und ihre Tochter gerade unterwegs.
Anne hielt am Straßenrand. »Sollen wir noch mal zurückfahren und nachsehen, ob auch wirklich alles in Ordnung ist, Mutter?«
»Warum denn, Liebes?«
»Keine Ahnung. Aber wenn du dir nicht sicher bist, lass uns umkehren … nur für alle Fälle. Ansonsten fragst du dich den ganzen Nachmittag laut, ob nicht doch etwas ist.«
»Unsinn.«
»Stimmt«, sagte Anne und fuhr wieder los.
Eine Querstraße weiter sagte MrsGrouse: »Ich habe sämtliche Türen abgeschlossen.«
»Ja, Mutter.«
MrsGrouse sah ihre Tochter nicht an. »Du hast ja keinen Grund, dir Sorgen zu machen. Schließlich bin ich verantwortlich für das Haus, nun, da dein Vater im Krankenhaus ist.«
Anne wusste, es war zwecklos, diese Unterhaltung fortzuführen. Die meisten Angelegenheiten, egal ob nichtig oder bedeutend, fielen in den Verantwortungsbereich ihrer Mutter, und sie schulterte sie alle tapfer mit ihrer schmalen Gestalt. Die beiden Frauen befehdeten sich seit dem Anfall, der Mather Grouse Anfang der Woche ins Krankenhaus gebracht hatte. Seitdem hatten sie abwechselnd an seinem Krankenbett gesessen und den gleichen subtilen Krieg fortgeführt, der andauerte, solange sich Anne erinnern konnte. Nicht weiter verwunderlich, dass Mather Grouse die Gesellschaft seines Enkels Randall der von Ehefrau oder Tochter vorzuziehen schien.
»Randy hat die Telefonnummer …«, sagte MrsGrouse, die noch nie in ihrem Leben einen Zweifel unausgesprochen gelassen hatte.
»Ja, Mutter. Hör doch bitte auf, dich wegen allem zu Tode zu grämen.«
»Wovon redest du? Ich habe einfach nur …«
»Ich weiß, was du gesagt hast. Aber in ein paar Minuten wirst du bei deiner Schwester sein und wieder alles vergessen haben. Du wirst das Haus vergessen haben. Können wir bis dahin nicht einfach friedlich sein?«
Milly ging auf die achtzig zu und war damit fast fünfzehn Jahre älter als Annes Mutter, aber die beiden Frauen waren geistige Zwillinge. Lange waren sie einander nicht besonders nah gewesen, das hatte sich erst geändert, als die vier Schwestern, die altersmäßig zwischen ihnen waren, starben. Da hatten sie begonnen, ihre Vergangenheit umzuschreiben, bis beide daran glaubten, dass sie ihre Kindheit ausschließlich in Gesellschaft der jeweils anderen verbracht hatten; in Wahrheit waren sie aufgrund des eineinhalb Jahrzehnts, das sie trennte, einander eher fremd gewesen. Doch dann hatten sie sich dieser einschränkenden Realität zugunsten lebendiger gemeinsamer Erinnerungen entledigt, die jeglicher Grundlage entbehrten. Hin und wieder verwechselte Old Milly MrsGrouse mit ihrer Schwester Grace, die seit fast zwanzig Jahren tot war. Zum Glück fiel es MrsGrouse nicht schwer, schnell umzuschalten, sie nahm dann fröhlich die Identität der verstorbenen Schwester an, um die noch lebende ja nicht aufzuregen. Anne war es ein wenig unheimlich, wie leicht ihre Mutter bei derlei Gelegenheiten diese Metempsychose vollzog, sagte aber nie etwas.
Natürlich teilten die beiden Schwestern auch ein paar jüngere Erinnerungen, die etwas fester auf historischen Tatsachen fußten. So war es Millys Mann gewesen, dessentwegen Mather Grouse kurz nach seiner Heirat mit Annes Mutter nach Mohawk gekommen war. Damals war Mohawk noch eine recht lebendige, gesunde Kleinstadt gewesen, auch wenn die Lederindustrie bereits erste Anzeichen des Niedergangs zeigte, die niemand für eine dauerhafte Entwicklung hielt. Sämtliche Gerbereien und Handschuhgeschäfte stellten noch Leute ein, jedenfalls für die Hauptsaison, und Mather Grouse hatte in derselben Gerberei, wo auch Millys Mann beschäftigt war, Arbeit gefunden. Als es abwärtsging, machten alle die Depression dafür verantwortlich und meinten, es werde sicher wieder besser, sobald sich die Wirtschaft erholt hätte. Als Pearl Harbor zerbombt wurde, trat Mather Grouse in die Armee ein, darauf vertrauend, später denselben Job wieder aufnehmen zu können.
Aber der Krieg veränderte alles. Um die hohen Einfuhrzölle zu umgehen, verlegten sich die skrupelloseren Geschäftsinhaber darauf, als unfertig deklarierte Handschuhe zu importieren, wobei ihnen zum fertigen Zustand nur noch ein Knopf fehlte. Auf diese Weise drückten sie die Nachfrage nach Zuschneidern aus Mohawk. Nie wieder sollte es mehr Arbeit als Arbeiter geben, und die Konkurrenz um das Arbeitsangebot sorgte für niedrige Löhne. Nur wenige der Männer begriffen, wie ihnen da geschah, und jene, die es taten, hatten Angst, ihre Meinung zu sagen.
Und doch waren die Jahre unmittelbar nach dem Krieg keine schlechten, jedenfalls nicht für die beiden Schwestern. An den langen Nachmittagen, wenn ihre Töchter in der Schule und ihre Männer in der Werkstatt waren, besuchten sie einander abwechselnd und regelmäßig. Sie kredenzten einander raffiniertes Gebäck auf Spitzendeckchen und klatschten unter Zuhilfenahme ihrer klebrigen Finger harmlos über dies und das: Wer von den Zuschneidern das beste Leder bekam, wer wohl am ehesten seinen Job verlieren würde, sollte die Arbeit nicht für den Winter reichen, und dergleichen mehr. Beide Frauen hatten ihre Kinder relativ spät bekommen, und die Mutterrolle fiel keiner von ihnen leicht.
Anne und ihre Mutter hatten einander gern, jede auf ihre Art. Aber sie waren sehr verschieden, und seit Annes Kindertagen hatten weder Mutter noch Tochter einander ihre Liebe bekundet.
Milly wohnte seit dem Tod ihres Mannes bei Tochter und Schwiegersohn in der Kings Road, und zwar in einer der wenigen wohlhabenden Gegenden Mohawks, die nicht bereits bessere Zeiten erlebt hatten. Obgleich das Haus der Grouses, das sich in der Mountain Avenue befand, auf derselben Seite der Stadt lag, zeigten sich in deren Viertel erste Anzeichen des Verfalls in Gestalt von abblätternder und sich wellender Farbe und Rissen in den Bürgersteigen. In der baumgesäumten Kings Road bewegte sich die Erde dagegen nie, und die breiten Bürgersteige waren eben und nicht krumm und buckelig. Die Häuser standen ein gutes Stück weit von der Straße zurückversetzt, mit gestutztem und von hohen, symmetrischen Hecken eingefriedetem Rasen davor. Trotz ihrer häufigen Besuche hatte Anne hier noch nie jemanden Rasen mähen oder Hecken schneiden sehen. Die Golfbahn mit dem siebten, achten und neunten Loch des Mohawk Country Club schmiegte sich, einen scharfen Knick beschreibend, träge um die Häuser an der Kings Road herum, einer Sackgasse, deren Anrainer sich keine ernsteren Sorgen machen mussten, als dass ein gelegentlicher Slice oder Duck Hook in ihrem Garten landete. Als Anne in die Zufahrt einbog und ausstieg, hörte sie entfernt das Klacken, mit dem ein Fairwayholz auf einen Ball traf, und das unterdrückte Fluchen eines betucht klingenden Mannes.
Diana Wood, Annes Cousine, öffnete ihnen die Tür, und ihre Mutter erschien humpelnd hinter ihr. Old Milly und MrsGrouse begrüßten einander, als hätten sie eine mehrmonatige, statt einer nur zweiwöchigen Trennung erdulden müssen. Daran, dass sie einander nicht täglich sahen, waren die »jungen Leute« schuld. Di Wood sah etwas struppig und müde aus und tauschte, nachdem sie die theatralische Wiedervereinigungsszene der beiden Schwestern verfolgt hatte, einen Leidensgenossinnenblick mit Anne aus.
»Wie geht’s Onkel Mather?«, fragte sie, als sie außer Hörweite der Mütter in der Küche waren.
»Die Ärzte beraten noch, ob sie ihn morgen vielleicht entlassen können.«
»Wir wollten ihn eigentlich besuchen, aber du weißt ja, wie schwierig es hier ist, solche Dinge hier auf die Reihe zu kriegen. Andernfalls wäre Mutter längst zu ihm gefahren.«
»Dad erwartet das gar nicht. Er mag Besuch im Krankenhaus genauso wenig wie zu Hause. Übrigens siehst du ziemlich fertig aus.«
Von der Küche konnten sie ins Wohnzimmer blicken, wo die Schwestern einander zugewandt, Knie an Knie, auf dem Zweiersofa saßen. Di Wood schüttelte den Kopf. »Wir werden lange vor ihnen das Zeitliche segnen«, sagte sie halb im Ernst. »Du solltest zusehen, dass du von hier wegkommst. Du bist noch jung genug.«
Anne lächelte. »Ich werde in wenigen Monaten fünfunddreißig. Was bedeutet, dass du, es sei denn, du hast mich inzwischen abgehängt, erst vierzig bist.«
Ihre Cousine holte einen glasierten Schinken aus dem Kühlschrank und hievte ihn auf das Schneidebrett. Es war ein prächtiges Exemplar, mit Kirschen und Ananasscheiben garniert. Die Woods bewirteten Anne und ihre Mutter bei ihren Sonntagnachmittagsbesuchen jedes Mal großzügig. Es gab immer einen Schinken, Braten oder Lammschlegel, dazu mehrere raffinierte Salate. Da sie nicht die Gelegenheit hatten, sich zu revanchieren, wünschte Anne, ihre Cousine würde sich nicht so viel Mühe geben. Seit sie sich im letzten Winter die Hüfte gebrochen hatte, war Milly mehr oder weniger ans Haus gefesselt. Aber Di behauptete, das »Herumwerkeln« bereite ihrer Mutter Vergnügen.
»Du musst mich nur mal richtig anschauen, falls du findest, ich hätte dich nicht abgehängt«, sagte sie vergnügt.
Womit sie recht hatte. Diana war schon als junge Frau nie hübsch gewesen, wobei sie mit Anfang zwanzig, kurz nach ihrer Heirat mit Dan, eine zerbrechliche, verletzliche Liebenswürdigkeit besessen hatte, wie die Menschen häufig bemerkten, nachdem sie zunächst ihre unscheinbaren Züge bedauerten. Jetzt würde man sie ohne Weiteres auf fünfzig schätzen, und ihre frühere Zerbrechlichkeit war von einer gewissen Robustheit verdrängt worden. Sie sah aus wie eine Frau, die ihr Leben damit zugebracht hatte, sich hintanzustellen.
»Du und Dan, ihr müsst einfach mal rauskommen«, sagte Anne, um das Thema zu wechseln und überhaupt. »Deine Mutter würde bestimmt ein Wochenende allein überleben. Mutter und ich könnten nach ihr schauen.«
Diana schnitt mit dem Elektromesser erstaunlich gleichmäßige Scheiben vom Schinken ab, jede fiel fügsam auf die vorige. »Wir wollten eigentlich letztes Wochenende wegfahren. Wir hatten sogar eine Krankenschwester angeheuert. Aber als Mutter Wind davon bekam, hat sie einen solchen Wutanfall gekriegt, dass wir es doch nicht gewagt haben.«
»Ihr hättet es trotzdem tun sollen.«
»Ich weiß.« Diana nickte. »Aber irgendwann fehlt einem einfach der nötige Wille. Es wäre ohnehin nichts weiter als eine Geste gewesen. Wir hätten es nicht genießen können.«
Im Wohnzimmer hatten sich MrsGrouse und Milly nicht von der Stelle gerührt. Während sich ihre Knie nach wie vor berührten, saßen sie noch immer einander zugewandt da. Mit aufgerissenen Augen tauschten sie ihre trivialen Informationen aus. Keine von beiden hörte noch gut, und da sie so aufeinander konzentriert waren, kamen sie gar nicht auf die Idee, dass sie Gesprächsgegenstand im angrenzenden Raum waren. »Sieh dir die beiden an«, sagte Di lächelnd. »Scheint, als bräuchten sie nichts und niemanden sonst auf der Welt.«
Anne wünschte, sie hätte ebenso mitfühlend und großzügig sein können wie ihre Cousine, aber es fiel ihr nicht leicht. Stärke gegenüber konnte sie kein Mitleid aufbringen, und Old Milly war, obwohl physisch schwach, in der Lage, kraft ihres Willens bei fast allem ihren Kopf durchzusetzen. Annes Mutter wiederum besaß die familiär vorherrschende Veranlagung für passive Aggression und Entschlossenheit. Während sie ihre Mutter so beobachtete, gelangte Anne immer mehr zur Überzeugung, dass die amerikanische Wildnis nicht durch mutige Männer gebändigt worden war, sondern deren unbeugsame, widerstandsfähige Frauen – gezähmt durch einen festen Standpunkt, ein auf bestimmte Weise gerecktes Kinn, wie es nur dem weiblichen Geschlecht eigen war, eine Eigenschaft, die ihr selbst bedauerlicherweise fehlte.
Di arrangierte die Schinkenscheiben auf einer großen Platte, deren Rand sie großzügig mit Petersilienzweigen garniert hatte. »Im Grunde können sie sich glücklich schätzen«, sagte sie. »Jeder Mensch sollte mindestens einen Menschen haben, der ihm ganz gehört. Jemanden, den man nicht teilen muss.«
Anne hatte wie so oft das Gefühl, dass wieder diese alte Sache zwischen ihnen stand, obwohl sich Anne nie ganz sicher war, ob sie es sich nicht vielleicht nur einbildete. Immer dann, wenn sie eine fast schmerzliche Intimität mit ihrer Cousine zu spüren begann, wurde sie sich derer allzu sehr bewusst, als könnte jede die Gedanken der anderen lesen und wollte es nicht zulassen, dass sich diese Intimität weiter vertiefte. »Ich wünschte, du würdest mir etwas zu tun geben. Dir helfen lassen.«
Di sah sich in der Küche um, als hielte sie nach einer Aufgabe Ausschau, wurde aber, obwohl es bestimmt viele gab, nicht fündig. »Warum gehst du nicht zu Dan hinaus, um ihm Hallo zu sagen? Er hat bestimmt den Wagen vorfahren hören und denkt, du zeigst ihm die kalte Schulter.«
»Glaubst du wirklich, Männer leiden unter derlei Unsicherheiten?«
Di lächelte traurig, und wieder spürte Anne den Stich der Intimität. »Jedenfalls behaupten sie es.«
3. Kapitel
Dan Wood fischte an der hinteren Stirnseite des Pools Blätter aus dem Wasser, als er die Terrassentür aufgehen hörte und aufsah. Anne hatte nicht den Eindruck, dass er wirklich vorankam. Der Wind hatte aufgefrischt, und die brüchigen Herbstblätter schienen von der ruhigen Wasseroberfläche förmlich angezogen zu werden. Trotz des langstieligen Keschers war die Mitte des Beckens für Dan in seinem Rollstuhl unerreichbar, und das bunte Laub lag in mehreren Schichten auf dem Wasser wie eine farbenfrohe Tagesdecke auf einem sanft wogenden Wasserbett. »Deinem Gesichtsausdruck nach«, sagte Dan lächelnd, »wolltest du gerade sagen, dass ich im Begriff bin, den Kampf mit der Natur zu verlieren.«
»Warum plagst du dich denn damit ab?«
»Weil sonst der gottverdammte Filter verreckt«, sagte er. Dass sich Dan in ihrer Gegenwart dieser derben Ausdrucksweise bediente, war der Vertrautheit zwischen ihnen geschuldet. Diana schätzte Obszönität nicht, und die alte Milly hätte eine solche Sprache nur in ihren vielen Bedenken hinsichtlich ihres Schwiegersohns bestärkt, die sie in den letzten rund zwanzig Jahren, die meisten davon unter seinem Dach zugebracht, freimütig geäußert hatte. Wobei Dan immer nur in ruhigem und andächtigem Ton fluchte, und er tat es nie, wenn er wirklich wütend war, in solchen Situationen war er auffällig beherrscht.
Ohne zu protestieren, ließ er sich von Anne den Kescher abnehmen, die ebenfalls Schwierigkeiten hatte, den Blätterteppich in der Mitte des Pools zu erreichen, und sich weit vorbeugen musste. Eine Weile gab er sich damit zufrieden, ihr zuzusehen. »Wenn es nach mir ginge, würde ich den verdammten Pool mit Zement auffüllen, dann wäre Schluss mit dem Ärger.«
»Benutzt Di den Pool nie?«
»Nur gelegentlich«, sagte er, als würde diese Einschränkung sein Argument nicht zunichtemachen. »Hätte ich das Wasser doch nur im September ablaufen lassen. Ich wusste doch, dass der Indian Summer vor der Tür steht.« Er schob sich im Rollstuhl zum Ende des Beckens und zog einen Sack aus der Kiste, die auf dem Sprungbrett stand. »Und – sind die beiden da drinnen in ihrem Element?«
»Ja, sie stecken selig die Köpfe zusammen.«
»Das bleibt sicherlich so für den Rest des Nachmittags. Wie geht es Mather?«
»Kann es kaum erwarten, endlich entlassen zu werden.«
»Ich habe gehört, du hast dich heldenhaft verhalten.«
Anne klopfte ein paar am Netz klebende Blätter vom Kescher auf den Beckenrand. »Nun, die Meinungen gehen auseinander, meine Mutter würde dir jedenfalls was anderes erzählen.«
Anne war von der Arbeit nach Hause gekommen und hatte ihren Vater halb tot im Wohnzimmer vorgefunden. Obwohl es die zweite Oktoberwoche war, flimmerte die Hitze über dem Asphalt wie sonst nur im Juli und August. Mather Grouse war aus seinem Sessel nach vorn gefallen, weil er sich, wie so oft, vorgebeugt hatte, um Atem zu schöpfen, und kauerte jetzt in einer bedenklichen Position gegen die Wand gelehnt, ein Bein unter sich, das andere vor sich ausgestreckt, als wäre es eine Theaterpose. Wegen der Hitze trug er kein Hemd, die Haut auf seinen Schultern war blass und durchscheinend. Als Anne hereinkam, starrte er mit schreckgeweiteten Augen auf einen unbestimmten Punkt, ein Ausdruck, den seine Tochter noch nie an ihm wahrgenommen hatte und der ihn wie einen Fremden aussehen ließ. Sein Inhalator lag nur wenige Zentimeter von seiner zuckenden Hand da, und seine Atemzüge waren so kurz und schnell, dass der Sauerstoff gar nicht erst in seine geplagten Lungen gelangte. Er hätte ebenso gut unter Wasser sein können.
MrsGrouse war ebenfalls im Wohnzimmer; angsterstarrt stand sie wenige Meter von ihrem Mann entfernt. Als Anne hereinkam, nickte sie einfach nur in Richtung Mather Grouse. Das Einzige, was ihrer Meinung nach gesagt werden musste, sagte sie mehrmals. »Der Krankenwagen ist unterwegs. Alles wird gut werden … ganz bestimmt wird es gut. Der Krankenwagen …«
Nachdem sich Anne neben ihren Vater gekniet hatte, versuchte sie, seine Aufmerksamkeit zu erlangen. Aber Mather Grouse’ Augen wollten sich hinter den flatternden Lidern einfach nicht fokussieren, und seine Brust hob und senkte sich heftig unter seinen krampfartigen Atemzügen. Sein Mund öffnete sich weit, um dann wieder zuzuklappen, wie bei einem Kinderspielzeug, während das Kinn gegen die sich hebende und senkende Brust drückte. Als Anne den Inhalator ergriff und ihn ihrem Vater in den Mund steckte, zuckte MrsGrouse entsetzt zurück. »Nein!«, schrie sie. »Du verbrennst ihm die Lunge. Die Männer … sie werden gleich hier sein …«
»Er kriegt keine Luft, Mutter. Er stirbt.« Die Brust ihres Vaters hob sich wütend, wie als Antwort auf ihre Worte.
»Die Männer …«
Anne ignorierte ihre Mutter kurzerhand und maß die Atemfrequenz ihres Vaters, dessen Keuchen zusehends schwächer wurde. Zweimal, im Abstand von nur wenigen Sekunden, drückte sie auf die Taste des Inhalators. Zunächst reagierte ihr Vater nicht, doch dann konnte sie an seinen nach oben verdrehten Augen erkennen, dass er etwas registrierte. Nachdem sie ihn von der Wand weggezogen hatte, versuchte sie, ihn auf alle viere hochzuhieven, die Position, wie er einmal gesagt hatte, in der ihm das Atmen am leichtesten fiel. Sie hatte ihn einmal so vorgefunden, auf Händen und Knien, mit gesenktem Kopf, und es war ihm so peinlich gewesen, dass er geschworen hatte, niemals mehr diese Position einzunehmen – lieber, hatte er erklärt, würde er wie ein Mensch ersticken, als sich wie ein Tier zu verhalten. Aber als Anne ihn an Gürtel und Hosenboden hochzog, schien er zu verstehen, was sie wollte, und versuchte sogar zu kooperieren, indem er sich auf die Unterarme stützte. Es gelang ihm ein ordentlicher Atemzug, ehe die Kraft aus seinen Gliedmaßen wich und er Kinn voraus auf den Teppich sackte.
»Los, hilf mir!«, befahl Anne ihrer Mutter, die von der gegenüberliegenden Wand aus zusah, wohin sie zurückgewichen war. MrsGrouse stockte, doch dann folgte sie der Aufforderung ihrer Tochter. Nachdem es ihnen gelungen war, Mather wieder auf die Knie hochzuziehen, fürchtete Anne einen schrecklichen Augenblick lang, ihre Mutter habe recht gehabt, denn ihr Vater schien das Atmen ganz eingestellt zu haben, und ein Rasseln drang aus seiner Brust. Dann begann er zu würgen und spuckte gelben Schleim aus. Doch zugleich schaffte er auch einen richtigen Atemzug, tief in die Brust hinein, und er hielt sich daran fest wie ein Ertrinkender an einem Rettungsreifen. Als schließlich der Krankenwagen eintraf, war das eisige Blau fast schon wieder aus seinen Wangen gewichen. Er hatte sich nicht geweigert, auf allen vieren auszuharren, allem Anschein nach dankbar, zumindest einstweilen, einfach noch am Leben zu sein. Selbst als Tier.
»Tja«, sagte Anne und pflückte ein besonders leuchtendes Blatt vom Kescher, »und so bin ich in Ungnade gefallen.«
Dan Wood, der ihrer Erzählung irgendwie abwesend gelauscht hatte, machte sich daran, die nassen Blätter mit einer Schaufel in den Sack zu stopfen. »Ich würde dich gern bemitleiden, aber du bist alt genug, um zu wissen, dass du dich deiner Mutter nicht widersetzen darfst. Für wen hältst du dich eigentlich, dass du es wagst, deinem alten Vater das Leben zu retten, nachdem man dir das ausdrücklich verboten hatte?«
»Aber ich habe ihm nicht das Leben gerettet, verstehst du? Das ist das Verdienst der Sanitäter. Mein Verdienst ist es, dass er sich den Kiefer gebrochen hat, musst du wissen.«
»Ach so.«
Es gab immer noch jede Menge Blätter herauszufischen, aber plötzlich ließ sich Anne auf einen Liegestuhl sinken und lehnte den Kescher gegen ein Knie. »Schon lustig irgendwie«, sagte sie. »Als ich jünger war und es zwischen mir und meinem Vater zu kriseln begann, hatte ich einen Tagtraum, in dem ich ihn aus einem brennenden Haus rettete. Ich wusste, es war idiotisch, aber immer wieder gab ich mich dieser Fantasievorstellung hin. Ich malte mir aus, er sei bewusstlos und ich würde ihn durch die lodernden Flammen hindurch herausziehen. Keine Ahnung, wo Mutter während dieser Rettungsaktion steckte.«
»Tot, jedenfalls nach Freud.«
»Lass den Quatsch!«
Dan duckte sich, als Anne eine Handvoll Blätter nach ihm warf.
»Wie auch immer, scheint, als wäre mein Wunsch in Erfüllung gegangen. Und weißt du, was ich getan habe, als ich ihn am nächsten Morgen im Krankenhaus besuchte? Ich habe mich dafür entschuldigt, dass ich ihm den Kiefer gebrochen habe.«
»Und jetzt bist du sauer auf deine Mutter?«
Anne sah ihn an, überrascht von seinem Ton, aber er erwiderte ihren Blick nicht. »Was willst du damit sagen?«
»Gar nichts. Ich habe mich nur gerade gefragt, wie Mather über die ganze Sache denkt.«
»Er hat einen gebrochenen Kiefer, vergessen?«
»Mhmm«, machte Dan. »Du solltest so ein Zeichenbrett für Kinder besorgen. Du weißt schon, eins, auf das man etwas schreibt, und dann zieht man ein Plastikding darüber, und das Ganze verschwindet. T-H-A-N-K-S, dann ratsch – und schon ist die Tafel wieder sauber.«
Anne funkelte ihn an, bis er sich entschuldigte und dann hinzufügte: »Erzähle mir einfach nichts, wenn du meine gottverdammte Meinung darüber nicht hören willst.«
Sie bereute es tatsächlich, ihm davon erzählt zu haben. Ihr hätte klar sein müssen, wie er reagieren würde. »Das ist noch so ein nutzloser Traum von mir, dass ihr beide euch eines Tages mögen werdet.«
Sie sprachen jetzt direkt miteinander, sahen nicht mehr aneinander vorbei.
»Das ist so, als träumte ich davon, wieder gehen zu können.«
»Was wäre daran falsch?«
»Nur alles.«
»Ich verstehe nicht, warum du und mein Vater euch nicht mögen solltet. Im Grunde seid ihr euch ziemlich ähnlich. Zum Beispiel seid ihr die unverbesserlichsten Sturköpfe, die ich kenne.«
»Abgesehen von Dallas.«
»Ja, klar.« Ihr Exmann. »Wie immer abgesehen von Dallas.«
»Nun«, sagte Dan lächelnd, »ich mag’s nicht, wenn man mich als stur bezeichnet. Und ich mag deinen Vater nicht. Hab ihn noch nie gemocht, werd’ ihn nie mögen. Und du kannst mich nicht umstimmen, egal, was du tust.«
Anne kam nicht umhin, sein Grinsen zu erwidern, wie immer. Gerade wenn sie drauf und dran waren, ernsthaft aneinanderzugeraten, zog die Gefahr vorüber, als wäre nie etwas gewesen – »wie ein Furz in einem Windstoß«, wie Dan zu sagen pflegte. Er hatte eine Art, die offenkundig beleidigendsten Dinge, ob sie nun banal oder ruchlos waren, zu sagen, ohne beleidigend zu sein. Eine seltene Gabe, fand sie. Die anderen Männer in ihrem bisherigen Leben hatten es irgendwie immer fertiggebracht, beleidigend zu sein, selbst wenn sie auf Zehenspitzen gingen.
»Wie auch immer«, sagte Dan, »ich bin froh, dass es ihm wieder besser geht.«
»Es geht ihm nicht wirklich besser. Der Arzt meint, es ist nur eine Frage der Zeit, ehe er wieder einen Anfall bekommt. Es wäre gut, eine Sauerstoffflasche zu Hause zu haben.«
»Und ist das ein Problem?«
»Irgendwie schon. Aber man hat mir zu verstehen gegeben, mich da rauszuhalten. Mutter beharrt darauf, dass er zu stolz ist, aber ich vermute, sie ist diejenige, die zu stolz ist. Du weißt ja, wie heikel sie ist, wenn es um das Haus geht – die erste Garnitur Schonbezüge ist dafür da, das Sofa zu schonen, die zweite, die Schonbezüge zu schonen. Eine Sauerstoffflasche im Wohnzimmer wäre, als würde man das Unaussprechliche einräumen.«
»Milly ist genauso. Wir tun nichts ohne ihre Erlaubnis. Di kauft selbst für unser Schlafzimmer nichts, ohne sie vorher um ihren Rat zu fragen.«
Dan fuhr in seinem Rollstuhl von Haufen zu Haufen auf dem Pooldeck herum und schaufelte Blätter in den Gartensack. Eigentlich hätte sie ihm helfen müssen, fühlte sich jedoch mit einem Mal bleischwer, also blieb sie sitzen und sah ihm dabei zu. Eine Zeit lang hatte sie gedacht, er würde sich nie mit dem Rollstuhl abfinden, und noch lange nach dem Unfall hatte sie erwartet, dass er irgendwann einfach aufstehen und davonhumpeln würde. Aber inzwischen war der Rollstuhl ein Teil von ihm. Sein ehemals schlanker Bauch begann sich vorzuwölben. Sie wusste, dass er viel trank, und auch wenn sie es ihm nicht verdenken konnte, kamen ihr jedes Mal, wenn sie daran dachte, wie er einmal gewesen war, fast die Tränen. Auch jetzt spürte sie sie hochsteigen und musste den Blick abwenden.
»Früher habe ich immer nach irgendwelchem Zeugs Ausschau gehalten, mit dem ich sie auf die Palme bringen konnte«, sagte er. »Vor ein paar Jahren bin ich zum Beispiel auf so ein kleines obszönes Aufziehding gestoßen. Der kleine Kerl hatte einen Schwanz, der so lang war wie ein Bein. Wenn man an der Schnur zog, hat er schräge Sachen damit angestellt. Ich habe es ihr hübsch in einem Karton verpackt zum Geburtstag geschenkt.«
Das war wirklich eine komische Vorstellung, und sofort war Anne leichter ums Herz. Dan war noch immer der Gleiche. »Schade, da wäre ich gern dabei gewesen.«
»Nein, das wärst du nicht. Sie ist ganz grau im Gesicht geworden, und ich dachte ›oh-oh‹. Diana kochte natürlich vor Wut, und seitdem bin ich ein braver Junge, mehr oder weniger. Ich nehme an, es gibt keine triftigen Gründe, alte Frauen zu quälen.«
»Hilf mir doch bitte auf den Sprung: Welchen Grund gibt es, dass sie uns quälen?«
Ehe er zu einer Antwort ansetzen konnte, war ein Pfeifen zu hören, etwas krachte zuerst auf den Rand des Pools, dann auf den Blechschuppen. Dan wirbelte herum und hob einen Golfball vom Boden auf. »Das ist ein guter«, sagte er und hielt ihn hoch, damit Anne ihn in Augenschein nehmen konnte. »Ein Titleist. Hat dich übrigens knapp verfehlt.«
Er zog die Schuppentür auf, gab den Ball in einen Eimer, in dem bereits an die hundert weitere lagen. »Wenn ich aus diesem Rollstuhl rauskomme, fange ich auch wieder mit dem Golfspielen an«, sagte er. »Schade, dass die Leute nicht auch Schläger verlieren.«
»Hast du beschlossen, die OP zu wagen?«
»Warum verdammt noch mal nicht? Sie wird eine Stange Geld kosten, aber laut Kurpfuscher des Monats stehen die Chancen gar nicht so schlecht. Hältst du mich für verrückt?«
»Nein, ganz und gar nicht.«
»Ich auch nicht. Meine Schwiegermutter meint, ich bin verrückt. Aber da sie mal alles erben möchte, wenn ich das Zeitliche segne, hat sie vor allem etwas dagegen, dass ich Geld ausgebe.«
»Hey!«, rief eine Stimme, die jemandem gehörte, der gerade groß genug war, um über Dans Rotholzzaun zu spähen. »Ist hier zufällig ein Golfball gelandet?«
»Ne«, sagte Dan verschmitzt lächelnd.
»Aber sicher.« Der Mann runzelte die Stirn und murmelte dann: »Ein nagelneuer Titleist.«
»Was sollte ich bitteschön mit einem Golfball anfangen?«
Der Mann bemerkte den Rollstuhl und wurde blass. »Du lieber Himmel, tut mir leid.«
»Schwamm drüber«, erwiderte Dan. »Kommen Sie doch mal zum Lunch vorbei.«
Als der Mann wieder verschwunden war, ging die Innenhoftür auf, und Di kam auf das Pooldeck heraus. »Hast du schon wieder einen Golfball gestohlen?«
»Aber klar doch«, gab ihr Mann zu. »Und noch besser, ich hatte endlich mal eine Komplizin.«
»Die Strafe Gottes wird dich noch ereilen.«
»Hat sie schon.«
»Das Mittagessen steht auf dem Tisch. Bring deine Komplizin mit.« Diana ließ den Blick durch den Innenhof schweifen. »Gute Arbeit, übrigens.«
Seit Anne aufgehört hatte, Blätter herauszufischen, hatten sich erneut jede Menge davon auf dem Wasser gesammelt. Als die Tür hinter ihrer Cousine zuging, merkte Anne, dass es plötzlich kühl geworden war. Es gab nichts Unerbittlicheres als ein Winter in Mohawk, und Anne war sich nicht sicher, ob sie einem weiteren gewachsen war, nicht dieses Jahr jedenfalls. »Soll ich dich schieben?«, fragte sie.
»Vorausgesetzt, du drehst mich zuerst um. Wie du siehst, war ich gerade in Richtung Wasser unterwegs.«
Anne hob den schweren, mit nassen Blättern gefüllten Sack hoch und hievte ihn auf Dans Schoß. In der Nähe der Tür standen drei groß Mülltonnen, und Anne fragte sich, ob Di sie immer auf den Gehsteig hinausschleifen musste. »Di sieht erschöpft aus«, sagte sie, ehe sie den Rollstuhl in Richtung Haus drehte.
»Sie ist immer todmüde.«
»Ich wünschte, ich könnte etwas für sie tun. Aber ich frage mich, ob es nicht heuchlerisch wäre.«
»Das glaube ich nicht.«
»Wenn sie es wüsste, glaubst du, sie hätte uns inzwischen verziehen?«
»Ja. Schon lange.«
»Ich weiß nicht, ob ich es könnte. Wenn ich mir sicher wäre. Hat sie in all den Jahren nie gefragt?«
»Nicht einmal andeutungsweise«, sagte er. »Ich weiß nicht, was ich ihr antworten würde. Sie ist viel zu lieb, um sie anzulügen.«
»Oder zu verletzen.«
»Ja, oder zu verletzen.«
Drinnen hatten sich MrsGrouse und Old Milly nicht vom Fleck gerührt. Nur ihre Haltung hatte sich verändert, irgendwie saßen sie gerader und schienen stärker, als hätte der ständige Kniekontakt eine Art Transfusion bewirkt. Als Anne und ihr Schwiegersohn hereinkamen, hob Milly blitzschnell den Kopf. »Diana!«, rief sie. »Sollen wir alle verhungern, oder gibt es in diesem Haus mal etwas zu essen?«
»Steht alles auf dem Tisch, Ma«, sagte Dan vom Eingang aus. »Wenn ich es sehen kann, ohne aufzustehen, müsstest du es doch eigentlich auch sehen können.«
Die alte Frau wandte sich wieder ihrer Schwester zu. »Ich habe die ganze Woche kaum einen Bissen zu mir genommen«, sagte sie. »Aber jetzt könnte ich einen ganzen Ochsen verspeisen.«
»Weißt du was, Liebes?«, sagte MrsGrouse. »Ich habe aus irgendeinem Grund auch Appetit.«
»Aus irgendeinem Grund«, murmelte Anne. Aus irgendeinem Grund war er ihr vergangen.
4. Kapitel
Dallas Younger drehte sich laut ächzend im Bett um. Er hatte lebhaft geträumt und wollte gern weiterschlafen, um herauszufinden, wie der Traum endete. Es nicht zu wissen würde ihm den ganzen Tag lang zu schaffen machen. Er würde eine Menge Zeit damit verschwenden, sich die Einzelheiten des Traums in Erinnerung zu rufen und diese auf irgendwelche Hinweise zu untersuchen, bis sein Bewusstsein schließlich alles vertreiben würde. Abgeschlossenen Träumen schenkte Dallas nie Aufmerksamkeit, aber Traumfragmente beunruhigten ihn.
Der Wecker auf dem Nachttisch zitterte und gab ein schwaches Summen von sich, so wie immer, wenn er ihn lange läuten ließ, ehe er ihn ausschaltete. Dallas öffnete ein Auge und linste misstrauisch auf das Zifferblatt; er wollte einfach nicht glauben, jedenfalls noch nicht, dass er schon wieder verschlafen hatte. Dann überfiel ihn ein schrecklicher Gedanke, und er fuhr mit der Zungenspitze über den vorderen Gaumen und spürte dort nichts als Zahnfleisch. Da er nicht bereit war, den Umstand zu akzeptieren, dass seine Zunge auf keinen Widerstand stieß und, nun, da er darüber nachdachte, obendrein ranzig schmeckte, steckte er den Zeigefinger in den Mund und fuhr damit über das Zahnfleisch. Es gab keinen Zweifel mehr. Seine Prothese war schon wieder verschwunden.
Als er vom Flur vor seiner Wohnung her ein Geräusch hörte, sprang er aus dem Bett. Das war jetzt das dritte Mal in ebenso vielen Monaten, dass er die Prothese verloren hatte, und plötzlich war ihm klar geworden, dass sie jemand stehlen musste; genau, jemand schlich sich in seine Wohnung und nahm sie ihm, während er schlief, heraus. Mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit war es Benny D., der ihm einen Streich spielen wollte. Schwer konnte es ihm nicht fallen, denn Dallas schlief immer mit geöffnetem Mund, eine von einem Dutzend Gewohnheiten, die Anne ihm unvernünftigerweise zum Vorwurf gemacht hatte, als hätte er die Kontrolle darüber. Er rannte zur Tür und öffnete sie gerade noch rechtzeitig, um seine Nachbarin, MrsNicolelia, dabei zu erwischen, wie sie, nachdem sie ihre Wohnungstür aufgeschlossen hatte, etwas in ihrer Geldbörse verstaute. Was immer es war, es klang in Dallas Youngers Ohren ein bisschen wie das Geräusch von Zähnen, die gegen Münzen stießen, und er beäugte die Frau argwöhnisch.
Was MrsNicolelia sah, als sie aufblickte, war ein sechsunddreißigjähriger Mann, der nackt war und aussah, als wäre er gerade mit einem ganz bestimmten Gedanken aufgewacht. Etwas, das mit ihr zu tun hatte, einer mittelalten verwitweten Frau, die allein lebte, es sei denn, ihre Tochter war zu Besuch, was so gut wie nie geschah.
Dallas wiederum nahm zwei Dinge gleichzeitig wahr: Erstens, dass er nichts anhatte; und zweitens, dass MrsNicolelia keine Diebin war. Ihr Gesichtsausdruck war ein beredtes Zeugnis dafür. »Meine Zähne«, versuchte Dallas zu erklären, verhaspelte sich aber.
»Ihre was?«, frage MrsNicolelia verwirrt, die von dem nackten Mann eine ganz andere Art der Kommunikation erwartet hatte.
»Zähne«, wiederholte Dallas. Dieses Mal entsprach der Laut, den er von sich gab, etwas mehr dem Wort, das er meinte, und es gelang ihm, die Verwirrtheit seiner Nachbarin wenigstens um eine Ebene zu verringern.
»Sie haben ja gar keine«, stellte sie fest. Doch Dallas beäugte noch immer misstrauisch ihre Geldbörse, sein Bewusstsein weigerte sich, das Geräusch zu verwerfen, das er zunächst für das fallender Zähne gehalten hatte. MrsNicolelia öffnete die Börse weit genug, damit er hineinspähen konnte. Keine Zähne.
Zurück in seiner Wohnung, machte sich Dallas an eine gründliche Durchsuchung der Räumlichkeiten, obwohl er im Vorhinein wusste, dass es zwecklos war. Er konnte jetzt klarer denken, und die vorherige Gewissheit, dass seine Zähne gestohlen worden waren, entpuppte sich als vorschnell. Seine Zweizimmerwohnung zu durchsuchen war kein großer Aufwand. Nachdem er in der Spüle und Dusche nachgesehen und das Schlafsofa abgezogen hatte und mit den Händen an den Nähten entlanggefahren war, war er auch schon so gut wie fertig. Wobei seine Suche nicht ganz ohne kurzfristige Erfolgserlebnisse blieb, denn er fand unter anderem seinen Nagelknipser, anderthalb Dollar in Münzen und ein Taschenbuch von Mickey Spillane mit gebrochenem Buchrücken und losen Seiten. Aber nichts, was auch nur annähernd wie Porzellan aussah. Er fischte das Buch heraus und warf es in den Mülleimer; wenn er je das Bedürfnis verspüren sollte, es zu Ende zu lesen, würde er sich ein neues Exemplar zulegen. Was ziemlich unwahrscheinlich war, denn dieses hier war schon vor einigen Monaten verschwunden. Auf lange Sicht würde ihm vermutlich die Frage, wie sein unfertiger Traum hätte ausgehen sollen, mehr beschäftigen. Im Flurschrank durchwühlte er sämtliche Taschen diverser Kleidungsstücke, ob sauber oder schmutzig, und fand mehrere interessante Dinge, aber nicht das, was er suchte. Nachdem er es aufgegeben hatte, zog er das einzige saubere Arbeitshemd, das sein Schrank noch hergab, an – es trug zufälligerweise den gestickten Namenszug Cal auf der Bruttasche – und beschloss, dass es höchste Zeit war, seine Sachen zu waschen. Die letzten beiden Tage hatte er Hemden mit den gestickten Namenszügen anderer Menschen getragen, ein untrügliches Zeichen dafür, dass allmählich alles zur Neige ging.
Tatsächlich war der diesmalige Verlust seiner Teilprothese nicht tragisch, denn als er letztes Mal ohne Schneidezähne aufgewacht war, hatte er in weiser, wenn auch ungewöhnlicher Voraussicht eine neue bestellt. Die Ersatzprothese in der rosa Schachtel hinter der Old-Spice-Flasche im Medikamentenschrank, die ihm vorvorige Weihnachten jemand geschenkt hatte, wollte er schon lange einmal ausprobieren. Er setzte sie ein, und siehe da, sie passte perfekt, sogar besser als die alte. Statt weiterhin wütend und beschämt zu sein, spürte er zunehmende Zufriedenheit mit sich selbst, weil er sich so hellsichtig gegen die Auswirkungen dieses Missgeschicks gewappnet hatte.
Da er ohnehin schon spät dran war, beschloss er, auf dem Weg zur Arbeit noch kurz bei der Witwe seines Bruders vorbeizuschauen, auch weil ihm aus irgendeinem Grund eingefallen war, dass seine Nichte heute Geburtstag hatte. Mutter und Tochter wohnten in einem kleinen quadratischen Haus am Stadtrand in der Nähe der Autowerkstatt, wo er arbeitete. Da die Einfahrt mit Spielsachen übersät war, parkte Dallas am Straßenrand. Obwohl Loraine und Dallas’ jüngerer Bruder David noch keine zwanzig gewesen waren, als sie geheiratet hatten, bekamen sie erst mit Ende zwanzig ein Kind, nachdem sie die Hoffnung fast schon aufgegeben hatten. David freute sich so über das Baby, dass er jeden überzähligen Penny für seine Tochter beiseite legte, nicht dass viele Pennys übriggewesen wären. Als Dawn ein Jahr alt war und David erfuhr, dass er Krebs hatte, gingen die Pferde mit ihm durch, und er nahm einen ziemlich hohen Kredit auf, um dem kleinen Mädchen Geschenke zu kaufen, die für die nächsten zwanzig Jahre reichen sollten. Sie füllten den begehbaren Kleiderschrank im Gästezimmer, und jedes war in Geschenkpapier eingewickelt und datiert: Frohe Weihnachten 1985; Alles Gute zum Geburtstag, 1987. Am Tag nach Davids Beerdigung zeigte Loraine Dallas den Kleiderschrank, und er erinnerte sich noch gut, wie sie all die bunt verpackten Geschenke angestarrt hatte, überwältigt angesichts des Bedürfnisses ihres verstorbenen Mannes, noch viele Jahre lang aus dem Grab heraus am Leben seiner Tochter teilzunehmen und es zu bereichern.
Als Dallas ankam, saß Dawn auf der Schaukel im hinteren Garten, die Füße mit den weißen Turnschuhen weit nach vorn gestreckt. Sie hatte den Bogen noch nicht heraus, richtig Schwung zu holen, gab aber ihr Bestes. Als sie ihren Onkel sah, bremste das kleine Mädchen mit den Füßen und rannte ihm entgegen. »Pau!«, rief sie aus und stach ihm mit dem Zeigefinger auf die Stirn, während er sie hochhob.
»Wie alt bist du jetzt?«, fragte er.
»Zwei alt.«
»Ich bin derjenige, der alt ist, du Dummerchen. Im Übrigen bist du drei geworden. Weißt du nicht, wann du Geburtstag hast?«
Loraine trat an die Fliegengittertür und musterte ihren Schwager müde. Sie war noch immer im Bademantel. Gut möglich, dass es sogar Davids Bademantel war. »Du schon wieder«, sagte sie und hielt die Tür auf, damit Dallas hereinkommen konnte, ohne seine Nichte absetzen zu müssen.
»Was für eine freundliche Begrüßung, nachdem du mich einen Monat lang nicht gesehen hast.«
Loraine neigte den Kopf zur Seite und schaute ihn misstrauisch an. »Du warst gestern Nacht hier, falls du es vergessen hast. Um drei Uhr morgens.«
Dallas wusste nicht, ob er ihr glauben konnte oder nicht. Er erinnerte sich überhaupt nicht daran, seine Schwägerin in der vorigen Nacht besucht zu haben, wobei er sich so gut wie gar nicht an die vorige Nacht erinnerte. Doch als er sie eben hinter dem Moskitogitter erblickt hatte, drängte sich ihm aus irgendeinem Grund ein Bild auf – eine Erinnerung? –, wie sie im Nachthemd vor ihm gestanden hatte, unter dessen dünnem Stoff sich ihre Brüste abgezeichneten. Dallas versuchte zu ergründen, warum er dieses Bild plötzlich vor Augen gehabt hatte. »Und was soll ich hier gemacht haben?«, fragte er, aufrichtig neugierig.
»Du warst betrunken. Ich habe zu dir gesagt, du sollst Leine ziehen. Du erinnerst dich wirklich nicht?«
»Hatte ich da meine Zähne drin?«
Loraine bedachte ihn mit einem genervten Blick, in dem wenig Mitleid lag. »Nicht schon wieder …«
Dallas nickte, setzte sich auf einen Stuhl am Küchentisch und nahm das kleine Mädchen auf den Schoß. Dawn zog das Kleidchen hoch, um ihm ihre Unterhose zu zeigen, auf die ein Schwein gestickt war. Sie lehnte sich so weit sie konnte zurück, die Knie hoch in die Luft gereckt, damit er das Schwein in Augenschein nehmen konnte. »Fährst du mit mir zu Chickey Fried Chicken?«
»Du meinst den Kentucky Colonel? Bis nach Schenectady?«
Dawn nickte eifrig und zog ihr Kleidchen wieder herunter.
»Manchmal kann ich es immer noch nicht glauben, dass David und du Brüder ward«, sagte Loraine.
»Onkel Dallas hat gesagt, ich hab heute Gefurstag.«
»Woher soll er das wissen? Er weiß ja nicht mal, wo seine Zähne sind.« Loraine sah ihn mit zusammengekniffenen Augen an. »Und was sind das in deinem Mund für welche?«
»Ersatzzähne. Willst du damit sagen, sie hat gar nicht Geburtstag?«
»Du hast gestern Nacht schon den gleichen Unsinn behauptet. Sie hat erst Mitte des Monats Geburtstag.«
»Und ich hatte meine Zähne drin?«
»Es war drei Uhr nachts, Dallas. Ich kann mich nicht erinnern. Wobei es mir wohl aufgefallen wäre, wenn du sie nicht drinnen gehabt hättest.«
Da jetzt offenbar Einigkeit darüber herrschte, dass sie nicht Geburtstag hatte, wand sich Dawn vom Schoß ihres Onkels herunter, lief zu ihrer Mutter, klammerte sich mit einer Hand am Bademantel fest und steckte die andere Faust fast gänzlich in den Mund.
»Komm wieder her.«
»Nein«, sagte das kleine Mädchen und weigerte sich kokett, ihn anzusehen.
»Was ist da noch mal auf deiner Unterhose drauf?«
»Ein Schwein«, sagte Dawn, die Faust noch immer im Mund.
»Glaub ich nicht«, erwiderte Dallas, aber seine Nichte fiel nicht auf den Trick herein.
»Wenn du schmollen willst, kannst du das draußen machen«, sagte ihre Mutter. »Und nimm die Hand aus dem Mund.«
Als Dawn nicht gehorchte, zog Loraine die Hand heraus.
»Will nicht raus«, wimmerte die Kleine, und Tränen stiegen ihr in die Augen. »Hab Gefurtstag.«
»Vielen Dank auch«, sagte Loraine in Dallas’ Richtung.