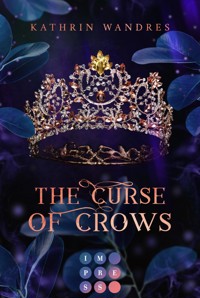3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Es gibt nur einen Weg, die Welt zu retten. Doch was, wenn es der falsche ist? Nach dem gescheiterten Versuch, den Mondfluch zu brechen, befindet sich Thy in Gefangenschaft der Dunkelseelen. Diese haben es sich zum Ziel gesetzt, mit Hilfe des Mondlichts die Halbwesen zu vernichten. Niemand ist rachsüchtiger als Suri - ihre Anführerin. Doch Thy muss feststellen, dass nicht nur die Dunkelseelen hinter dem Mondlicht her sind, welches sie in sich trägt. Auch die Halbwesen setzen alles daran, es wieder zurückzuerobern. Auf ihrer Flucht leidet Koraj zunehmend unter dem Mondfluch. Es entsteht ein Wettlauf gegen die Zeit und Thy muss eine folgenschwere Entscheidung treffen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Titelei
Impressum
Namensregister
Die Sage von der Dunkelheit der Sonne
Prolog
I. Heute – Eine Woche vor Neumond
II. Wenige Tage vor Neumond
III. 4 Tage bis Neumond
IV. 3 Tage und 18 Stunden bis Neumond
V. 3 Tage und 15 Stunden bis Neumond
VI. 2 Tage bis Neumond
VII. 1 Tag und wenige Stunden bis Neumond
VIII. 1 Tag und wenige Stunden bis Neumond
IX. Wenige Stunden bis Neumond
X. Neumond
XI. Im Morgengrauen nach der Neumondnacht
XII. Der Morgen nach dem Neumond
XIII. Die Totalphase der Sonnenfinsternis
XIV. Die letzten Augenblicke innerhalb der Kernfinsternis
XV. Wenige Minuten nach der Sonnenfinsternis
Epilog
Über die Autorin
Leseprobe »Vampire Love – Blutendes Herz«
Kathrin Wandres
MONDFLUCH
Band 2
Rache der Dunkelseelen
www.kathrin-wandres.de
www.facebook.com/KathrinWandresAutorin
www.instagram.com/kathrin.wandres
© 2020 Kathrin Wandres
Zeisigweg 6
73035 Göppingen
www.kathrin-wandres.de
Alle Rechte vorbehalten.
Lektorat und Korrektorat: Katharina Areti Dargel
Cover: Pintado | www.pintado.weebly.com
Schlussredaktion: Mira Valentin
Alle Bestandteile dieses Buches sind geistiges Eigentum der Autorin. Die Verwendung der Texte und Bild – auch auszugsweise – ist ohne vorherige Zustimmung der Autorin urheberrechtswidrig und strafbar. Dies gilt auch für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Verarbeitung mit elektronischen Medien. Die unautorisierte Nutzung und Verwertung von Texten, Namen oder Sachverhalten für oder zu Spielen und Spielsystemen aller Art ist nicht erlaubt.
Namensregister
THY, 17, Mensch, Tochter eines Halbwesens, geboren zur Sonnenfinsternis, Trägerin des Mondlichts
HALBWESEN
KORAJ, 20, unschuldiges Halbwesen, Zugehöriger der 363. Erdengeneration
AYAH, abtrünniges Halbwesen, Vater von Thy, Zugehöriger der 362. Erdengeneration
BERBAT, Oberster Kommandant der Halbwesen, Sohn der wirren Mo, Zugehöriger der 361. Erdengeneration
BARISCH, abtrünniges Halbwesen, Zugehöriger der 362. Erdengeneration
DUNKELSEELEN
SURI, Oberste der Dunkelseelen
Die weißhaarigen FÜNFLINGE, Brüder von Suri
RAKAN, ehemaliger »Türsteher« von Ayah
Die wirre MO, Mitte 80, ehemalige Bewohnerin von Thys Siedlung, Mutter von Berbat
MENSCHEN
LAIA, Mitte 30, Schwester von Thy, Gefangene von Berbat
GERDIAN, Alter und Herkunft unbekannt
RUNE, Großvater von Thy, blind seit der Sonnenfinsternis bei Thys Geburt
ORI, Oberster von Thys Siedlung
UNINA, genannt »Mutter Una«, Mutter von Ohnename und Ziehmutter von Pek, Blitz, Donner und der verstorbenen Dea
OHNENAME, wenige Wochen alt, Sohn von Una, Vater unbekannt
BLITZ und DONNER, 13, Waisenkinder, genannt »die stummen Zwillinge«
PEK, 15, Bruder der verstorbenen Dea, Waisenkind, wohnt bei Mutter Una
SERBO, Mitte 30, Bruder des verstorbenen Jaso
Die Sage von der Dunkelheit der Sonne
Es war einmal zu einer Zeit, als die Sonne noch ihre eigene Finsternis besaß. Es war eine wunderschöne magisch-schwarze Dunkelheit und viele Jahrmillionen herrschte eine friedliche Ausgewogenheit zwischen Hell und Dunkel.
Doch eines Tages begann ein Krieg auf dem Mond. Dabei erlosch dessen Licht und stürzte zur Erde hinab.
Durch den Verlust des Mondlichts wurde das empfindliche Gleichgewicht zwischen Hell und Dunkel gefährlich gestört und die Sonne war gezwungen, den Verlust des Lichts auszugleichen. Dadurch zerbröckelte ihre naturgegebene Finsternis und fiel Stück für Stück auf die Erde.
Der Mond jedoch blickte neidisch auf das strahlende Licht der Sonne und ersann sich einen Plan, Teile des übermäßigen Sonnenlichts zu stehlen. Als die Sonne dies bemerkte, war sie zutiefst enttäuscht von dem Hinterhalt des Mondes und versuchte fortan, ihr Licht vor ihm zu verbergen.
Daraus entstand ein ewiger Kampf um das Sonnenlicht. Es gab Tage, da siegte der Mond. »Vollmond!«, triumphierte er, doch die Sonne setzte sogleich zum Gegenschlag an. »Neumond« nannte sie ihn herablassend, wenn er aus ganzer Schwärze bestand.
Und es kam, dass die Tücke des Mondes überhandnahm. Immer wieder schaffte er es, sich am Tag vor die Sonne zu schieben und sie daran zu hindern, dass ihr Licht die Erde erhellen konnte. Stattdessen warf er die größte Intensität seiner Finsternis, die er aufbringen konnte, auf die Erde.
Während dieser dunkelsten aller Stunden war die Sonne machtlos. Und obwohl es Tag war, wurde es auf der Erde finster wie bei Nacht.
Diese unnatürlichen Dunkelphasen blieben nicht ohne Folgen. Denn ein Stück der finsteren Schatten nistete sich in jenen Seelen ein, die während dieser Stunden zur Welt kamen.
Und diese Seelen, geboren zur Sonnenfinsternis, wurden durchdrungen von Dunkelheit. Sie entwickelten Fähigkeiten, unberechenbar und finster.
Doch weh allen Erdenvölkern, sollte die Finsternis in ihren Seelen überhandnehmen. Dann wären sie zu allem fähig.
Seitdem gieren sie nach Dunkelheit.
Rücksichtslos.
Prolog
Bald - In wenigen Tagen
Er rannte.
Seit endlosen Minuten war er bereits unterwegs. Schilf peitschte ihm gegen die Arme, als wollte es ihn antreiben, immer schneller zu laufen. Alle Energie, die er noch in seinem Körper fand, holte er hervor und steckte sie in seine Beine. Einfach nur weiterrennen. Sein Ziel hatte er klar vor Augen. Das konnte ihm selbst die zunehmende Dunkelheit nicht entreißen. Doch die hatte ihm seit jeher nichts ausgemacht. Im Gegenteil: Sie war ihm zusätzlicher Ansporn und Kraftquelle. Und Kraft brauchte er in diesem Moment wirklich.
Mit aller Gewalt ignorierte er die Tränen, die seine Wangen feucht hielten, als wäre er ein Teil des Sumpfes. Tränen konnte er nicht gebrauchen. Also rannte er noch schneller, um sich einzureden, seine Augen tränten aufgrund des zunehmend stärker werdenden Windes. Dass dies eine Lüge war, würde er vor niemandem zugeben.
Denn der Grund für seine Tränen war sie. Aber er hatte keine Wahl gehabt. Er musste sie zurücklassen.
Egal, wie schnell er auch rannte, die Bilder von ihr folgten ihm auf Schritt und Tritt. Noch immer sah er ihre unnatürlich weit aufgerissenen Augen, diesen verzweifelten Blick, und spürte seine eigene Verzweiflung im Inneren, weil er es nicht hatte verhindern können. Er würde sein Leben tauschen gegen ihres, wenn er es rückgängig machen könnte. Der Schmerz in seinem Herzen wurde beinahe unerträglich bei dem Gedanken, dass selbst er - ein Halbwesen, das mächtigste Wesen auf Erden - dies nicht vermochte.
Also blieb ihm nur noch eines: Er musste es zu Ende bringen, musste das vollbringen, was seit jeher ihr Wunsch gewesen war.
Warum er das tat? Ganz einfach. Weil er sie liebte. Er hatte sie vom ersten Moment an geliebt. Mit solcher Heftigkeit, dass es ihn schwindeln ließ. Er würde alles für sie tun, alles für sie aufgeben, und wie sehr wünschte er sich eine letzte Gelegenheit, um ihr das zu beweisen.
Die zunehmende Dunkelheit ließ ihn spüren, wie sehr die Zeit drängte. Er musste noch schneller laufen, spornte er sich selbst an. Dann würde er es schaffen. Er würde siegen, das wusste er ganz tief in seinem Inneren.
Endlich gab die Armee aus stramm stehendem Röhricht ihn frei und er fühlte wieder den vertrauten, harten Boden seines Heimatgebietes unter den Füßen. Schnell überbrückte er die letzten Meter bis zu seinem Ziel und flog förmlich die Kraterwand hinauf, die ihn dorthin brachte, wohin er wollte.
Trotz der vollendeten Finsternis erkannte er sie, mit dem Rücken zu ihm stehend, sah ihre Haare im Wind wehen. Und dann sprach sie das aus, was er mit aller Macht zu verhindern suchte. »Und ich werde siegen!«, kreischte sie außer sich.
Unbändige Wut mischte sich in seinen Schmerz und er konnte dem Druck nicht mehr standhalten, musste es hinausschreien, um nicht innerlich zu zerbersten.
»DAS WIRST DU NIEMALS!«, brüllte er mit letzter Kraft, mit aller Inbrunst, mit vollkommener und bedingungsloser Liebe.
Den Rest des Geschehens nahm er lediglich verschwommen wahr. Als würde er in dem Leid seiner Seele ertrinken. Nun handelte er nur noch. Instinktiv, zielorientiert. Er tat das, was getan werden musste und wozu keiner vor ihm imstande gewesen war. Wie blind stolperte er vorwärts. Bahnte sich seinen Weg ans Ziel, egal wer oder was sich ihm auch entgegenstellte. Er sah es bereits vor sich, so nah wie nie zuvor. Behielt nur noch das im Auge, weswegen er hier war. Und er würde siegen, er wusste, er würde siegen.
Dann spürte er das Schwert in seinem Rücken, spürte, wie es Haut und Organe durchstach, förmlich aufspießte, doch der Schmerz war ihm egal. Denn er dachte nur an die Eine.
»Für sie!«, röchelte er bei seinem letzten Atemzug, bevor er zusammenbrach.
I. Heute – Eine Woche vor Neumond
Entschlossenheit führt dich ans Ziel.
Doch nur Menschlichkeit lässt dich erkennen, ob der Weg dorthin lohnenswert ist.
(Die wirre Mo, Dunkelseele aus Bedawi)
Golden wie die Krone eines rechtmäßigen Herrschers fällt der Lichtschein der Fackel vor mir zu Boden. Jeden Morgen und jeden Abend erhellt er in spärlichster Weise mein dunkles Quartier. Nur so viel, dass ich Wasser und Nahrung entgegennehmen kann. Nur so lange, bis meine Augen sich an die Helligkeit gewöhnt haben – um sie mir dann wieder zu entreißen und mich der Finsternis zu überlassen.
Viel zu viele Tage sitze ich nun schon in meinem kleinen Gefängnis fest, das die Dunkelseelen im Zirkel »Raum der Findung« nennen. Doch weder sie noch ich haben bisher irgendetwas gefunden. Nach Suris Offenbarung hat man mich sprachlos und nicht minder empört hier zurückgelassen. Die Oberste des Zirkels plant die Vernichtung der Halbwesen – mit meiner Hilfe? Eher stürze ich mich in den Ay, als dass ich das zulasse.
Daraufhin wurde ich an diesen Ort gebracht, »Raum der Findung«, obwohl es »Gefängnis« wirklich besser trifft. Seither warten sie darauf, dass ich mehr von meiner inneren Dunkelheit finde – oder sie mich.
»Es dient nur zu deinem Besten«, riefen sie mir zu, während sie mich in dieses Loch steckten und ich mich mit Händen und Füßen dagegen wehrte. »Wenn sich die Dunkelheit erst der Gänze deiner Seele bemächtigt hat, wirst du es verstehen!«
Doch nichts geschieht. Und nichts verstehe ich. Mein Schreien gab ich ziemlich schnell auf. Die entscheidenden Personen in meinem Leben würden es ja dennoch nicht hören können!
In manchen dunklen Nächten rede ich mir ein, dass das Mondlicht in mir die Finsternis daran hindert, völlig Besitz von meiner Seele zu ergreifen. Denn dass ebendieses weiterhin in mir wohnt, dessen bin ich mir inzwischen ziemlich sicher. Wie die wirre Mo mir erklärte, kurz nachdem wir hier eingetroffen waren, benötigt das Mondlicht immer ein Gefäß, um zu existieren. Und dieses Gefäß bin wohl derzeit ich.
Im Moment ist das aber meine geringste Sorge. Auf meiner Dringlichkeitsliste ganz oben steht in erster Linie das Verlassen dieses Raumes, in dem sich wahrlich nichts finden lässt. Aber das stellt sich als schwieriger heraus als zunächst gedacht. Am ersten Tag hatte ich noch die Hoffnung, es wäre lediglich für den Augenblick, übergangsweise, bis ich mich beruhigt hätte. Doch als auch am zweiten und selbst am dritten Tag Suri nicht bei mir auftauchte und lediglich namenlose Wachen mir Essen brachten, ohne ein einziges Wort mit mir zu wechseln, wusste ich, dass es mehr brauchen würde, um hier herauszukommen. Gegen die schwarze eherne Tür zu hämmern, habe ich bereits nach wenigen Minuten aufgegeben. Stattdessen bin ich dazu übergegangen, mein Gefängnis zu untersuchen. Dank meiner Halbwesengene ist es für mich selbst in geschlossenen Räumen nie vollständig dunkel. Die unzähligen Schwarznuancen, die auch hier existieren, faszinieren mich immer wieder aufs Neue. Doch wie ich eine Dunkelseele sein kann, ohne jedoch in der Lage zu sein, ihre mir zugedachte Finsternis in mich aufzunehmen, bleibt mir weiterhin ein unlösbares Rätsel. Der Raum meines Gefängnisses ist nahezu rund. Selbst die Decke in niedriger Höhe hat die Form einer Kuppel. Alles besteht aus einem glatten, sehr festen Material, das mir bisher noch nie begegnet ist. Und auch unabhängig von der Finsternis hier drin ist das Gestein von einem tiefen, ungetrübten Schwarz. Nicht dass mich das stören würde, aber ein ungutes Gefühl weckt es dennoch in mir. Denn irgendetwas sagt mir, dies sei kein natürliches Schwarz. Es ist ihr Schwarz. Das der Dunkelseelen.
Jeglichen schmerzlichen Gedanken an Koraj und meine Sorge um ihn zu verdrängen, habe ich längst aufgegeben. Denn so wie es schon immer war, verfolgt er mich auch jetzt bis in meine Träume.
»Deine Träume sind mehr Realität, als du ahnst«, teilte mir die wirre Mo in unserer ersten Nacht im Zirkel nach der Flucht aus dem Ay mit, bevor Suri mich in dieses einsame Loch steckte. Ich war gerade aus einem unruhigen Schlaf hochgeschreckt und sobald ich die Augen öffnete, besah mich Mo mit einem prüfenden Blick. »Ich trug seit jeher die tiefe Ahnung in mir, dass auch du eine Dunkelseele bist.« Seufzend strich sie mir dabei über meine weißblonden Haare, als wäre das Erklärung genug. »Deine Träume sind keine Träume. Sie sind dunkle Visionen. Kurze Blicke, die durch Raum und Zeit gehen, um die Dinge zu sehen, die passieren werden, wenn wir nichts dagegen unternehmen.«
»Können das alle Dunkelseelen?«, fragte ich sie daraufhin staunend, weil ich sofort wusste, dass sie die Wahrheit sprach. Zu oft schon hatte ich selbst diese dunklen Visionen bereits erlebt und auch die von Mo und Rakan mitbekommen.
Langsam nickend mied sie meinen Blick. »Ja«, antwortete sie zögerlich. »Doch manche können noch mehr ...«
Was dieses Mehr bedeuten sollte, war sie nicht mehr in der Lage gewesen zu erläutern. Denn sie wurde jäh unterbrochen und ich in diesen Kerker hier gesteckt. »Wehre dich nicht gegen die Dunkelheit!«, rief sie mir noch hinterher. Doch zu viel Warnung schwang in ihrer Stimmfarbe mit und zu viel Zittern begleitete ihre Worte. So wusste ich sofort: Ich würde nie zulassen, dass ihr Schwarz ganz von mir Besitz ergreifen würde.
Doch im Augenblick sind die Träume meine einzige Verbindung zu ihm. Koraj. Und die will und darf ich nicht aufgeben. Nicht bevor ich ihn wieder an meiner Seite habe. Ihn, das wahrscheinlich einzige Halbwesen, das nie getötet hat – so wie ich mit Sicherheit der einzige Mensch bin in diesem von Tod geprägten Land, der nicht töten will. Ich unterdrücke das mulmige Gefühl in meinem Bauch, das mir einreden möchte, es könnte bereits zu spät sein. Das, was ich momentan in meinen Träumen von ihm sehe, ist besorgniserregend und beruhigend zugleich. Sorge lässt seine körperliche Verfassung in mir aufkommen. Geschwächt, oft schlafend, beinahe krank wirkt er, wenn ich ihn sehe, jede Nacht aufs Neue, und das versetzt mich in Alarmbereitschaft. Die Entwendung des Mondlichts aus dem Besitz der Halbwesen scheint ihn schneller verkümmern zu lassen, als es vorher der Fall war. Dadurch wurde jedoch der Fluch nicht, wie ursprünglich erhofft, gebrochen, und so weiß ich nicht, wie viel Zeit ihm noch bleibt, bis das Unvermeidliche eintritt. Beruhigend sind die Träume insofern, dass sie sich nicht groß verändern. Jedes Mal aufs Neue sehe ich ihn an der gleichen Stelle liegen. Nie entdecke ich andere Personen um ihn herum und doch scheint er mit Nahrung versorgt zu sein. In akuter Gefahr schwebt er also nicht. Doch wo er sich befindet, haben mir die kurzen Ausschnitte meiner Visionen bisher nicht verraten. Sicher haben ihn die Halbwesen nach der Mondfinsternis daran gehindert, den Ay zu verlassen, und ihn dort in irgendeine Art Gefangenschaft genommen. Ob es sich in meinen Träumen von ihm um die Gefängnisgruben innerhalb des Vulkans handelt, konnte ich bisher nicht ausmachen.
Da mich aber diese erdachten Eventualitäten nicht weiterbringen, konzentriere ich mich auf mein Hier und Jetzt und achte dabei auf jede Kleinigkeit, die mich aus diesem Gefängnis herausbringen könnte. Leider gibt es davon nicht sehr viele. Ich höre kaum andere Stimmen und wenn, dann sind sie so weit weg, dass ich keine einzelnen Wörter ausmachen kann. Seit dem ersten Tag hat niemand mehr mit mir gesprochen und die Wachen, die mir das Essen bringen und meinen Nachttopf leeren, sind nahezu resistent gegen meine Fragen. Oder sie lassen nur solche zu mir, die taub sind. Mit genauso leeren Augen, wie ich sie einst bei Rakan sah, verrichten sie stumpf die ihnen aufgetragenen Arbeiten und ich muss nicht groß herumraten, um zu erkennen, dass auch sie in Suris Dienst stehende Dunkelseelen sind.
Und weil seit Tagen keiner mehr mit mir geredet hat, hallt nach wie vor der letzte Satz in meinen Ohren, den Suri zu mir sagte: »Finde deine Dunkelheit – dann werden wir die Welt beherrschen!«
Auch wenn ich hoffe, dass sie lediglich einen Hang zur Theatralik hat, befürchte ich, in dieser Aussage der Obersten der Dunkelseelen mag mehr Wahrheit stecken, als mir lieb ist. Und vielleicht ist auch das ein Grund dafür, dass ich die Dunkelheit meiner Seele gar nicht finden will. Mich überläuft noch immer eine Gänsehaut, wenn ich an ihre Worte denke. Ob sie wirklich dazu in der Lage wäre, die Halbwesen zu vernichten?
Ein leises Pochen rechts von mir lässt mich von meinem kümmerlichen Bett aufschrecken. Ich meine schon, mich verhört zu haben - vielleicht verliere ich jetzt endgültig den Verstand in dieser Finsternis -, bis ich es ein zweites und sogar ein drittes Mal höre. Dann folgt ein undeutliches Fluchen. Irritiert nähere ich mich dem Geräusch, das aus einem kleinen Loch in der Wand nahe dem Boden zu kommen scheint. Schnell gehe ich neben diesem in die Hocke, das kaum groß genug ist, dass ich einen Finger hineinstecken könnte. Als einige Sekunden lang alles ruhig ist und ich nicht zu atmen wage, vernehme ich ein erneutes Fluchen. Nun bin ich mir ganz sicher: Auf der anderen Seite der Wand ist jemand und versucht, Kontakt zu mir aufzunehmen. Vorsichtig beuge ich meinen Kopf in Richtung der kleinen Öffnung.
»Ist da jemand?«, flüstere ich und kann ein Zittern nicht vollständig unterdrücken. Teils vor Aufregung, teils aus Misstrauen.
Ein heiseres Seufzen folgt sofort als Antwort, dann nervöse Worte, die wie »Na endlich, wurde aber auch Zeit!« klingen und sich seltsam vertraut anhören. Doch bevor ich weiter darüber nachdenken kann, spricht die dumpfe Stimme hinter der Wand weiter. So leise, dass ich mich sehr konzentrieren muss, um zu folgen. Aber auch so nervös und hektisch, um sofort die Wahrheit darin zu erkennen.
»Hör mir genau zu!«, beginnt die Stimme, die ich eindeutig einem Mann zuordnen kann. »Du darfst ihr nicht trauen! Egal, was sie dir sagt. Egal, was sie dir anbietet. Bleib wachsam! Und halte Abstand von ihr!« Er spricht schnell, heiser, flüsternd. Zeit ist etwas, das er nicht hat. Dafür aber Angst. Die Furcht, erwischt zu werden, tränkt seinen Tonfall.
»Wer bist du?«, hauche ich ihm durch das fingergroße Loch zu und versuche vergeblich, mich soweit hinab zu beugen, dass ich hindurch spähen kann. »Wie komme ich hier heraus?«
»Es wird bald soweit sein«, wispert er weiter. Es fällt mir schwer, durch die winzige Öffnung irgendetwas ausmachen zu können. »Und wenn es soweit ist, achte auf das, was nicht dorthin gehört! Lass es nicht aus den Augen! Wenn ich kann, werde ich zurückkommen.«
Meine Gedanken drehen sich im Kreis, immer schneller und zu schnell, um etwas erkennen zu können. »Was meinst du damit?«, zische ich ihm verzweifelt zu, sobald ich durch das Loch eine Regung wahrnehme. Ich darf ihn nicht gehen lassen, ohne noch mehr Informationen bekommen zu haben. »Du sprichst in Rätseln! Was hat Suri mit mir vor?«
Einige endlose Augenblicke hält die Bewegung inne und in mir keimt die Hoffnung, er würde mir noch mehr preisgeben, mir Hinweise geben, wie ich fliehen kann, mir verraten, was Suri mit mir vorhat.
»Triff die richtige Entscheidung!« Kaum mehr als ein lautes Ausatmen, aber so deutlich, dass es mir in den Ohren dröhnt. Dann verschwindet er. Doch bevor er den Platz hinter meiner Gefängniswand verlassen hat, kann ich etwas erspähen, das Erinnerungen in mir weckt. Versteckte Erinnerungen, denen ich keine Bedeutung mehr beigemessen habe. Es sind orangefarbene Haare.
Ich weiß sofort, um wen es sich handelt, und doch traue ich meiner Wahrnehmung kaum. Es ist nicht möglich, dass er hier ist – oder doch?
Mir wird nicht die Zeit gelassen, darüber nachzudenken, denn noch ehe er verschwunden ist, höre ich dröhnende Schritte, die sich meiner Zelle nähern. Viele Schritte von Füßen, die gelernt haben, alle Kraft und Entschiedenheit in ihr Auftreten zu legen, um neben Klarheit auch Furcht zu vermitteln. Ich ahne nichts Gutes. Mir bleibt gerade noch genug Zeit, um von dem Loch in der Wand aufzuspringen und mich auf mein Bett zu setzen.
Bereits beim nächsten Atemzug öffnet sich schwerfällig die steinerne Tür, für die es sicherlich mehrere Halbwesen bräuchte, um sie einzustoßen. Ich staune erneut über die Beschaffenheit meines Gefängnisses. Sicherlich ist es noch niemandem gelungen, von hier zu fliehen. Falls es noch mehr gibt, die hier gegen ihren Willen gefangen gehalten werden. Und eine dumpfe Ahnung sagt mir, dass dies so ist.
Angespannt erhebe ich mich von meinem Lager, bis aufs Äußerste konzentriert und darauf bedacht, mir keine Kleinigkeit entgehen zu lassen. Quietschend öffnet sich die Tür, lässt seltsame Strahlen von einem düsteren Licht in mein Zwangsquartier und gibt mir den Blick frei auf fünf breite, mürrisch dreinblickende Männer, die in ihrer Größe den Halbwesen Konkurrenz machen könnten. Unwillkürlich frage ich mich, wen sie in mir vermuten, dass sie eine Armee an Wachen zu mir schicken. Befürchten sie, ich könnte sie überwältigen und dann fliehen?
Sobald ich mich an die Zwiespältigkeit des fremden Lichts gewöhnt habe, lassen sich mehr und mehr Einzelheiten ausmachen. Das Erste, was mir ins Auge sticht, ist die überaus markante Haarfarbe, die nicht nur »Mürrische Wache Nummer Eins«, sondern auch alle weiteren vier, die sich hinter ihm aufbauen, miteinander teilen. Es ist ein ungetrübtes, überaus reines Weiß. So weiß, dass die Befürchtung in mir aufkeimt, diese Männer könnten für die seltsame Art des Lichts verantwortlich sein, das von draußen hereindringt.
Weiter komme ich mit meinen Gedanken nicht, denn Nummer Eins postiert sich breitbeinig und mit in die Seiten gestemmten Händen nur eine Armlänge von mir entfernt und man muss kein besonders kluger Kopf sein, um zu merken, dass Einschüchterung seine Methode der Wahl ist.
Ohne zu zwinkern, stiert er mich an - ein, zwei, drei ... fünf Sekunden lang. Wahrscheinlich ist er es gewohnt, dass seine Anstarr-Opfer spätestens dann ängstlich kauernd auf die Knie gehen, doch ich halte seinem garstigen Blick bewegungslos stand.
Irgendwann rümpft er angewidert und beinahe ein wenig beleidigt die Nase, ehe er bockig wie ein kleines Kind auf dem Absatz kehrtmacht.
»Nehmt das Gör mit!«, blafft er die anderen vier Weißköpfe an, deren Haare allesamt bis auf die Schultern reichen, so dass sie kaum voneinander zu unterscheiden sind. Er scheint niemand bestimmten von ihnen zu meinen, denn alle vier setzen sich gleichzeitig in Bewegung, um mich zu packen und aus der Zelle zu zerren.
»Und zerquetscht sie nicht in eurem Wahn!«, maßregelt Nummer Eins sie gereizt. »Wir brauchen sie lebend.«
Mürrisch – und ich glaube langsam, dass sie gar keinen anderen Gemütszustand in der Lage sind auszudrücken – einigen sich die Verbliebenen schließlich, welche zwei mich mit festem Griff an den Armen packen und mich hinter dem Anführer her schleifen. Die anderen beiden bilden die Nachhut. Eine Flucht ist somit tatsächlich ausgeschlossen.
Auch ohne das Gespräch soeben mit meinem unbekannten Informanten wäre ich höchst wachsam. Jetzt bin ich nahezu alarmiert. Jede Einzelheit sauge ich in mich auf, will nichts unbeachtet lassen, um dieses Eine, was »nicht dorthin gehört«, nicht zu übersehen. Aber hier ist alles so neu, so anders, so fremdartig, dass mir nicht klar ist, wie ich etwas Derartiges erkennen sollte.
Der Anführer der Weißhaarigen marschiert in betont langen Schritten voraus, tritt mit solcher Macht auf, dass der Klang seines Laufs an den schwarzen glatten Wänden der hohen Gänge hinaufzukriechen scheint, um von deren Decke als Echo zurückgeworfen zu werden. Mit seinem Takt, dem alle vier seiner hellen Kopien in akkurater Übereinstimmung nachkommen, gibt er uns Richtung und Tempo vor. Ich ignoriere den Druckschmerz an beiden Unterarmen von den festen Griffen meiner Wachen.
Je mehr wir uns von meinem Gefängnis entfernen, desto mehr komme ich ins Staunen. Zunächst passieren wir unzählige identischer Türen, wie die, aus der ich gerade getreten bin, und alle tragen ein Schild mit den Worten »Raum der Findung«.
»Ob hier je jemand fündig wird?«, murmele ich ein wenig verwundert ob der großen Anzahl dieser Kammern, die wir in einem Labyrinth aus schwarzen Gängen passieren.
»Jeder, der würdig ist!«, zischt mir mein linker Nachbar zornerfüllt zu. Unwillkürlich zucke ich zusammen. Er scheint irgendetwas Widerwärtiges in mir zu sehen, das ich nicht in der Lage bin zu greifen. Doch ein Nachfragen, was er damit meinen könnte, wird sofort im Ansatz zunichte gemacht.
»Ruhe dahinten!«, herrscht Nummer eins uns an. »Mit der Gefangenen wird nicht geredet.« Dann fügt er Worte hinzu – so leise, als seien sie verboten, und so gefährlich wie eine Drohung, die meine Seele erzittern lässt: »Das darf nur sie.« Der dunkle Schatten, der sich bei der Betonung des letzten Wortes auf mich legt, zeigt mir, dass er nur eine damit meinen kann: Suri. Die Oberste der Dunkelseelen. Diejenige, die die wirre Mo mit dem Leben ihres Sohnes erpresst hat, um mich und somit das Mondlicht zu bekommen. Meine Entführerin.
Im nächsten Moment weiten sich die Gänge mit einer Gewaltigkeit, als würde sie ein Riese auseinanderreißen. Die Deckenhöhe vervielfältigt sich bei jedem Schritt und schon nach wenigen Atemzügen stehen wir in einer Halle, die es mit den Ausmaßen der südlichen Sumpfabgründe aufnehmen kann. Gerade noch rechtzeitig kann ich verhindern, dass sich mein Mund von alleine öffnet wie bei einem staunenden Kind, wenn es seine erste eigene Waffe bekommt.
Unwillkürlich bleibe ich stehen ob der schwindelerregenden Größe dieses Saals, der über und über mit schwarzglänzenden Kristallen ausgekleidet ist, die von innen heraus zu leuchten scheinen. Eine düstere Helligkeit, welche dem gestohlenen Licht des Mondes näher ist als dem strahlenden Sonnenlicht bei Tage. Unzählige Spitzen dieser Bergkristalle schmücken wie schwarze Eiszapfen die runde Wölbung der weit entfernten Decke und hängen wie eine Drohung über uns – um bei einem falschen Schritt oder einem verbotenen Wort den Schuldigen unmittelbar aufzuspießen. Die gigantische Höhle ist erfüllt von einer bedrohlichen Ruhe, die einen glauben lässt, man würde darin ertrinken. Am entgegengesetzten Ende kann ich einige Gestalten ausmachen, die mit handwerklichen Tätigkeiten beschäftigt sind. Sobald wir die Halle betreten, scheinen sie aber in ihrer Bewegung zu erstarren. Zu fragen, wer sie sind, wage ich nach der vorherigen Zurechtweisung nicht.
Keiner von ihnen traut sich, mich offen anzusehen, und doch merke ich, wie jeder Einzelne von ihnen in meine Richtung schielt. Ihr Schweigen ist lauter als das kleinste Wort.
»Willkommen im Schloss der ewigen Dunkelheit!«, raunt mir die Wache zu meiner Linken kaum hörbar zu und ich weiß sofort, dass dies nicht meine Dunkelheit ist.
Wir haben das Ziel unseres Marsches noch nicht erreicht, wie mir ein heftiger Stoß in den Rücken deutlich macht. Ohne mich zu beklagen, folge ich unserem Anführer, der schon einige Schritte vorausgegangen ist. Auch ihn scheint die beinahe greifbare, ehrfürchtige Mächtigkeit in diesem Saal in ihren Bann zu ziehen, so dass er unser Zurückbleiben nicht bemerkt. Schnell schließen wir zu ihm auf, während ich meinen forschenden Blick schweifen lasse. Allerdings kann ich nicht viel Zusätzliches erkennen. Trotz ihrer Größe scheint dies nichts weiter als eine Durchgangshalle oder eine Art unterirdischer Innenhof zu sein. Ich nehme unzählige Gänge wahr, die von hier abzweigen, und scheinbar willkürlich steuert unser Anführer einen davon an.
Wir durchqueren also einen Teil der Halle und kurz bevor wir sie wieder verlassen, gehen wir so nah an einer Gruppe Personen vorbei, dass ich sie tuscheln hören kann. Oder vielleicht versuchen sie auch gar nicht erst, es zu verbergen.
»Das ist sie!«, raunt eine unscheinbare Gestalt mit kurz getrimmten Haaren, aber einer deutlich weiblich kurvigen Figur. Sie deutet mit dem Kopf in meine Richtung, worauf sich die um sie Gescharten für wenige Sekunden zu mir umwenden. Sobald sie meinen Blick wahrnehmen, drehen mir alle – ich zähle sieben von ihnen – schlagartig wieder den Rücken zu. Das nachfolgende Gemurmel ist so leise, dass ich es nicht mehr verstehen kann. Außerdem verlassen wir in diesem Moment wieder die Durchgangshalle und betreten einen Gang, der sich in der Schwärze von den anderen nicht unterscheidet, jedoch irgendwie hoheitsvoller wirkt. Bevor ich ergründet habe, woher dieses Gefühl stammt, wird der Gang immer breiter. Ohne sein Tempo zu verringern, bringt uns »Mürrischer Anführer« zielstrebig voran und hält auch nicht an, als wir an ein Spalier von Wachen kommen, die den Gang von beiden Seiten säumen, bis hin zu einem breiten zweiflügeligen Tor, auf das wir zusteuern. Wie erstarrt blicken die Soldaten geradeaus. Ihre Haut wirkt grau und ausgemergelt, beinahe wie tot, und sie scheinen nicht einmal zu blinzeln, während wir an ihnen vorbeiziehen. Als wären sie nicht mehr Herr ihrer Sinne, reduziert auf ihre Aufgabe und darauf getrimmt, nur auf gewisse Reize zu reagieren. Äußerst unwohl in meiner Haut lasse ich mich durch das Spalier bewegungsloser Wachen führen, die durch mich hindurch blicken, als wäre ich Nebel.
Nachdem bestimmt schon fünfzehn bis zwanzig dieser Wachenpaare hinter uns liegen und ich mich zu fragen beginne, warum, bei der Macht des Mondes, jemand diese Gewalt an Schutz benötigt, sehe ich das, was meine Haut in Sekundenschnelle erkalten lässt, als würden mich Korajs kühle Finger überall gleichzeitig berühren. Ich brauche alles an Selbstbeherrschung, die ich in mir auftreiben kann, um dennoch ungerührt weiterzumarschieren. Denn als ich es sehe, weiß ich sofort: Das ist die Einzelheit, die nicht dorthin gehört!
Wir haben fast das Ende des Spalierdurchgangs erreicht, aber ich kann meinen Blick nicht davon abwenden. Wenige Schritte vor uns stiert eine der letzten Wachen auf der rechten Seite nicht wie ihre zahlreichen Kopien durch uns hindurch, sondern direkt auf mich. Mehr noch. Der Mann fixiert mich regelrecht, seine Pupillen bewegen sich mit meinem Vorwärtsgang mit und die Eindringlichkeit, mit der er mich ansieht, zeigt mir sofort, dass er mich meint. Ich lasse ihn nicht aus den Augen, grüble darüber nach, was das zu bedeuten hat und ob er mir etwas mitteilen möchte. Als ich mich auf Augenhöhe mit ihm befinde, passiert es: Der Weißkopf an meiner rechten Seite stolpert wie aus dem Nichts heraus. Mein Herzschlag schnellt in die Höhe ob des plötzlichen Rucks zu meiner Rechten, den ich nicht habe kommen sehen. Unwillkürlich frage ich mich, ob die mich anstarrende Wache ihm ein Bein gestellt hat. Doch da ich so sehr auf seine Augen konzentriert war, habe ich den Rest völlig außer Acht gelassen. Zum Zeitpunkt des Sturzes nimmt er erstmals seinen Blick von mir, tritt augenblicklich aus seiner Reihe, wie gerufen, und beugt sich bereitwillig zu dem Gestürzten hinunter, um ihm aufzuhelfen. Dieser reibt sich fluchend das verletzte Knie und schlägt unwirsch die ihm dargebotene, helfende Hand zur Seite. Umständlich hievt er sich wieder hoch, während sich der Kopf unserer kleinen Gruppe zu ihm umwendet und ihn wortreich für seine derbe Ungeschicklichkeit zurechtzuweisen beginnt. Auf diesen Moment scheint der auf mich fixierte Spalierposten spekuliert zu haben. Inmitten des Tumults steht er plötzlich direkt neben mir und haucht mir Worte ins Ohr, die meine Seele erzittern lassen: »Er! Ist! Hier!«
Mit weit aufgerissenen Augen starre ich ihn an. Meine Kehle ist auf einmal so rau, dass sein Name darin steckenbleibt. Koraj.
Fast unmerklich nickt der Mann und ich frage mich, ob ich es doch unbewusst laut ausgesprochen habe. Dann berührt er meine nun freie rechte Hand und übergibt mir einen Gegenstand, den ich auch ohne hinzusehen sofort erkenne. Es ist ein Schlüssel.
»Flieht!«, raunt er mir zu, leise wie Schneefall, während ich mit einer unauffälligen Bewegung den Schlüssel in meiner Gürteltasche verschwinden lasse. Fast zeitgleich steht der Posten bereits wieder in seiner Reihe. Bewegungslos und starr, als wäre nie etwas vorgefallen.
II. Wenige Tage vor Neumond
Dunkelheit ist ein Gut, mit dem du besonnen umgehen solltest. Es gibt genau zwei Arten von Finsternis und beide enthalten nichts Gutes. Eine, die du bekämpfen solltest. Und vor der anderen ... flieh!
(Namenloser Wachmann im Schloss der ewigen Dunkelheit)
Die beiden Torflügel fallen mit einem laut nachhallenden Knall ins Schloss. Obwohl ich zusammenzucke, habe ich das Gefühl, nichts mehr hören zu können außer den geflüsterten Worten des befremdlichen Wachmanns. Er ist hier! Flieht!
Erst als ich eine Bewegung am anderen Ende des Raumes wahrnehme und die weißhaarigen Fünflinge mit ehrfürchtig gesenkten Köpfen auf die Knie gehen, werde ich zurück in die Gegenwart geworfen. Alarmiert blicke ich nach vorn. Die Offensichtlichkeit, dass ich mich in einer Art Thronsaal befinde, weckt ungute Gefühle in mir. Auf die Knie gehen werde ich vor niemandem. Schon gar nicht vor ihr.
Denn noch bevor sie auf die oberste Stufe tritt und zu uns herab schreitet, weiß ich: Sie ist es. Auf die kleinen, zierlichen Füße folgen dünne Beine und ein schmaler Körper, sobald Suri nach und nach aus der durchdringend schwarzen Wolke tritt, die ihren Thron vollständig einhüllt.
Als sie so weit aus der Wolke gestiegen ist, dass ich ihre hüftlangen weißen Haare erkennen kann, dringt ein bitteres Würgegefühl in mir nach oben. Sofort sehe ich in meiner Erinnerung die erste Begegnung mit ihr. Mehr als eine Woche ist es her, da ich ihr aus dem Staubsturm geholfen habe, weil sie meinen Vater, ein Halbwesen, bei Tag getroffen hatte. Sie hat wie ein kleines, geschwächtes Mädchen gewirkt, verzweifelt und hilfsbedürftig. Doch all das hat sie mir lediglich vorgespielt. Vermutlich, um mich auszuspionieren, oder einfach nur aus reiner Überheblichkeit und Hohn. Ich weiß zwar noch nicht viel von ihr, aber wenn sie etwas nicht ist, dann ein hilfloses Kind. Suri ist gefährlich.
Dass man ihr nicht trauen kann, stellt sie auch jetzt sofort wieder unter Beweis. Mit einem süffisanten Lächeln schreitet sie uns entgegen wie eine Königin. Und an den Reaktionen der anderen kann ich erkennen, dass sie genau das in ihr sehen. Ihre Augen sind im Gegensatz zum letzten Mal tiefschwarz, wodurch fast jegliches Weiß darin verschluckt wird. Mir schwant, dass genau das zu ihrer alltäglichen Augenfarbe geworden ist. Das zierliche Gesicht wirkt so kindlich, als sei sie nicht älter als zehn. Doch ihr Blick ist um ein Vielfaches älter. Beinahe mütterlich legt sie ihre kleine Hand auf den gesenkten Kopf des vor ihr Knienden, der inzwischen zu einer bewegungslosen Statue versteinert zu sein scheint. Als könnte die kleinste Regung zu einer schlimmen Bestrafung führen.
Mit Genugtuung streicht sie durch seine Haare, wie von einer Sucht getrieben, und ich ahne, um welche es sich handelt: die Sucht nach Macht.
Unwillkürlich trete ich einen Schritt zurück, während sie verklärt lächelnd den nächsten beiden über die Haarschöpfe streicht. Je näher sie kommt, desto unwohler fühle ich mich, als würde ihre Aura aus ebenjener schwarzen Wolke bestehen, die auch ihren Thron umhüllt und die eindeutig auch ihre Seele ausfüllt.
Der nächste Schritt rückwärts löst es aus. Ich stoße gegen die kniende Wache hinter mir, stolpere, verliere für den Bruchteil einer Sekunde den Halt, und obwohl ich mich rechtzeitig auffange, geschieht es. Ohne die Augen zu schließen, sehe ich plötzlich mehr.
Ein Sturz.
Ein Fall.
Meine Seele fällt.
Hinein in ein tiefes, klares Schwarz.
Ich lasse es zu. Denn es ist meine Dunkelheit.
Dann sehe ich Suri. Sie hält eine Stahlkette in der einen Hand, ein Messer in der anderen. Ihr Lächeln gleicht einem bedrohlichen Gewitterhimmel. Ihre Haltung zeigt eisige Entschlossenheit. Am anderen Ende der Kette hängt jemand. So blutverschmiert, dass ich mehr ahne, als sehe, um wen es sich handelt. Noch während ich lautlos seinen Namen schreie, sticht sie zu. Durchtrennt so sauber die helle Haut seines Halses, bis jegliches Leben aus ihm herausgeströmt ist.
»Ich befreie dich«, zischt sie mir entgegen, so verzerrt und voller Gier, dass es mehr animalisch als menschlich klingt. »Früher oder später wäre es ohnehin geschehen.«
Ich kann meinen Blick nicht abwenden von seinem Blut, das von ewiger Endgültigkeit zeugt und sich mit meiner Fassungslosigkeit mischt.
»Jetzt bist du endlich bereit für meine Dunkelheit!«, triumphiert Suri, lässt das Messer fallen und wendet sich ab. Sogleich merke ich, wie das Bild anfängt zu verschwimmen, wie mir meine Vision wieder entrissen wird. Geistesgegenwärtig, als würde mir ein innerer Instinkt sagen, dass ich noch nicht alle Informationen erhalten habe, mache ich einen Schritt auf Suri zu. Gerade noch schnappe ich auf, wie sie vor sich hin flüstert und einen Gegenstand zwischen ihren Fingern dreht. Einen Schlüssel. Meinen Schlüssel.
»Das passiert, wenn du dich von mir berühren lässt«, haucht sie. »Dann erkenne ich dein nächstes Vorhaben!« Da reißt die Vision endgültig ab.
Ich schnappe nach Luft, greife mir an den Kopf, versuche, den Schwindel in Zaum zu halten, der mich zu überkommen droht. Ohne dass ich es kontrollieren kann, rast mein Herz, denn ich weiß genau, was diese Vision bedeutet. Es ist meine Zukunft. Es wird meine Zukunft sein, wenn ich sie nicht daran hindere, es zu werden.
Erschrocken blicke ich auf. Auch wenn sicher keine Sekunde vergangen ist und Suri nach wie vor an derselben Stelle steht, beide Hände auf den Häuptern ihrer Untertanen, starrt sie mich nun wie gebannt an. Ihre Augen glühen wie tödliche Lava. Die Gier, die ihr in das zarte Gesicht geschrieben steht, könnte abstoßender nicht sein. Ein dämonisches Lächeln verzieht ihre Lippen, nimmt ihr alles Kindliche und Freundliche und ich merke sofort, dass sie nicht mehr vorhat, sich vor mir zu verstellen. Sie zeigt unverhohlen ihre Macht, ihre Position, ihre Bosheit.
»Wie wundervoll«, säuselt Suri lobend. »Ich sehe, Rakan hat ganze Arbeit geleistet.«
Auf meinen fragenden Blick hin ergänzt sie mit hochgezogenen Augenbrauen: »Rakan hat dich in die Kunst des kontrollierten Falls in die Dunkelheit eingeweiht.«
Ich verstehe immer noch nicht viel von ihren Worten, dennoch nicke ich stumm, um sie nicht weiter meine Verunsicherung spüren zu lassen. Mir kommt der Sturz durch den Wasserfall mit Rakan wieder in den Sinn. Etwas hat sich seitdem verändert. Es bedarf keiner Ohnmacht, keines Schlafes mehr, um Visionen zu haben. Doch wie ich es steuern kann, ist mir nach wie vor unklar.
»Ich frage mich«, sagt sie gedehnt, »welche Version einer möglichen Zukunft du gerade in der Finsternis gesehen hast.«
Während sie beginnt, auf mich zuzugehen, ohne den Blick von mir zu wenden, weiche ich zurück. Nach dieser letzten Vision weiß ich es mit absoluter Gewissheit: Ich werde mich nicht von ihr berühren lassen. Wenn sie durch eine Berührung mein nächstes Vorhaben erkennen kann, werde ich alles dafür tun, um es sie nicht sehen zu lassen. Sofort denke ich an den Schlüssel in meiner Tasche.
Erstaunt hält sie in der Bewegung inne. Ich kann eine gewisse Überraschung in ihren Augen aufblitzen sehen.
»Unmöglich«, entfährt es ihr verblüfft. »Die Dunkelheit hat dir das Geheimnis meiner Berührung gezeigt.«
Durchdringend halte ich ihrem Blick stand und trete zur Bestätigung noch weitere Schritte zurück – in der Hoffnung, Zeit schinden und ihr noch weitere Geheimnisse über ihre offensichtliche Gabe entlocken zu können, die weit über das hinausgeht, was ich bisher bei anderen Dunkelseelen erlebt habe. Ich erinnere mich an die Worte der wirren Mo: Manche von ihnen können mehr.
Doch statt einer Erklärung greift sie mit ihrer Rechten für einen kurzen Moment an eine Kette, die sie um den Hals trägt. Es ist ein kugelförmiger Stein, der an einer Lederkordel hängt. Aber das ist nicht das Besondere an diesem Stein. Denn er ist komplett schwarz.
Mit zusammengekniffenen Augen und kritisch hochgezogenen Mundwinkeln schaut Suri mich prüfend an, als könne sie auf diese Weise durchschauen, was ich wirklich weiß – oder was ich nur vorgebe zu wissen. Und für einen Moment befürchte ich, dass sie es tatsächlich kann.
Dann schüttelt sie langsam und abschätzig den Kopf, so dass ihre langen weißen Haare wie ein Vorhang hin und her bewegt werden. In dieser Bewegung erinnert sie mich plötzlich wieder an das »kleine Mädchen«, das ich in ihr vermutete, als sie sich im Staubsturm meines Vaters verirrte. »Wie alt bist du wirklich?«, frage ich skeptisch, da ich meinen Einschätzungen und Wahrnehmungen von ihr nicht mehr zu trauen wage. »Das Kind, das ich in dir sah, hast du mir nur vorgespielt.«
Ihre Augen verengen sich, als würde sie ersinnen wollen, welche ihrer Rollen für dieses Schauspiel gerade die richtige wäre. Ob sie sich nun für die Wahrheit entscheidet oder nicht, bin ich nicht in der Lage zu erkennen.
»Ich habe bereits ein halbes Leben hinter mir, kleines Mädchen«, erwidert sie so abschätzig, dass ich nur davon ausgehen kann von ihr das Richtige mitgeteilt zu bekommen. »Nicht immer hatte ich diese jugendliche Gestalt«, setzt sie großspurig an, als wäre es ihr eigener Verdienst. »Das Leben ... hat mich verändert.«
Eine unheilvolle Gänsehaut überläuft meine Arme bei ihren Worten, ohne dass ich deren Bedeutung erkennen könnte.
»Unsere Begegnung im Staubsturm«, beginne ich meine nächsten Gedanken zu formulieren und während ich rede, höre ich, wie wahr meine Vermutung ist, »hast du nur inszeniert.« Ihr sich erneut aufbauendes, abschätziges Lächeln bestätigt meine Worte. Doch es ist keine Überraschung für mich. Seit ich sie als die Verantwortliche meiner Entführung kennenlernte, wusste ich, dass unsere erste Begegnung kein Zufall gewesen sein kann. Doch erst jetzt beginne ich zu ahnen, weshalb.
»Du wolltest eine Berührung mit mir!« Ich weiß, dass es stimmt, und ihre zähnebleckende Grimasse ist Antwort genug. »Was bringt dir eine Berührung? Zugang zu meinen Gedanken?« Ich spüre ihre Unruhe und dass ich nah daran bin mit meinen Vermutungen. Die zuvor erlebte Vision ist noch so frisch, dass sie wie eine Dauerschleife vor meinem inneren Auge abläuft. Und dann weiß ich es, fühle einfach, dass ich richtig liege, auch wenn ihre Worte in meiner Vision nur noch wie verblassende Nebelfetzen meine Gedanken erreichten.
»Eine Berührung mit mir zeigt dir mein nächstes Vorhaben. Deswegen wusstest du, dass ich vorhatte, den Fluch zu brechen.« Ich nicke, weil ich die Wahrheit darin erkenne. »Habe ich recht?«
»Deine Verbindung zur Dunkelheit ist stark«, murmelt sie entgeistert und ich höre Bewunderung aus ihrem Tonfall heraus. »Und dennoch hast du die Oberhand.« Stirnrunzelnd bedeutet sie den Niederknienden mit einer kleinen Handbewegung, sich zu erheben. Diese kommen ihrem Befehl wortlos nach und stellen sich hinter ihr in einer Reihe der Größe nach auf. »Aber es ist gar nicht vonnöten, dass die Dunkelheit vollständig Besitz von dir ergreift. Du wirst auch so bald erkennen, wie brillant mein Plan ist, und wirst dich uns mit Freuden anschließen.«
»Du willst sie zerstören.« Es ist mehr eine Feststellung als eine Frage von mir. »Die Halbwesen.« Das Zittern in meiner Stimme versuche ich zu unterdrücken, denn obwohl ich immer noch nicht weiß, wie sie es anstellen will, habe ich doch die Befürchtung, sie könnte tatsächlich in der Lage sein, dieses Ziel zu erreichen.
Ein tiefes Grollen, ähnlich einem Knurren, verlässt ihre Kehle, bevor sie den Kopf theatralisch in den Nacken wirft. »Sie haben es verdient!«, brüllt sie und ihre Worte scheinen die Wände zum Erzittern zu bringen. Dann blickt sie mich wieder an, mit dem sanften Augenaufschlag eines jungen Mädchens, und flüstert beinahe unsicher: »Oder?«
Der bedrohliche Unterton verhindert, dass Zweifel ob ihrer Bösartigkeit in mir aufkommen könnten.
»Seit Jahrtausenden zelebrieren sie ihr Morden, töten alles, was ihnen zwischen die Finger gerät, fragen nicht nach Namen, Herkunft, Alter. Nein, sie töten alles. Wir müssen dem ein Ende setzen! Mehr noch. Sie verdienen eine gerechte Bestrafung: ihre endgültige Ausrottung.«
»Aber was ist mit dem Fluch?«, werfe ich das Einzige ein, das ich zu dem Thema beitragen kann. »Ich habe das Mondlicht aus ihrem Besitz entwendet. Ihre Macht ist geschwächt. Jetzt muss es auch eine Möglichkeit geben, den Fluch zu brechen.«
»Der Fluch lässt sich nicht brechen!«, grollt sie einer Erdlawine gleich durch den Thronsaal. »Ihre Vernichtung ist die einzige Möglichkeit, unsere Erde vor ihrer ewigen Herrschaft zu schützen. Wenn wir die Macht des Mondlichts für uns nutzen ...«
Erschrocken reiße ich die Augen auf. »Darum geht es dir! Du brauchst nicht mich. Du brauchst das Licht für deinen mörderischen Plan.«
Das gierige Funkeln in ihren Augen lässt keinerlei Zweifel zu, ob ich damit richtigliege.
Doch ich komme nicht dazu, mich darüber zu empören, denn es wird Geschrei von draußen laut und zeitgleich poltert es an dem großen Torflügel hinter uns. Sofort wird die Tür mit großem Schwung aufgestoßen und donnert mit einem ohrenbetäubenden Knall gegen die Innenwand.
Entsetzt fahre ich herum, darauf bedacht, Suri nicht aus den Augen zu lassen und den Abstand zu ihr zu wahren. Ich werde unter allen Umständen eine weitere Berührung mit ihr vermeiden. Wenn etwas nicht geschehen darf, dann dass sie von dem Schlüssel in meinem Besitz erfährt, mit dem ich hoffe, fliehen zu können. Gemeinsam mit Koraj.
Herein platzt ein rundlicher, junger Mann, nicht viel älter als ich, die Haare so zottelig vom Kopf abstehend, dass er jedem Farn Konkurrenz machen könnte. Er stöhnt, stolpert wie blind in den Saal, murmelt unverständliche Dinge wie aus einer anderen Welt. Sein Gesicht ist blut- und dreckverschmiert, ebenso seine Hände, die er seltsam gekrümmt vor seinen Körper presst. Doch ich sehe noch etwas anderes: Seine Augen ertrinken im Schwarz. Im Schwarz der Dunkelseelen. Jegliches Weiß ist aus ihnen verschwunden, aufgesaugt von einer Dunkelheit, die keinen Platz für etwas anderes lässt. Es ist der gleiche Ausdruck, den ich bereits von anderen Dunkelseelen kenne. Zum ersten Mal habe ich es bei der wirren Mo erlebt. Und auch Rakan, kurz bevor er mit mir den Wasserfall hinuntersprang, wurde von diesem Phänomen ergriffen. Doch keiner von ihnen war so außer sich gewesen wie dieser Mann. Er kommt auf uns zu gerannt, stolpert, stürzt zu Boden wie blind.
»Das Ende«, jammert er die ersten Worte, die auch als solche erkennbar sind. »Es ist da! Das Schwarz ist zerbrochen. Keiner kann es wieder zusammensetzen!« Er bricht in ein herzzerreißendes Schluchzen aus, schlägt sich die blutigen Hände vor dem Gesicht zusammen, als stünde die Welt kurz vor ihrem Untergang. Einige seiner Finger stehen unnatürlich ab und ich habe den dringenden Verdacht, dass sie gebrochen sind. »Ich kann nichts mehr sehen. Nichts, nichts, nichts ...«
Sein Jammern verkommt zu einem Gewimmer, während er wie ein Häufchen Elend an Ort und Stelle zusammenbricht, um eins zu werden mit dem Erdboden.
Sprachlos starre ich ihn an und frage mich, was ihn so verstört haben kann, dass er nichts mehr um sich herum wahrnimmt.
Ich kann meinen Blick nicht von ihm wenden, während noch ein weiterer atemlos den Saal betritt.
»Verzeihen Sie, Oberste Dunkelseele«, keucht die gerade erschienene Wache in meinem Rücken. »Ich weiß nicht, wie es möglich sein konnte, aber er hat sich aus seinem Findungsraum mit bloßen Händen einen Weg nach draußen gegraben, hat mehrere Wachen überwältigt und sich bis hierhin durchgeschlagen. Er ließ sich von nichts aufhalten in seinem Wahn ...«
Suri hat sich dem zusammengesunkenen Bündel inzwischen bis auf wenige Schritte genähert. Nun hält sie der Wache hinter mir ermahnend ihre Handfläche entgegen, woraufhin diese sofort verstummt. Sie hat offensichtlich genug gehört.
Eine bedrückende Stille legt sich sogleich über den Raum, unterbrochen von unverständlichem Gefasel und Gewimmer des Blinden.
Wie beiläufig und so zart wie ein tröstendes Handauflegen berührt Suri den zerrauften Haarschopf des am Boden Kauernden.
»Was ist mit ihm geschehen?«, presse ich hervor und klinge dabei so heiser, als wenn mich gerade jemand gewürgt hätte.
Prüfend legt Suri den Kopf zur Seite, drückt ihre Hand nun fester auf den Mann, der gerade dabei ist, den Verstand zu verlieren.
»Seine Seele ist zu schwach.« Suris Tonfall ist hart und herablassend. »Er wird nicht mehr zurückkommen, das sehe ich.«
»Zurückkommen?« Verwirrt schaue ich bei dieser völlig verstörenden Szene zu und fühle mich mehr als fehl am Platz.
»Zurückkommen aus der Welt des Wahnsinns.« Nun blickt Suri mich an. Ihr Lächeln ist so gutmütig, dass man meint, sie hätte ihm gerade ein Kompliment gemacht. Das ist es keineswegs.
»Nicht jede Dunkelseele«, erklärt sie weiter, »ist rein genug, um sie ertragen zu können. Um meine Finsternis zu ertragen. Viele wurden lediglich bei einer Teilfinsternis der Sonne geboren. Sie ... sind mir nicht von Nutzen.«
Dann wendet sie sich mit einer herrischen Haltung der Wache hinter mir zu und ihre Erbarmungslosigkeit trieft aus jedem ihrer Worte. »Schlachtet ihn aus!«
Die Wache lässt ein Schnipsen ertönen und sogleich eilen mehrere Soldaten herbei, die sich den verstörten Mann schnappen und ihn unter schreiendem Protest aus dem Thronsaal schleppen.
»Aber ...«, stottere ich und weiß gar nicht, was um mich herum geschieht. »Was hast du mit ihm vor?«
Suris Mundwinkel zucken drohend und überheblich, und nur für einen Herzschlag habe ich das Gefühl, dass sie auf mich losgehen will. Ihre Hand bebt und beinahe meine ich, dass sie die Zähne fletscht. Meine Muskeln sind aufs Äußerste gespannt, bereit, sofort die Flucht zu ergreifen, sollte sie mich berühren wollen. Doch dann lächelt sie.
»Komm!«, sagt sie freundlich. »Ich werde es dir zeigen!«
Hoheitsvoll wendet sie sich um, wobei ihre weißen Haare ihr wie eine Schleppe folgen, und eilt den Soldaten hinterher.
In diesem Moment berührt mich eine Hand an der Schulter. Ich fahre zusammen, als ich die gleiche vertraute Stimme an meinem Ohr höre wie wenige Zeit zuvor in meinem Gefängnis.
»Bleib in meiner Nähe!«, haucht er so leise, dass ich befürchte, es mir nur eingebildet zu haben.
Dann marschiert er an mir vorbei, als wäre nichts gewesen, als hätte er nicht gerade etwas Verräterisches in mein Ohr geflüstert, sondern stampft mit festen Schritten wie ein treuer Soldat seiner Herrscherin hinterher. Er blickt nicht zurück, schaut nicht, ob ich ihm folge, und auch wenn ich ihn nur von hinten sehen kann, erkenne ich ihn doch sofort. Die seltsam orangefarbenen Haare, die gedrungene Gestalt und das nicht vertrauenserweckende Auftreten – weil es das Erscheinungsbild des Feindes ist. Weil er zu meinen Feinden gehört.
Es ist Rakan und er ist tatsächlich hier!
III. 4 Tage bis Neumond
Wenn du wählen könntest – Licht oder Dunkelheit, Liebe oder Hass, Leben oder Tod –, wie würdest du deine Entscheidung treffen? Die offensichtliche Antwort ist nicht immer die richtige. Und das, was sich gut anfühlt, ist nicht immer wahr. Bedenke das, bevor du deine Wahl triffst.
(Suri, Oberste der Dunkelseelen)
Es ist eine glatte, regungslose Oberfläche, auf die ich hinaus starre, als wir mehrere steil nach oben führende Gänge später ins Freie treten. Der abnehmende Mond erhellt die Umgebung nur spärlich und die vorbeiziehenden Schleierwolken tun ihr Übriges, um die Szenerie in das Gewand eines Todesboten zu kleiden.
Ich stehe vor einem kleinen Becken, das mit klarem, reinem Wasser gefüllt ist – nicht größer als das Bett in Laias und meiner Hütte. Es mutet einem Grab an, sowohl in seiner Größe und Tiefe, als auch in seiner abstoßenden, befremdlichen Wirkung, die es ausstrahlt. Unzählige dieser Wasserbecken wurden hier dicht an dicht ausgehoben und meine Vorstellungskraft geht mit mir durch, während ich mir ausmale, wozu diese dienen könnten.
Instinktiv greife ich mit den Fingerspitzen an die Haarsträhne, die mir über meine Schulter gefallen ist. Ich schließe die Augen, horche in mich hinein, wünschte, ich hätte die Möglichkeit, die Macht des Mondlichts in mir zu aktivieren, um verhindern zu können, was auch immer hier in den nächsten Augenblicken geschehen mag. Aber das Licht in mir bleibt erloschen. Ich frage mich, weshalb es die Kräfte der Halbwesen um ein Vielfaches verstärkt hat, als es in deren Besitz war, und warum es nun schweigt.
Die Veränderung der Geräuschkulisse um mich herum reißt mich aus meinen Gedanken und lässt mich die Augen wieder öffnen. Zahllose Wachposten haben sich um die Becken versammelt. Auch Rakan kann ich zwischen ihnen entdecken. Für einen Augenaufschlag huscht sein Blick in meine Richtung, eindringlich, ermahnend, beinahe ängstlich, doch einen Atemzug später starrt er wieder genauso ausdruckslos Löcher in die Nachtluft wie alle anderen seiner Kollegen.
Obwohl in unserem Land recht häufig eine Sonnenfinsternis stattfindet – vor allem partielle Verfinsterungen gibt es alle paar Monde –, wundere ich mich über die große Anzahl an anwesenden Dunkelseelen. Dass es so viele gibt, habe ich nicht geahnt.
Auf der gegenüberliegenden Seite des Beckens, vor dem ich mich befinde, taucht nun Suri auf. Sie ist um einiges kleiner als alle um sie herum und dennoch schaut sie auf uns herab. Ihre Erscheinung verstört mich auch dieses Mal und mein Fluchtinstinkt steigert sich in ihrer Nähe ins Unermessliche.
Als sie direkt am Rand des kleinen Wasserbeckens stehenbleibt und das Kinn gen Himmel hebt, wirkt sie auf einmal viel größer.
»Bringt den Unwürdigen!«, schallt ihre Stimme durch die Dunkelheit dieser frischen Nacht. Verstohlen reibe ich mir die leichte Gänsehaut meiner Arme. Ich bin mir nicht sicher, ob sie von der Kühle der Luft oder der Ahnung des Bevorstehenden herrührt.
Zwei Soldaten zerren den taumelnden Gefangenen durch die Reihen an Wachen bis zum Rand des Beckens. Noch immer murmelt er unverständliche Dinge, aber seine Tonlage hat sich zu einem wimmernden Flehen gewandelt, und ich befürchte, dass er trotz seiner geistigen Abwesenheit sehr genau weiß, was ihn nun erwartet. Fieberhaft suche ich die Umgebung ab, durchkrame mein Gehirn nach Möglichkeiten, ihn zu befreien und vor dem Unausweichlichen zu bewahren.