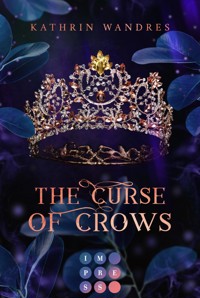4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
**Eine tödliche Gabe** Neela lebt in dem gewaltigen Mitah-Gebirge, das sich als letzte Mauer zwischen den Ausgestoßenen in Benoth und dem feindlichen Königreich erhebt. Zusammen mit ihrem Volk ist sie für den Schutz der Bergkette verantwortlich. Neela ist eine der entschlossensten Kämpferinnen ihrer Generation – doch dann begegnet ihr Jayden, die eine Person, die ihrer todbringenden Nähe standhält. Trotz aller Hindernisse kommen sich die beiden näher, bis Jayden plötzlich verschwindet. Von den mächtigen Ränkeschmieden im Hintergrund ahnt Neela nichts, als sie alles riskiert und sich auf die Suche nach ihm begibt … Eine Kriegerin, die bereit ist, alles für die große Liebe aufs Spiel zu setzen. //Alle Bände der märchenhaften »Broken Crown«-Trilogie: -- Band 1: The Secret of Kingdoms -- Band 2: The Curse of Crows -- Band 3: The Mystery of Shadows// Alle Bände der Reihe können unabhängig voneinander gelesen werden und haben ein abgeschlossenes Ende. Dies ist die Wiederauflage der »In Between«-Trilogie von Kathrin Wandres.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Impress
Die Macht der Gefühle
Impress ist ein Imprint des Carlsen Verlags und publiziert romantische und fantastische Romane für junge Erwachsene.
Wer nach Geschichten zum Mitverlieben in den beliebten Genres Romantasy, Coming-of-Age oder New Adult Romance sucht, ist bei uns genau richtig. Mit viel Gefühl, bittersüßer Stimmung und starken Heldinnen entführen wir unsere Leser*innen in die grenzenlosen Weiten fesselnder Buchwelten.
Tauch ab und lass die Realität weit hinter dir.
Jetzt anmelden!
Jetzt Fan werden!
Kathrin Wandres
The Mystery of Shadows (Broken Crown 3)
**Eine tödliche Gabe**
Neela lebt in dem gewaltigen Mitah-Gebirge, das sich als letzte Mauer zwischen den Ausgestoßenen in Benoth und dem feindlichen Königreich erhebt. Zusammen mit ihrem Volk ist sie für den Schutz der Bergkette verantwortlich. Neela ist eine der entschlossensten Kämpferinnen ihrer Generation – doch dann begegnet ihr Jayden, die eine Person, die ihrer todbringenden Nähe standhält. Trotz aller Hindernisse kommen sich die beiden näher, bis Jayden plötzlich verschwindet. Von den mächtigen Ränkeschmieden im Hintergrund ahnt Neela nichts, als sie alles riskiert und sich auf die Suche nach ihm begibt …
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
Danksagung
© Tina Laser Fotografie
Kathrin Wandres, geboren 1981, machte 2001 ihr Abitur in Tübingen und studierte bis 2003 in Stuttgart an der Fachhochschule für Technik Mathematik und Informatik. Von 2004 bis 2006 besuchte sie das Theologische Seminar Beröa, nahe Frankfurt. Mit ihrem Mann und ihren drei Kindern lebt sie in Göppingen. Seit ihrer Kindheit liebt sie es, sich fremde Welten zu erdenken und in ihnen zu versinken.
Prolog
Mein Name ist Neela und ich bin eine Harigah.Meine Gegenwart tötet Menschen.Du denkst vielleicht, das wäre schrecklich.Im Gegenteil. Es ist berauschend.Es ist meine Bestimmung.
Mir blieben noch elf Schritte bis zu meinem Ziel.
Woher ich das wusste, konnte ich nicht genau sagen. Ich wusste es einfach. Vielleicht war es Instinkt oder das, was Amaro den »Höchstgrad« der Einsetzung nannte.
Noch zehn Schritte.
Schließlich hatte keiner erwartet, dass ich bei dem Einstufungstest als Beste abschneiden würde. Doch ich hatte alle überrascht. Meine Ausstrahlung sei so stark und mein Wirkungsradius so groß wie bei sonst keinem derzeitig Lebenden aus unserem Volk, wurde beim Abschluss der Einsetzung über mich gesagt.
Neun Schritte.
Meine schwarze Zone nannte ich das, was sich innerhalb meines Wirkungsradius befand. Ein unsichtbarer Schatten, der mich umgab und den ich zwar nicht sehen, aber fühlen konnte. Denn es war meine Zone, mein Bereich, in den nie ein gewöhnlicher Mensch – es sei denn ein anderer Harigah – würde eindringen können. Die schwarze Zone, so schwarz wie mein Haar, so schwarz wie …
Es waren noch acht Schritte, als ich sein Zeichen erkennen konnte. Ich lachte lautlos in mich hinein, es war kein mitfühlendes Lachen – denn Mitgefühl für unsere Opfer wurde uns von klein auf verboten. Innerlich verhöhnte ich dieses unförmige Ding, das seine Stirn verunzierte. In seiner korrekten Form stellte es zwei liegende Halbmonde dar, die sich voneinander abwandten, jedoch in ihrer Mitte überschnitten. Über die Ländergrenzen hinweg war es bekannt als das Brandzeichen der Ausgestoßenen.
Sieben.
Pech für ihn, dass ich ihn alleine vorfand. Alleine zu sterben war das armseligste Ende, das ein Leben finden konnte. Selbst wenn es ohnehin so erbärmlich war wie seines.
Sechs Schritte.
Doch es würde ihm auch nicht helfen, wenn hunderte seiner Art bei ihm wären. Sie würden genauso jämmerlich zugrunde gehen wie dieser hier in fünf Schritten. Sie verdienten es nicht zu leben. Sie waren der Abschaum des Landes und ich tat der Welt einen Gefallen, wenn es einen weniger von ihnen gab. Das hatte uns Amaro immer wieder eingeschärft. Und ich hatte es mir zur Gewohnheit gemacht, es mir während dieser letzten Schritte immer wieder zuzusprechen.
Mir blieben noch vier Schritte. Der Radius meiner schwarzen Zone betrug gute zwanzig Meter. Amaro hatte die Ergebnisse meines Einstufungstests kaum glauben können. Der durchschnittliche Radius des tödlichen Wirkungsbereichs betrüge fünf bis sieben Meter, hatte er mir erklärt. Sein eigener lag bei dreizehn, was ihn schon von dem Durchschnitts-Harigah abhob.
Ein erwartungsvolles Kribbeln durchfuhr meinen Körper, als ich die letzten drei Schritte in Angriff nahm. Der Ausgestoßene befand sich nun nur noch etwas mehr als zwanzig Meter vor mir. Aber noch hatte er mich nicht bemerkt. Zu dem großen Radius meiner tödlichen Aura kam meine Fähigkeit, mich fast lautlos zu bewegen. Einen schwarzen Panther nannte mich mein Vater und ich bildete mir stets ein, einen gewissen stolzen Unterton bei diesen Worten zu hören, doch die Emotionen des Menschen besaßen nicht die Fähigkeit, zwischen Wunsch und Wahrheit zu unterscheiden. Darum war man gut beraten, seinen Gefühlen keine Macht einzuräumen – nicht das kleinste bisschen. Auch darin war ich gut. Zumindest nahm ich mir das jeden Tag aufs Neue vor.
Der vorletzte Schritt ließ eine begierige Vorfreude in mir aufsteigen. »Geht dem Töten mit Freude entgegen, denn es ist unsere Bestimmung!«, wurde uns immer wieder nahegelegt und ich bemühte mich, das nicht infrage zu stellen.
Ich war versucht für die letzten beiden Schritte loszustürzen. Doch wie immer zwang ich mich dazu, sie langsam und bedacht zu nehmen, beinahe feierlich, wie bei einer Beerdigung. Genau genommen war es das auch: seine Beerdigung. Denn mehr Würdigung als meine beherrschten und bewussten Schritte würde er nicht erfahren. Niemand würde ihn mehr in seiner jetzigen Gestalt zu Gesicht bekommen. Deutlich spürte ich die Anwesenheit der Geier in meinem Rücken, seit ich den Abstieg zum Fuß des Mitah-Gebirges begonnen hatte. Die Geier waren mir ständige Begleiter bei meinen Streifzügen nach Benoth. Beinahe Vertraute. Langsam ahnte ich, dass sie mehr von meiner tödlichen Ausstrahlung verstanden als ich selbst. Ihre ungeduldige Gier schwebte über uns.
Endlich nahm ich den letzten Schritt. Der zum Tode geweihte Ausgestoßene hatte mich immer noch nicht bemerkt. Doch das war nicht nötig. Er musste mich nicht ansehen, um zu sterben. Es bedurfte keines Blickes, keiner Berührung, keines Atemzuges. Jeder Mensch, der sich im Umkreis von zwanzig Metern um mich herum befand, starb innerhalb weniger Sekunden. Das, was ich an tödlicher Wirkung ausstrahlte, wurde in Sekundenschnelle von der Haut absorbiert und zerstörte das Leben erbarmungslos. Es gab keinen Schutz. Das tödliche Gift lähmte den ganzen Körper, zunächst nur die Gliedmaßen, dann in nur wenigen Herzschlägen den ganzen Körper, lähmte sämtliche Organe und schließlich das Herz.
Es war ein Sekundenbruchteil, bevor ich meinen letzten Schritt vollendet hatte, als er sich schlagartig umsah. Doch es war zu spät. Ich sah seine schreckgeweiteten Augen, sobald ich den letzten Schritt vollendet hatte. Ein überlegenes Lächeln eroberte meine Mundwinkel und innerlich jubelte ich über den Triumph, mein exaktes Gespür für meinen Wirkungsradius mal wieder unter Beweis gestellt zu haben. Alleine das war eine Kunst und für die meisten anderen Harigah nicht im Bereich des Möglichen.
Ich stand einfach nur da. Blickte ihn mit meinen dunklen Augen an, die fast ebenso schwarz waren wie meine Haare, und wartete auf das Unabwendbare. Noch immer zuckte ich jedes Mal zusammen, wenn es geschah, doch ich fing mich sofort wieder, riss mich zusammen und erinnerte mich daran, wer ich war.
Der Ausgestoßene riss seinen Mund auf, doch kein Laut verließ seine Lippen. Es war zu spät. Seine Augen ertranken in Panik, während er sich zuerst an die Brust, dann an die Kehle packte und offensichtlich nicht verstand, was mit ihm geschah. Wie sollte er auch. Er hatte mich nie zuvor gesehen, konnte nicht einordnen, wie ich so viel Macht über ihn haben konnte, doch nun würde ich das letzte Gesicht sein, das er sehen sollte. Das Gesicht des Todes. Seines Todes.
Meine Augen hefteten sich auf diesen Mann, der vor meinen Augen zusammenbrach, auf die Knie sank, den letzten Kampf seines Lebens führte. Seinen Todeskampf.
Ich vergaß zu atmen, berauscht von dem Stolz, wie viel Macht ich besaß.
Es dauerte nur wenige Herzschläge, bis mein tödliches Gift seinen Körper ganz in Besitz genommen hatte und sein Herz den allerletzten Schlag tat. Nun lag er vor mir, missgestaltet, die Gliedmaßen in unnatürlicher Weise zusammengekrümmt, die aufgerissenen Augen nach wie vor auf mich gerichtet mit der stummen Bitte, mit ihm die Nachsicht walten zu lassen, die er nicht verdient hatte.
Er war der Böse. Ich war die Gute. Ich reinigte die Welt, nahm ihr ein Stück ihrer Hässlichkeit. Jeder Mensch ein Feind, pflegte Amaro zu sagen, und jeder Tote ein Geschenk an die Welt. Und Amaro hatte immer recht. Sagte mein Vater …
Ich ging auf ihn zu und starrte mit dem auferlegten Stolz meines Volkes auf mein lebloses Opfer hinunter, freute mich, dass ich die Welt wieder einmal von ein wenig Schmutz befreit und mein Volk beschützt hatte. Und so sprach ich zu ihm die Worte, mit denen ich meine Rechtfertigungsrede bei der Einsetzungszeremonie zur höchsten Harigah begonnen hatte. Ich hatte es mir zu Gewohnheit gemacht, sie einem jeden von ihnen mitzugeben. Nicht weil sie es verdient hatten, sondern weil ich die Macht hatte. Denn es waren die Worte, die mein neues Leben eingeläutet hatten. Der Beginn meiner Bestimmung. Und so sprach ich sie auch jetzt:
»Mein Name ist Neela und ich bin eine Harigah. Ich bringe den Tod, denn dies ist meine Bestimmung. So war es schon immer und so wird es immer sein.«
1. Kapitel
Es sind tiefdunkle Augen, fast schwarz, die mich anstarren, mich zu verschlucken drohen, damit ich nie wieder Tageslicht sehe. Starr und hohl sind sie auf mich gerichtet und würden sich nie wieder von mir abwenden. Diese Gewissheit frisst sich durch meine Seele wie eine Meute dreckiger Ratten durch unser Vorratslager. Ihnen fehlt die Lebenskraft, wieder von mir wegzublicken. Denn es sind tote Augen. Es ist mir kein Trost, zu wissen, dass ich das letzte Bild bin, das diese Augen sehen. Stumm flehe ich sie an, von mir wegzublicken, hoffe vergeblich auf ein Blinzeln oder einen Hauch von Leben in ihren dunklen Grabeshöhlen. Doch es ist zu spät. Der Tod lässt sich niemals rückgängig machen. Ich versuche wegzurennen, weg von diesen starren Augen, weg von diesem Tod, dem ersten in meinem Leben …
Ruckartig hob ich den Kopf. Ich riss die Augen auf und sog gierig alles auf, was ich um mich herum sah. Denn nur mit neuen Bildern ließen sich diese immer gleichen, sich Nacht für Nacht wiederholenden Erinnerungen verjagen.
Ich zwang mich aufzustehen und mein Gehirn mit neuen Eindrücken zu füttern, um diesen Traum vergessen zu machen.
Wütend auf mich selbst, weil mich die Reue über die Toten im Traum immer wieder heimsuchte, warf ich die Decke auf mein Bett, mein Nachthemd gleich hinterher und begann den Boden meines zugegebenermaßen ungewöhnlich großen Zeltes nach brauchbarer Kleidung für den Tag abzusuchen, was sich als gar nicht so leicht herausstellte.
»Ich muss unbedingt mal wieder einen Putztag einlegen«, murmelte ich, während ich ein unkenntliches Stück Stoff, das starr war vor Schmutz, vom Boden hob und auf einen der Schmutzwäschehaufen in der Ecke warf, die sich bereits bedenklich hochtürmten.
»Aber das kann ich doch für dich tun, Neela.«
Ich zuckte dermaßen zusammen, dass ich einen erschrockenen Aufschrei nicht unterdrücken konnte. Hastig presste ich das nächstbeste Kleidungsstück ungeachtet seiner nicht vorhandenen Sauberkeit vor mich und hoffte, dass meine hüftlangen schwarzen Haare, die mir über die Schultern hingen, dabei halfen, mich notdürftig zu bedecken.
»Beim höchsten Harigah! Du hast mich zu Tode erschreckt, Rip.«
Ein strahlendes Lachen vereinnahmte sein ganzes Gesicht und er fuhr sich verlegen durch sein dunkles krauses Haar. »Ich glaube, das mit dem Tod kannst du wohl besser als ich, aber ich freue mich über dein Kompliment.«
Ich schüttelte den Kopf über seine wirren Gedanken und rollte mit den Augen. »Ja, natürlich kann ich das besser, Rip. Das steht außer Frage.« Schließlich bin ich eine Harigah der höchsten Stufe. »Aber es steht auch außer Frage, dass du gar nicht hier sein solltest. Also würdest du bitte …?« Ich deutete mit meinen Augen Richtung Ausgang, Hände hatte ich derzeit nicht dafür zur Verfügung. »Ich würde mich gerne anziehen.«
Wieder lachte er, wandte sich aber dennoch zum Gehen. »Hab dich nicht so, Neela. In weniger als neun Monden wird das unser gemeinsames Zelt sein und ich werde das hier … sowieso alles sehen.« Seine Augenbrauen hoben sich für einen Moment und machten das, was wahrscheinlich verführerisch wirken sollte. Ich hatte dafür nur ein gekünsteltes Lächeln übrig.
Die Erinnerung an unsere bevorstehende Vereinigung ließ mich schlucken. Er hatte recht. Keine neun Mondphasen würde es dauern, bis Rip nicht mehr nur mein Nachbar, sondern mein Partner auf Lebenszeit wäre. Wenn ich ehrlich war, nervte er mich jetzt schon zu Tode, aber Ehrlichkeit war nicht meine Stärke. Und im Grunde war er eine gute Partie. Er war zuverlässig und fleißig, äußerst auf Sauberkeit bedacht, was meiner Behausung sicher zugutekommen würde, und die meiste Zeit würde ich ihn sowieso nicht zu sehen bekommen, denn durch meine Schutzgänge war ich hauptsächlich außerhalb des Reservats unterwegs. Ich konnte mich also nicht beschweren.
Dennoch atmete ich erleichtert auf, als er dazu ansetzte, mein Zelt ohne lange Diskussion wieder zu verlassen. Doch bevor er draußen war, drehte er sich noch einmal um.
»Fast hätte ich vergessen, es dir zu sagen.« Entschuldigend zog er die Augenbrauen zusammen, wie immer, wenn ihm etwas unangenehm war. »Amaro will dich sehen.«
Bilder schossen durch meinen Kopf, so viele, dass ich sie nicht fassen, nicht erkennen konnte, und augenblicklich beschleunigte sich mein Herzschlag. Amaro wollte mich sehen. Das konnte nichts Gutes bedeuten.
»Was will er von mir?« Ich konnte nicht verhindern, dass meine Stimme zitterte. Wie konnte ich nur so viel Schwäche zeigen? Selbst vor Rip war dies verachtenswert. Wieso konnte ich mich nicht im Griff haben? Bestimmt wollte mich Amaro deswegen sehen. Er merkte alles.
»Das weiß ich nicht.« In einer zwecklosen Geste des Trostes lächelte er mich an. »Aber nicht immer bedeutet eine Unterredung mit Amaro etwas Schlimmes«, machte er seinen Tröstungsversuch noch mehr zunichte.
»Du hast recht, Rip«, presste ich zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. Mein erzwungenes Lächeln fühlte sich wie eine schmerzverzerrte Grimasse an, während er endlich mein Zelt verließ.
***
Auf meinem Weg zu Amaro durchquerte ich das Reservat. Mein Blick glitt über die überschaubare Anzahl unserer Zelte, die meist eng nebeneinanderlagen und von unserer spartanischen Lebensweise zeugten. Das Leben im Gebirge war hart. Der Winter holte sich jedes Jahr aufs Neue seine Opfer, das Wetter war unser natürlicher Feind und die Beschaffung von Nahrung jeden Tag ein neues Abenteuer. Und doch hatte keiner von uns je Ambitionen gehegt, das Gebirge zu verlassen. Es war unsere Heimat. So war es schon immer und letztlich war es die tödliche Wirkung unseres Volkes, die diesem Gebirge vor Hunderten von Jahren seinen Namen beschert hatte: das Mitah-Gebirge – die Todesberge. Wir waren der Tod, der in diesem Gebirge lebte. »Es ist unsere Bestimmung, die Herrscher der Todesberge zu sein«, hatte Amaro einmal gesagt. Denn wir sorgten dafür, dass sich die Ausgestoßenen aus Benoth nicht ins Gebirge ausbreiteten, und ebenso dafür, dass die wechselnden Herrscher von Jissurim nicht ihr Reich bis nach Benoth ausdehnen konnten. Wir sorgten für das Gleichgewicht in der Welt. Wir bewirkten, dass jeder in seinem Reich blieb und die Welt nicht durch einen Krieg machthungriger Tyrannen unterging. Wir – waren die Guten.
Ich kam am Dorfplatz vorbei, auf dem gerade die jüngeren Harigah, die kurz vor ihrer Einsetzung standen, ihrem Einstufungslehrer die Regeln unseres Volkes im Chor entgegenschrien. Es gab nicht viele Regeln, aber diese wenigen wurden mit aller Vehemenz durchgesetzt und keine Ausnahmen geduldet. Sie sicherten unser Überleben. Ich kannte sie in- und auswendig, flüsterte sie wie von selbst mit, während die Einzusetzenden schrien:
»Erste Regel: Verlasse niemals das Gebirge Richtung Süden! Zweite Regel: Bleibe niemals über Nacht vom Reservat fern! Dritte Regel: Unterdrücke dein Gewissen und zeige keine Reue!«
Es war mein höchstes Ziel, niemals eine von ihnen zu brechen.
Endlich erreichte ich den steinernen Torbogen, der aus unserem Reservat hinausführte, und ich schlug den schmalen Pfad zu den Feuerseen ein.
Obwohl Amaro der Oberste der Harigah war, lebte er selbst nicht innerhalb unserer Gemeinschaft. Wie für einen Obersten üblich, bewohnte er die in den Felsen gehauene Höhle oberhalb der Feuerseen.
Sobald ich das Reservat hinter mir gelassen hatte, atmete ich auf. Ich liebte es, die freie Luft zu atmen. Sie schien mir unverbrauchter als innerhalb unseres Dorfes und sie roch nach Freiheit und Abenteuer. Dass sie den bitteren Beigeschmack von Einsamkeit hatte, störte mich nicht im Geringsten. Lieber die Gemahlin der Einsamkeit als die Frau von Rip!
Ich spürte die Atmosphäre der Feuerseen schon, bevor ich sie sehen konnte. Es gab unzählige dieser Feuerseen im Hochgebirge, die durch kleine Rinnsale und Bäche miteinander verbunden waren. Sie waren die einzige Möglichkeit, hier oben an Wasser zu kommen. Ihren Namen verdankten sie ihrem Erscheinungsbild. Sie alle hatten einen schimmernden rötlichen Glanz und wenn der zum Teil sehr heftige Gebirgswind durch die Schneisen fegte, wirkten die Wellen der Seen wie flackerndes Feuer. Ich konnte stundenlang dasitzen und diesem Naturschauspiel zusehen.
Nachdem ich die letzte Wegbiegung hinter mich gebracht hatte, sah ich Amaro bereits am Ufer stehen. Seine Höhle befand sich an einem der kleineren Feuerseen.
Er hatte mir den Rücken zugewandt und erneut beschleunigte sich mein Puls. Ich hatte mir keinerlei Gedanken gemacht, was ich zu ihm sagen sollte. Hatte ich doch nicht den Schatten einer Ahnung, was er von mir wollte.
Amaro war nicht nur der Oberste unseres Volkes, sondern auch der Dorfälteste und mit seinen dreiundsiebzig Jahren eine wirkliche Besonderheit. Das Leben im Gebirge forderte seinen Tribut und wer ein stolzes Alter von fünfzig oder gar sechzig Jahren erreichte, konnte sich glücklich schätzen. Somit war Amaro eine lebende Legende. Jeder brachte ihm Achtung und Respekt entgegen. Sein Wort war Gesetz. So lebte es unser Volk seit Jahrtausenden: Der Oberste war der Schutzherr des Volkes. Seine Aufgabe war es, unser Überleben zu sichern.
Amaros graue Haare blitzten in der Gebirgssonne. Wie immer waren sie zu einem langen festen Zopf geflochten, ebenso sein Bart, der ihm bis unterhalb der Brust reichte. Trotz seines Alters war er ein großer ehrfurchterregender Mann. Es gab wenig Dinge, vor denen ich Angst hatte. Im Grunde hatte ich keine Angst – vor was hätte ich auch Angst haben sollen? Ich war diejenige, vor der die Menschen Angst hatten. Was mich selbst betraf, so gab es nur eine Sache …
In diesem Moment drehte sich Amaro zu mir um. Seine ursprünglich strahlend blauen Augen waren überzogen von einem grauen Schleier, der von seinem stolzen Alter zeugte. Seine Sehfähigkeit war deutlich eingeschränkt, doch Amaro war in der Lage, die Gegenwart eines anderen Harigah zu spüren. Er spüre die Nähe der Todbringer, hatte er mir mal erklärt.
Ich senkte meinen Kopf als Geste des Respekts und konnte nicht verhindern, dass meine Hände feucht wurden vor Nervosität. Meine Faszination für Amaro war grenzenlos. Ich liebte es, ihm zuzuhören und seine Weisheit ließ mich jedes Mal aufs Neue staunen. Und dennoch. Er war wie ein strenger Großvater, bei dem man nie genau wusste, ob er einen nun auf den Schoß nehmen und eine Geschichte vorlesen würde oder ob der strafende Stock der Ermahnung drohte.
»Ich spüre deine Unruhe.« Leise und bedacht verließen diese Worte seinen Mund. Kein Wort von ihm war Zufall. Alles war wohldurchdacht und bewusst gewählt.
»Meine Nacht war unruhig, Oberster«, antwortete ich, wohlwissend, dass ich ihm sowieso nichts vormachen konnte, und in der Hoffnung, er würde nicht nachhaken und auf meine Träume von der noch vorhandenen Reue zu sprechen kommen.
Die Falten auf seiner Stirn gerieten in Bewegung, erinnerten mich an die Oberfläche der Feuerseen im Frühlingswind. Sie verbargen seine wahren Gedanken. Er sprach sie nicht aus.
»Ich habe gehört, es waren zwei gestern«, setzte er an. Die See seiner Stirnfalten hatte sich wieder beruhigt.
»Drei sogar.« Ich gab mir keine Mühe, meinen Stolz zu verbergen. Es war außergewöhnlich, denn die meisten Harigah waren nach einer erfolgreichen Todeswirkung erschöpft und ausgelaugt. Ein paar Stunden Schlaf, etwas Nahrung und vor allem Flüssigkeit gaben die verlorene Energie zurück. Niemand wollte es offen zugeben, aber den meisten Harigah setzte der Anblick eines Toten sehr zu. Obwohl der Tod unseren Alltag bestimmte, so war das Erleben davon jedes Mal aufs Neue mühevoll und individuell verschieden. Auch wenn jeder unbewegt tat, so gewöhnte sich doch niemand an den Tod. Vielleicht lag das daran, dass uns der menschliche Überlebensinstinkt zu natürlichen Feinden des Todes machte.
»Drei also.« Erneut setzten sich die Wellen seiner faltigen Stirn in Bewegung. Er nickte vor sich hin. Seine Gedanken hielt er nach wie vor gut verborgen. Unauffällig wischte ich meine feuchten Hände an den Hosenbeinen ab. Eine Ahnung überkam mich, dass diese Unterredung nichts Gutes zu bedeuten hatte. Dass mir das entscheidende Stück fehlte, um klarzusehen. Was konnte Amaro nur daran auszusetzen haben, dass ich ausgezeichnete Erfolge vorzuweisen hatte? Meine täglichen Schutzgänge zur Sicherung unseres Gebirges waren stets erfolgreich und regelkonform. Ich kannte die Regeln und ich hatte sie verinnerlicht, zu meinen eigenen gemacht. Es widerstrebte mir zutiefst, sie zu übertreten.
Mein Name ist Neela und ich bin eine Harigah. Töten ist meine Bestimmung und ich zeige keine Reue. Niemals. Niemals.
Unwillkürlich hielt ich den Atem an. In meinem Inneren ging ich verschiedene Szenarien durch, sammelte Gründe für Rechtfertigungen, hoffte, er würde meine Schwachstelle nicht nutzen, um mich vor dem Volk bloßzustellen oder gar meinen Einstufungstest für ungültig zu erklären. Hoffte, er würde meine Reue nicht sehen. Denn Reue hatte im Leben eines Harigah keinen Platz. Dessen wurden wir von klein auf gelehrt: Ein wahrer Harigah kannte keine Reue. Und weil ich unserem Volk alle Ehre machen wollte, war es mein oberstes Ziel, diesen Rest Reue, der immer noch in mir schlummerte, zu eliminieren – es war eine Schande, dass ausgerechnet ich, eine Harigah der höchsten Stufe, dieses Ziel noch nicht erreicht hatte. So versuchte ich nun, mir meine Gedanken nicht anmerken zu lassen. Es würde nur Zweifel an meinem Einstufungstest aufwerfen, wenn ich dieses Thema ansprach.
Als er dann zu reden ansetzte, überraschte er mich.
»Du brauchst eine Pause.«
»Ich … Wie meinst du das?« Irritiert blickte ich ihn an. Was wollte er mir damit sagen? Unser Volk arbeitete hart und so etwas wie Pausen kannten wir nicht. Jeder hatte seine Aufgabe, um das Überleben aller zu sichern. Meine war der tägliche Schutzgang bis zur Grenze nach Benoth, besonders ich hatte den speziellen Auftrag, die Grenze weitläufig von Ausgestoßenen freizuhalten, damit sie nicht ins Gebirge eindringen konnten. Was mit meinem großen Wirkungsradius auch keinerlei Problem darstellte. Und im Gegensatz zu den meisten anderen Harigah zeigte ich kaum Schwäche.
»Aber ich …«, stotterte ich unverständig, obwohl ich wusste, wie respektlos ihm das erscheinen musste. Eine Harigah stellte das Urteil des Obersten nicht infrage. Doch ein innerer Drang trieb mich dazu. »Ich brauche keine Pause.« Es kam beinahe einer Beleidigung gleich, dass er mir dies vorschlug, und auch wenn ich wusste, wie trotzig das nun klang, konnte ich nicht anders. Im letzten Moment verhinderte ich noch, meine Hände in die Seite zu stemmen.
»Mir geht es gut. Ich bin kräftig, habe keinerlei Ermüdungserscheinungen. Ich brauche keine …«
»Das sagte deine Mutter auch«, unterbrach er mich bestimmt. »Kurz vor ihrem Tod.«
Auf den Stich in mein Herz war ich nicht vorbereitet gewesen. Unwillkürlich ballte ich meine Hände zu Fäusten und versuchte die aufkommenden Gefühle niederzuschmettern wie lästige Fliegen. Namenlose Gefühle, über deren Bedeutung ich nicht bereit war, nachzudenken. Dass er dieses Thema anschneiden musste, ließ eine unerklärliche Wut in mir aufsteigen.
»Du wirst dir heute eine Auszeit gönnen. Ich habe bereits jemanden für deinen Einsatz eingeteilt. Morgen kannst du wieder deinen gewohnten Schutzgang übernehmen, aber heute brauchst du Ruhe, sonst …« Seine Augen wirkten auf einmal ganz nah. Der graue Schleier, der sie unentwegt überschattete, hatte sich gelichtet und sein Blick auf mir ließ Unruhe in mir aufsteigen. Und da sah ich es. Es war ein Aufblitzen in seinen Augen, das mehr zu bedeuten hatte. Mit einem Mal war ich mir sicher, dass er ein Geheimnis hatte. Dass er mehr wusste, als er bereit war, mir zu sagen. Etwas, das mich und mein Leben betraf. Doch bevor ich noch mehr erkennen konnte, drehte er sich abrupt um und verschwand in seiner Höhle.
***
Auf meinem Rückweg war ich so sehr in Gedanken versunken, dass ich die zunehmende Unruhe im Reservat erst bemerkte, als mehrere Heiler direkt an mir vorbeieilten. Ich ahnte sofort den Grund dafür, dennoch trieb mich meine Neugierde hinterher. Sobald ich ihnen folgte, setzten die Schreie ein. Der kühle Gebirgswind trug den Klang von Schmerz und Trauer weit hinaus bis über die Spitzen der Berge. Ich folgte den immer lauter werdenden Schreien bis zu ihrer Quelle, um das vorzufinden, was ich ohnehin wusste. Wenn jemand wusste, wie der Tod klang, dann ich. Die lauten Töne des Schmerzes, die dissonante Melodie eines verzweifelten Kampfes gegen die Unabwendbarkeit des Lebens, die Nuancen in Moll, wenn eine weitere Seele ihren Körper verließ. Der Tod war mir vertrauter als das Leben.
So war ich auch jetzt nicht überrascht, die von Trauer gezeichneten Gesichter zu erblicken. Der Hauch des Todes war beinahe greifbar. Es musste gerade erst geschehen sein. Ich näherte mich dem Zelt des Heilers, aus dem die Schreie soeben verklungen und nun durch leise weinende Klagelaute ersetzt worden waren. In diesem Moment schlüpfte mein Vater mit einem gequälten Gesichtsausdruck aus der Zeltöffnung. Er war einer der Heiler unseres Reservats. Ich beobachtete ihn, bevor ich auf ihn zuging. Obwohl auch er tagtäglich mit dem Tod zu tun hatte, ging es ihm doch jedes Mal aufs Neue sehr nahe. Mir war nicht klar, ob ich ihn für diese Schwäche bewundern oder verachten sollte. Er fuhr sich mit seinen Händen über die Stirn und seine zusammengepressten Lippen zwangen sich zu einem Lächeln, sobald er mich erblickte.
»Neela, ich hätte mir denken können, dass du zu den Ersten gehörst, die es mitbekommen.«
Seine Augen bekamen einen mitleidigen Ausdruck, wie immer, wenn es um meine außergewöhnlich hohe Todesbegabung ging. Er war damals nach meinem Einstufungstest beinahe zusammengebrochen. Auch wenn er es bereits geahnt hatte, so hatte er sich doch erhofft, im Unrecht zu sein. Lieber hätte er mich auf einer sicheren Position innerhalb des Reservats gewusst. Dass seine Tochter eine höchste Harigah war und sich jeden Tag bis ins Land der dunklen Wälder vorwagte, hatte er nie verkraftet.
»Wer ist es diesmal?«, fragte ich beiläufig und versuchte seine Anspielung und die unguten Gefühle, die sie an die Oberfläche drängen wollten, zu unterdrücken. Schuldgefühle konnte ich mir beim besten Willen nicht leisten.
Mein Name ist Neela und ich bin eine Harigah. Meine Gegenwart tötet Menschen. Das ist meine Bestimmung.
»Palita«, seufzte er resigniert. »Schon wieder.«
Unser Volk war, obwohl es seit Urzeiten hier oben im Gebirge lebte, nach wie vor sehr klein. Das lag hauptsächlich an der hohen Sterberate an Säuglingen. Viele Babys starben bei der Geburt, einige sogar schon im Bauch der Mutter. Amaro erklärte dies mit der unterschiedlichen Todeswirkung eines jeden Harigah. Körperlich geschwächte und anfällige Harigah konnten von Harigah mit hoher Todeswirkung getötet werden. Babys, Kranke, selten auch Schwangere. Nur die Stärksten überlebten.
Palita wurde unter der Hand bereits Todesmutter genannt. Keine im Volk hatte so viele tote Babys geboren wie sie. Nicht eins hatte bisher überlebt. Und obwohl jede von uns wusste, dass der Tod zum Schicksal unseres Volkes gehörte, so war es doch für Palita ein harter Schlag, keine lebenden Nachfahren zu haben. Denn ihre gebärfähige Zeit lief langsam ab. Genau wie ich war sie eine Harigah der höchsten Stufe.
»Dieses Mal hatte sie es sogar bis zu den Wehen geschafft«, erklärte mein Vater leise seufzend. »Ich hatte so große Hoffnung, dass wir es schaffen.«
Es fiel mir schwer, Mitgefühl zu heucheln. Meiner Meinung nach sollte sie mit den Gebärversuchen aufhören und ihrer Aufgabe als Grenzwächterin und Kontrollgängerin nachkommen. Ihre Schwäche würde noch mal ihren Tod bedeuten. Ich nahm mir fest vor, die Sache mit dem Kinderkriegen aus meinem Leben fernzuhalten. Sicher würde ich Amaro davon überzeugen können, dass es für eine höchste Harigah wie mich nur Zeit- und Energieverschwendung wäre. Enthaltsamkeit schien mir ohnehin die angenehmere Methode einer lebenslangen Partnerschaft mit Rip zu sein.
»Tut mir leid, Vater«, sagte ich mitfühlend und meinte damit, wie leid es mir tat, dass er sich in eine solch unnütze Sache derart reinsteigerte. Dankbar blickte er mich mit müden Augen an.
»Ich bin stolz auf dich, mein schwarzer Panther«, sagte er wie so oft und legte seine Hand auf meine schwarze Schulter. Denn ebenso schwarz wie meine Haare waren auch alle meine Kleidungsstücke. Ich liebte diese Farbe. Genau genommen war es keine Farbe, sondern ein Zustand. Es war die Abwesenheit aller Farben und letztlich der Ausdruck dessen, was ich war. Ich war schwarz. Schwarz wie die Nacht, schwarz wie das Loch, in das man fiel, wenn einem die Lebenslichter ausgelöscht wurden. Schwarz wie der Tod. Denn genau das war ich. Ich war der Tod.
Dennoch war ich meinem Vater dankbar dafür, dass er darum bemüht war, mir all das zu schenken, was Eltern ihren Kindern auf ihrem Lebensweg mitgeben sollten: Liebe, Anerkennung, Wertschätzung, Selbstwertgefühl. Es war immer sein erklärtes Ziel gewesen, mir Vater und Mutter zugleich zu sein. Wir wussten beide, dass er kläglich versagt hatte. Aber wahrscheinlich war eine verlorene Mutter nicht zu ersetzen.
Ich ignorierte den wohlbekannten Schmerz. Einen Schmerz, der die Leere in meinem Inneren füllte, wo die Liebe einer Mutter hätte sein sollen.
2. Kapitel
Es gibt viele Dinge, die ich dir sagen würde, wenn du vor mir stehen würdest. Ich bin mir nicht sicher, womit ich anfangen würde. Ich habe viele Fragen und weiß nicht, ob ich für deren Antwort bereit bin. Jeden Tag aufs Neue frage ich mich, warum du mich verlassen hast. Warum du mich allein gelassen hast. Ich frage mich, ob ich so geworden bin, wie du es dir gewünscht hast. Ob du stolz auf mich wärst.Doch im Grunde weiß ich, dass die Antwort darauf völlig bedeutungslos ist.
Dunkelbraune Schwingen hoben sich vom strahlenden Hellblau des Frühlingshimmels ab. Majestätisch ausgebreitete Flügel mit einer Spannweite von über zwei Metern glitten lautlos und sanft über mich hinweg und ich erkannte das besondere Muster der weißen Federn innerhalb des Dunkelbrauns, das bei ihr so anders war als bei den anderen jungen Steinadlern. Ich genoss es, ihr zuzusehen in ihrer Freiheit, die sie in den hohen Lüften auslebte und zelebrierte, bevor sie in den Sinkflug ging und voller Grazie auf meinem ausgestreckten Arm landete. Zur Begrüßung stieß sie einen heiseren Schrei aus und ich staunte einmal mehr, wie sie in Windeseile ihre gigantischen Schwingen zusammengefaltet und wie ein Kleid angezogen hatte. Eine wunderschöne Adlerdame.